Atlantisches Tief
Lazarus
Aus der Gruft entlassen,
wankt er ans Tageslicht.
Das Leben hat ihn wieder, das Leben.
Am vierten Tag und nur im Hemd
erscheint er zum Fest seiner
Wiederkunft. Schmal schleicht
er sich herein und setzt sich
auf seinen Stuhl, beschämt,
weil man diesen Stuhl,
den er doch geräumt hat,
für ihn und nur für ihn
freigehalten hat.
Er ist gekommen, um sein
Ableben zu entschuldigen,
das man ihm seitens
der tätigen Welt unter
die blasse Nase reibt.
Faul herumliegen und dem Herrgott
die Zeit stehlen... Völlig unakzeptabel...
Sehen Sie, bei der Konkurrenz wird
schon längst nicht mehr gestorben...
Da können wir doch nicht....
Die Wirtschaft muss brummen.
Schubertabend
Gebücktes Zucken unter Leinentüchern,
wenn das Quintett zu spielen beginnt.
Es ruckeln die Tassen, sie entschweben,
als gäb' es keine Erdenschwere mehr.
Traulich klingt das Lied von Freud
und Leid. Auf der Partitur ein Klecks,
der wächst und nimmt die Nacht ganz ein,
Schuberts Tinte schwärzt das Daunenreich.
Das Hörrohr empfängt die Sonatine
als Kerzengeknister. Und auf gehäkelten
Tasten fingert die Pianistin Hannelore
zum Abschluss eine trauervolle Triole.

Beim Photographen
Kantig frisiert und wächsern
schattiert wurde der Mensch
zur Person. Zur Persönlichkeit
im feingeschnittenen Oval
kultivierter Selbstgewissheit.
Sich aufbewahren als etwas
Eingemachtes, Feingemachtes:
ein Kennzeichen von Privatheit.
Man wurde auf einen Stuhl geschraubt
und in eine Halsstütze geklemmt.
Manchmal mit einer dorischen Säule
für den links abgewinkelten Ellbogen.
Und so wurde man belichtet, angerichtet,
über etliche gezählte Sekunden hinweg,
in Dauer gegossen für die Carte de Visite
oder die noch leere Wand im Vestibül.
Zu lachen gab es nichts: man war fixiert,
in würdiger Erstarrung betäubt,
als koste ein offenes Knöpfchen
den Hals.
Frühling
Fürs erste nur ein Fenster
nachadventlich geöffnet
im Bastelkalender,
hingemalt auf Billigpapier,
der Ordnung halber verborgen
in Klarsichthülle und Kampfer.
Den Winter lass im Schrank.
Geh aus und mach dich auf,
gib dir freies Geleit, dir selbst
und deinen wankenden Gedanken.
Verbinde deine Augen nicht,
verbinde dich, dein Augenlicht
mit den gelb bestirnten Wiesen
und dem wasserfesten Himmel
und dem Lächelgesicht der Sonne.
Geh aus und zweimal im Kreis,
um dich selbst aufs Bild zu bringen.
Zuletzt fehlt noch, was kein Buntstift
oder Pinsel herzaubern kann:
ein Windhauch, der auch die
unsichtbaren Farben zum
Leben erweckt.

Luftschiff
Über Dächer und Seilmasten
hinaus wie ein versehentlich
losgelassener Kinderballon...
Mit drei Hurras entkoppelt...
Und dann des Tages Last und Mühe
abwerfen zum richtigen Zeitpunkt,
am richtigen Ort.
Und gemächlich, fast ohne Wolken, blättert
der Schulbuchatlas seine Länder auf,
seine kleingezackten Küsten.
Eine Frage der Perspektive.
Mit knattrig aufgespannten
Schlagflügeln der Stratosphäre entgegen...
Hinauf ins All, geschaukelt nur
von Glockengeläut...
Und dann das Atmen durch die Frostmaske:
ein Zustand quälender Euphorie.
Was du nicht sagst!
Das Japsen verknappter Atmung hat nichts mit
japanischen Massenaufläufen zu tun.
Und Briefkastenfreunde, auch kleine, leben nicht
in Briefkästen.
Ich weiss, ich weiss.
Zeitlich beginnt man sein Leben eigentlich erst,
wenn man seine erste Uhr geschenkt bekommt.
Und kein Schmelzwasser dieser Welt kann sich
damit brüsten, ein Schneemann gewesen zu sein.
Wohl wahr. Wohl möglich.
Womöglich wird man herausfinden, dass
das Leben auf der Erde so unwahrscheinlich
ist wie einzigartig. Ein absolutes Unikum.
Und dass wir die einzigen Wesen
in diesem unvorstellbar riesigen
Universum sind, die etwas
zu sagen haben.
Was du nicht sagst!

Der Schwarzseher
Er sah das Unglück voraus,
sah es kommen mit dem Blick
einer schwarzäugigen Kassandra.
Hielt nicht mit Warnungen zurück
und suhlte sich, auf Schockwirkung
bedacht, in den krudesten Beschreibungen.
Kein Schwarz war ihm schwarz genug.
Die Folgen waren die üblichen:
niemand wollte es wahrhaben,
das Unglück, das da dräute.
Also schimpfte man ihn einen Schwarzseher.
“Der sieht eine Wolke und denkt schon an Hagel.”
Als das Unglück dann eintraf,
war’s um den Schwarzseher abermals
schlecht bestellt, schmähte man doch
seine Prophezeiung als die eigentliche
Ursache und Schuld.
“Man kann ein Unglück auch herbeireden...”
Hätte er geschwiegen,
sich gar nichts anmerken lassen,
so hätte man ihn unter dem Eindruck
des eingetroffenen Unglücks
erst recht an den Pranger gestellt:
wegen unterlassener Hilfeleistung.
Strassenlampen
Unzählbar sind sie, unverzichtbar.
Nachts beleuchten sie die Strassen
massvoll und verlässlich. Sehr zum
Nutzen der Allgemeinheit, die sich
ihre Mobilität einiges kosten lässt.
Licht auf Licht zu beiden Seiten
unendlich verzweigter Bahnen,
gut montiert unter schwächlichen,
menschenfernen Sternen.
Man sagt: der Sicherheit wegen.
Damit keine Unfälle passieren.
Doch nein, das ist es nicht.
Der grösstmögliche Unfall,
dem Himmel sei’s geklagt,
ist unvermeidlich.
All die Leute
oder sagen wir: Leuchten,
die sich jetzt noch so sicher fühlen
in ihren Lofts und Villen,
in ihren Verwaltungsräten,
Finanzausschüssen
und Bankengremien,
könnten dereinst an diesen
Lampen baumeln und
keinen Mucks mehr tun:
die krawattierten Hälse
endgültig zugeschnürt,
die Gier erloschen.
Wie praktisch ist doch so eine Strassenlampe!
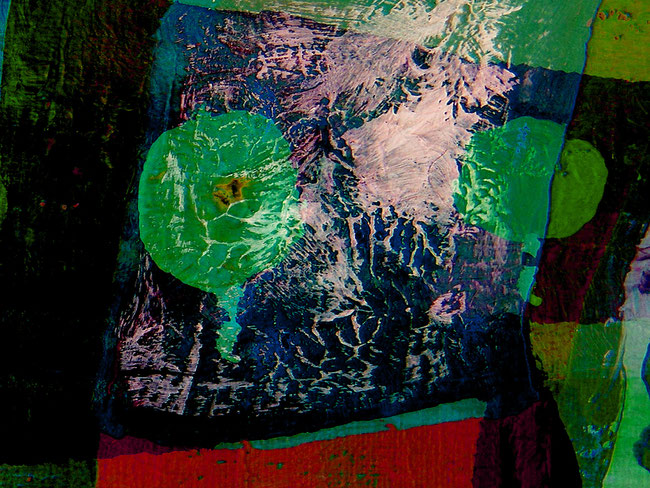
Landbahnhof
Nun bin ich reisefertig,
warte mit meinem Koffer
auf dem verlassenen Peron:
nein, nicht auf den Zug.
Es gibt kein Abschiednehmen.
Der Bahnhof hat ausgedient.
Die Schatten werden länger,
und die Sonne, ein kleines
Stücklein Gold, schimmert
noch schwach hinter
gelblichen Blättern,
schimmert noch
schwach, noch
schwach...
Warten ist eine Kunst.
Arbeit
Bei der Arbeit trinke ich nie.
Ist auch kein Wunder, denn ich
meide jede Arbeit konsequent.
Ich wahre meine Prinzipien.
Arbeiten ist etwas für Gartenzwerge
und Schlümpfe, die sich furchtbar
wichtig vorkommen, wenn sie mit
einer grossen Mütze rumstolzieren.
Kochmütze, Haube, Helm, Dienstkappe,
ein Bleistift hinterm Ohr: und schon ist man wer.
Die meiste Arbeit erledigt
sich von selbst. Man muss nur
fest daran glauben. Die Protestanten
haben die Arbeit erfunden, damit
das Leben nicht zu freudig wird.
Gottes Zahltag erfordert Schweiss
und die unbedingte Treue zum steifen
Minutenzeiger. Was natürlich
längst nicht mehr genügt, o nein,
wo kämen wir da hin? Die Zeiten
blosser Pflichterfüllung sind vorbei.
Arbeiten muss doch Spass machen!
Motivation und Engagement bis
zum Äussersten und Innersten.
Leistung ist alles, Arbeit macht frei.
Und wehe, der Spass bleibt aus...
Bei der Arbeit bin ich frohen Mutes.
Ist auch kein Wunder, denn ich rühre
keinen Finger. Ich streike. Ich hülle
mich in die einzige Wolke, aus der
man nicht fallen kann. Das Unbezahlbare
ist mir kostbar. Da zahl ich ungern drauf.
Des Lebens Gehalt mit dem Gehalt
auf dem Konto zu verwechseln,
ist keine Sache der Linguistik.
Und noch weniger des Fleisses.
Gebt mir eine Schaufel in die Hand
und ich arbeite wie ein Tier. Manche
Dinge müssen eben erledigt werden.
Die Vollziehung und Abwicklung
der jeweiligen Sachbearbeitung
erfolge so prompt wie möglich:
damit die Hände wieder frei sind.
Doch wozu das ganze Drumherum?
Nicht die Schaufler, Müllmänner,
Krankenpfleger, Putzen, Kellner,
Schreiner, Gipser veranstalten
diesen Affenzirkus und Flaschentanz,
diesen wichtigtuerischen Schwindel,
den man uns als Arbeit andreht.
Die meisten von uns arbeiten ja nur
noch auf Zeit und zum Schein,
billiges Menschenmaterial
für die unersättliche Wirtschaft:
und doch nicht billig genug. Und
auch nicht zäh genug. Viel zu menschlich.
Roboter-Schimpansen mit dickem Fell
und blinder Gehorsamkeit gehn in Serie,
gehn an die Arbeit. Und so werden
die Entlasteten entlassen und
gebrandmarkt als Versager: wer keine
Arbeit hat, soll sich was schämen...
Pech gehabt, ihr Schufter und Büetzer,
die ihr dem Arbeitsmarkt notorisch
zur Last fällt; das Glück gehört den Blendern,
die sich ihren Blenderjargon vergolden lassen
und den Effizienzwahn Verantwortung nennen.
Wohl bekomm’s: der Festschmaus
ist angerichtet. Schon lange sitzen
sie auf ihren fetten Pöstchen,
ihren Fettpölsterchen sozusagen,
die grosskotzig Ausgebildeten,
die im Nickmodus aufstrebenden,
diplomierten Pseudos.... Wenn
der Schwindel bloss nicht auffliegt!
Denn auch hier wird gnadenlos gesiebt,
getreten, ausgesondert und gerempelt,
und ständig heisst es: Mann über Bord.
Nein, zu beneiden sind sie nicht,
die von der Nadelstreifen-Etage,
denn das allzeit bereite Fallbeil macht keinen
Unterschiel zwischen Henker- und Opferhälsen.
Wenngleich die einen etwas länger davonkommen
als die andern: ein Unterschied so fein wie Seide.
Ihr Berufstätigen, die ihr Tag für Tag
aufs Schönwetter-Leiterchen steigt
und eitel Sonnenschein verbreitet, die ihr
von Lebensnotwendigkeiten sprecht,
von Geld und Vorsorge und der Gewissheit,
das Richtige und Sinnvolle zu tun,
aus dem Leben etwas zu machen,
etwas Rundes und Erfüllendes.
Schön und gut, aber wie wär’s
mit einem Blick über den Tellerrand?
Ihr meint die Hauptrolle zu spielen
und seid doch nur Statisten. Über kurz
oder lang wird man euer Geld entwerten,
eure Renten kürzen, eure Freiheit beschneiden,
eure Ersparnisse einziehen, eure Besitztümer rauben
und euch mitsamt euren Jobs wegoptimieren....
Gratuliere, die Selbstabschaffung des Menschen
ist in vollem Gange. Scheitelhoch steht
uns der Irrsinn, den wir uns selbst
eingebrockt haben im voreiligen Jubel
über das einstürzende Utopia....
Jubelnd haben wir uns dem Eigennutz
verschworen, dem Lauf zum Kauf,
und so laufen und springen wir
im Haufen munter über die Klippe
hinab: Ego-Leistung und freier Markt
als jedermanns Vorteil etcetera blabla.
Das nennt man wohl: den Teufel mit
dem Beelzebub austreiben. Denn wer
bezahlt am Schluss die Rechnung?
Wer bezahlt all die Absahnungsprämien
und Profitspielchen raubgieriger Milliardäre,
wenn nicht die, die sich durch ihre Strampelei
im Wirtschaftshamsterrad selber eliminieren?
Und sich immer noch einreden, sie würden
ihre Existenz sichern... Für die Gesellschaft
von Wert sein... Dem wohlgehegten Leben
Sinn und Richtung geben, Sinn und Richtung,
als wäre bezahlte Arbeit etwas anderes
als ein Hamsterrad für Blödsinnige,
die das Wort Stockholm-Syndrom nicht kennen.
Nein, Marx ist nicht tot, er schläft nur.

Schüttgut
Dies ist kein Gedicht über Schüttgut.
Mit Schüttgut befassen wir uns hier nicht.
So beredt das Wort auch daherkommt:
seine Bedeutung interessiert uns nicht,
ist nichts, in das wir uns versenken wollen.
Gleichwohl ist Schüttgut ein schönes Wort.
Für ein Gedicht gerade das Richtige...
Einem Gedicht stünde es gut zu Gesicht...
Schüttgut, Schüttgut, Schüttgut: wunderbar.
Wie gut, dass dieses Wort niemandem
gehört, von niemandem patentiert ist:
es gehört uns allen, verschenkt sich
anspruchslos, ohne sich zu spreizen.
Wie’s nur schon klingt! Schütt-gut.
Das muss in ein Gedicht kommen,
auf einen sprechenden Tanzboden.
Die zweisilbige Schönheit wäre sonst
verschüttet und verkannt. Man könnte sagen:
umsonst. Niemand würde sich um sie scheren,
und Schüttgut wäre vielleicht der Rede,
nicht aber des Dichtens wert. In der Tat
macht sich Schüttgut gut in einem Gedicht,
diesem Gedicht, das doch gar nicht von
Schüttgut handelt, Schüttgut an und für sich
völlig ausklammert, an und für sich könnte
dieses Gedicht auch von Pfirsichen handeln.
Oder von Pflaumen! Aber bleiben wir bei
Schüttgut. Schüttgut hier und Schüttgut dort.
Nur ein Wort, aber was für eines! So schön
wie Frauenbeine, funkelnd wie Morgentau.
Bloss - wie geht das zu? Ein Papiergebilde
mit scherenschnittigen Konturen klappt auf,
springt knospend in den Raum, wippende,
biegsame Taschenarchitektur, die man
sich fingerspitzenfindig zurechtfalzt,
und dann noch dreimal geschüttelt -
und schon hat man das ideale Güttschut.
Circus
CIRCUS CIRCUS CIRCUS
blinkt es ohne Wackelkontakt.
Und der Elektriker, der dies vollbracht,
steigt zufrieden von der Leiter herab.
Und die Kassiererin zählt das Münz.
Und der Ansager übt die Ansagen.
Und das Orchester übt den Tusch.
Und der Trapezkünstler pudert sich ein.
Und der Kraftmensch ölt seine Muskeln.
Und der Jongleur sortiert seine Bälle.
Und der Messerwerfer instruiert seine Dame.
Und die Kunstreiterin macht sich sattelfest.
Und das Schlangenmädchen verbiegt sich zu einem Geglitzer.
Und der Fakir knetet Nägel in seinen Kaugummi.
Und der Magier prüft den doppelten Boden.
Und der Löwenbändiger füllt den Futternapf.
Und der Weissclown schminkt sich weiss.
Und die Bauchrednerin unterhält sich mit ihrem Fötus.
Und der Seiltänzer zentriert seine Zehen. Und der vom Feuerreif
kandierte Springschimmel muss noch gestriegelt werden.
Und der dumme August?
Der baumelt an einem Scherzartikel-Strick.

Die insubrische Sonne
I.
Eine “Caldera” nennt man eine Stelle im See,
an der das Wasser köchelt und kocht.
Treppab führen alle Gärten zum Schlick.
Ein Moment wie Augenzwinkern, da ein Blitz
aufleuchtet und gleich noch ein zweiter und
die steinerne Dryade ein schiefes Gesicht zieht,
als wäre sie so gemeisselt worden.
Endlich wächst der Schnorchler,
der im Trüben gestochert und
auf Rufzeichen kaum reagiert hat,
aus dem unruhigen Wasser und gibt
sich winkend als gerettet zu erkennen,
auf der Glatze etwas Zottliges,
eine lebende Perücke,
ahnungslos heraufgefischt
aus gar nicht so tiefen Tiefen.
Von fern ein knackendes Donnern,
ein hackendes Splittern...
Oh du nackte Dryade beim Bad!
Pack deine Sachen, bevor’s der Wind tut.
Pack dich am Schopf und verzieh dich
landeinwärts in den schrumpfenden Tag.
Ein Rosenkranz aus Schwimmkorken
tänzelt von Welle zu Welle, von Welle zu Welle.
Kippt das Wetter, kippen auch die Uferschwalben.
Nun schau, was da geschieht:
etwas Langsames und Schwarzes
hebt die Welt aus den Angeln,
und die Borromäischen Inseln
versinken wie ein kleines Atlantis.
II.
Dem weit gewordenen See
sind noch keine Segel gesetzt.
Der Regen ist geschaukelt,
der Himmel hochfliegend hoch
über die Bergspitzen gebreitet.
Eine Stimmgabel gibt den Ruheton,
den alles durchschwingenden
schönen Ausgleich...
Friedlich wie Nähnadeln
kreuzen die Dampfschiffe
nach einem gespiegelten
Fahrplan, strichpunktiertes
Hin und Zurück auf
strömenden Bahnen.
Ab sieben duftet es wieder
hemdsärmlig nach Brot.
Und in der Schädelhöhle
eines Menschen, der gähnend
seine Fensterflügel aufdrückt,
baden sich krakeelend die Spatzen.
Kurz danach
verlässt man die Terrasse
ordentlich gestärkt und
mit einem Frottiertuch
über der Schulter,
klassischerweise barfuss.
Die Sonne wechselt den
Längengrad und mengt
sich unter die Blätter;
also runter zum Bad,
Goethes Zitronen im Kopf
oder den süssen Wahn vom Süden
- und um die Stirn ein Kranz
aus insubrischen Strahlen.
III.
Himmelwärts knallen die Tauben.
Rundherum und überall schallt
es auf und ab, Spielglockengeläut
hoch zwölf. Es läutet Mittag, vieltönig,
als wär' das Hin und Her unter der Pergola
ein kirchliches Fest, ein Hochamt,
zelebriert von Schweizer Gardisten.
Das programmierte Glockenspiel
braucht keinen, der am Seil zieht.
Der Glöckner Giaccomo steht ausgestopft
im Ortsmuseum gleich neben der Kirche:
besonders für Kinder eine Attraktion.
Sein Buckel bringt bei Berührung
immer noch Glück.
Weiter oben die Bildstöcke
am Säumerweg, weitab
von den Manen und Musen
und Gorgons Haupt und dem
dunklen Wasser am Zypressentor.
Am Berg wird man fromm,
weil Gott ein Einsehen hat,
wenn man sich hinaufmüht
zwischen Bruchsteinen
und Kreuzen, härenen
Gewandes am Wanderstock,
um irgendwo am Wegrand
ein geweihtes Herzjesu-Kerzlein
hinzustellen.
Unten am schwatzhaften See
ist man dann wieder Römer
oder Grieche. Glaubt ans
Auf und Nieder. Oder an gar nichts.
Und das dunkle Wasser bleibt
vielleicht gar nicht so dunkel:
es kann sich aufhellen
wie von einströmender Milch.
Atlantisches Tief
Es regnet wieder einmal Schirme
aus einem Himmel voller Katzen,
die auf alten Bratschen tatzeln.
An den Bäumen tröpfelt Notenpapier.
Regen pladdert unaufhörlich,
rauscht aus allen Wolkenbänken.
In den Beizen und den Schenken
rauscht indessen nur der Rausch.
Der Maler stapft in Pelerine
auf der Wiese auf und nieder.
Die Nässe ist ihm sehr zuwider,
weil sie Farben matschig macht.
Und es fröstelt sprachverloren
der Dichter in der dünnen Jacke.
Im Regen poeten: eine Macke,
die nur ihn befallen kann.
Die Mehrheit flüchtet in die Stuben,
in die wohlgewärmten Zimmer.
Draussen wird es immer schlimmer
mit dem Jammerregenschwall.
Doch auch drinnen steht nicht alles
nur zum Besten. Mancher brütet
still ein Leiden aus und hütet
sich vor allzu starkem Durchzug.
Die Nase tropft, der Husten rasselt,
beides gibt man keuchend weiter,
zwei ungeliebte Wegbegleiter
auf dem Weg ins vorgewärmte Bett.
Heiss und kalt und blass und blässer
schlottert man in Fieberwehen,
wälzt und rollt sich in den Seen,
die man ausschwitzt noch und noch.
In die schluckbereiten Dolen
schwemmt’s herab die Himmelsbläue.
Klamm und heimlich frisst sich Fäule
durch die schlecht verputzte Wand.
Ein Taschentuch, der Herr, die Brille
beschlägt ganz übel bei diesem Wetter.
Das Wetter erscheint ein wenig netter,
wenn man sieht, wie hässlich es ist.
Wer gesund bleibt, hat’s gemütlich,
schätzt das Schlechte wie das Gute,
setzt sich in die gute Stube,
um zu sehen, was draussen so läuft.
Fernsehabend bei den Müllers,
Prognosen, die es in sich haben:
Kometenschweife, Menschheitsplagen
und vor allem sehr viel Tiefdruck.
Die Fische im Aquarium schwimmen
allesamt herbei und glotzen:
das Wetter finden sie zum Kotzen.
Ihr Glück, dass sie im Trocknen sind.
Schwammgleich saugen sich die Böden
voll mit glibberschwarzer Gülle:
im Klärschlammbecken schwappt die Fülle
über, bläht sich der Gestank.
Frau Nüssli geht jetzt oft spazieren
in der Hoffnung, dass der Regen
sie verschönere. Der Pflege wegen
nimmt sie den Pfützenlauf in Kauf.
Stiefelspitzig in das Wasser
tritt sie ohne jedes Zaudern,
bleibt dann stehen, um zu plaudern
mit einem rostigen Abflussrohr.
Fern am Talrand klebt ein altes Haus,
verwischt von dicken Schauern.
Es schimmert, glimmert halb im Blauen,
halb in Regenwasser getaucht.
Die Sonne biegt den Regenbogen
für eine kurze zittrige Weile...
Schon regnet’s weiter ohne Eile,
grau und schwarz und schrecklich dumpf.

Hochhaus bauen
Sie bauen nicht schräg, sie bauen nicht krumm.
Sie bauen in die Höhe. Gerade in die Höhe:
Haus nach Haus nach Haus. Hoch hinauf und
grad und höher noch als hoch. Und hoch hinaus
dazu. Immer in die Höhe. In die höchste Höhe,
weil dort noch Platz ist. Sie bauen, das ist ihr
gutes Recht, ein Hochhaus an das andere.
Sie richten auf und richten zu. Ein Hochhaus,
das muss stehen. Und immer noch eins dazu.
Ja, die Höhe wird verbaut mit Häusern hoch 
und höher, mit Häusern hoch und ohne Zahl.
Bauen, bauen, bauen: in die Höhe immerzu.
Sie bauen früh, sie bauen spät, von früh bis
spät die Arbeit geht. Sie bauen und sie bauen.
Sie bauen nicht schräg, sie bauen nicht krumm.
Sie bauen in die Höhe. Gerade in die Höhe:
aufwärts geht es grad und gräder, bauen
streng nach Mass so weit der Himmel reicht.
Immer hoch hinauf und stetig in die Höhe.
Ja, die Höhe ist gut, die Luft da oben und
die Aussicht noch dazu. In die Wolken treibt
man Haus um Haus. Hoch hinauf und grad
und höher noch als hoch. In die Wolken damit!
In die allerhöchste Höhe baut man mit Gewinn.
Weil dort noch Platz ist und Luft noch reichlich
vorhanden, für alle reicht. Für alle, alle, alle.
Wabe
Durch den wiedehopfköpfigen
Wald schwebt die erste Flocke
schüchtern herab. Eine Schneise
mit Weg und eisenvernieteten Masten,
zwei Streifen furchiges Gras,
schon ein wenig überglast.
Das Atmen erreicht die Ohren
nur noch von innen.
Und in den geschwungenen Drähten
ein Surren wie von erkälteten Bienen,
die es kaum erwarten können, dass
sich aus grossen weissen Räumen
ein Gewimmel löst, eine Wand,
die niedersinkt, endlos niedersinkt
und zugleich etwas Neues baut,
eine tiefstille Wabe um das
schlafende Leben herum.

Drinnen
Es umgeistert dich draussen,
die Nacht vielleicht, das Dunkel.
Es umgeistert dich drinnen,
obwohl du’s ausgesperrt hast.
Die Hand noch am Türgriff,
spürst du, wie’s dich überläuft.
Und du sträubst dich
mit Haut und mit Haaren.
Was ist es? Was ist es?
Die Lampe leuchtet auf:
ein Zimmer voller Dinge.
Chinesien
Landschaften aus Mürbeteig,
Schmutzflüsse, Sanddünen
und das flackrige Bordlicht
von Transportkabinen.
In Chinesien geht die Sonne früh auf,
riesig und gleissend wie ein Gong,
über Häuserzeilen aus gelbem Papier.
Die gutgenährten Chineser haben
eine genau bemessene Zahnlücke:
damit der Reis gut hindurchflutscht.
Heuschrecken auf Sumpfzypresse
gelten als Delikatesse.
Es ist ein alter Brauch, dass sich
die Chineserinnen im Jahr des Hundes
singend die Achselhaare zöpfeln.
Wenn die gebildeten Chineser
in eine poetische Stimmung kommen,
nehmen sie ihre Tuschepinsel hervor
und malen alles ab: vor allem
die mondbeschienenen Teiche.
Nicht unerwähnt lassen
darf man die grosse Mauer.
Mit Preis und Dank bedacht
seien die weitblickenden Erbauer.
Die Chineser spucken einander
zur Begrüssung auf den Kopf.
Zum Abschied winken sie wie wir.
Kehrt man nach langer Abwesenheit
aus Chinesien zurück, muss man,
um wieder heimisch zu werden,
die Schonbezüge seiner Wohnung
unverzüglich an die frische Luft hängen.

Texte: März - Mai 2015
Bilder: 2001-2005, Mixed Media, Öl, Acryl
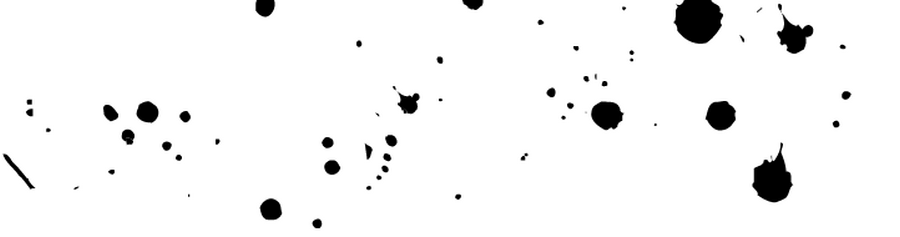 wörter
worte
wörter
worte