Das Hofpropädeutikum
Bochsler und ich steigen aus der königlichen Kutsche. Es ist Morgen, ein frischer Wind fegt um die Schlossgiebel und bringt die Turmfahnen zum Knattern. Ein Herold tritt auf uns zu. Er verliest das königliche Empfangsschreiben, macht eine tiefe Verbeugung und fordert uns auf, ihm zu folgen. Im Thronsaal, wenige Minuten später, finden wir uns von hohen Ministern umringt. Sie instruieren uns flüsternd. Bald darauf schmettert eine Fanfare, und herein tritt der König.
In einer schlichten, aber würdevollen Zeremonie überträgt uns der König das Amt, für das wir uns beworben haben. Unter Tausenden sind wir ausgewählt worden. Es geht um die fachliche Erziehung der Prinzessin, das sogenannte Hofpropädeutikum. Bald schon soll es auf der Tagesordnung stehen, allfällige Erziehungslücken müssen geschlossen, Unebenheiten im Wesen der Kronprätendentin begradigt werden. Die Prinzessin hat eine grosse Zukunft vor sich, weshalb es unerlässlich ist, sie mit den höheren Pflichten ihres Standes vertraut zu machen. Bochsler und ich nehmen das in die Hand. Wir legen vor dem König einen Eid ab, sprechen irgendeine Formel nach, die wohl aus der Zeit Karl des Kahlen stammt. Der König wippt in seinen Schnallenschuhen vor und zurück. Lächelnd zwirbelt er seinen ergrauten Spitzbart. Seine siebzehnjährige Tochter Feodosia ist seine einzige Tochter. Deshalb ist sie seine Lieblingstochter. Er möchte, dass wir sie behutsam und umsichtig an die Prinzipien der royalistischen Gesinnung heranführen. Wird uns das gelingen? Und wenn nicht? Werden wir dann geköpft? Wir sind etwas nervös. Wir stehen stramm, während der König sich bei uns bedankt. Er ist müde und alt, und seine Frau, die Königsgemahlin, ist nicht da. Sie reist durch die halbe Weltgeschichte, um für die afrikanischen Slumkinder Spenden zu sammeln.
Dass wir es zu etwas gebracht haben, darf man uns ansehen. Wir bekommen ein Abzeichen mit den königlichen Insignien, dazu einen speziellen Talar, wie ihn sonst nur Ehrendoktoren tragen. Ein saftiges Gehalt wird uns in Aussicht gestellt, eine Vorauszahlung bekommen wir in Form von Goldmünzen, dazu ein Generalabonnement für den königlichen Kutschendienst. In Nullkommanichts sind Bochsler und ich, zwei unbedeutende Provinzlehrer, die bis vor kurzem noch Bohnen und Erbsen gezogen haben, um nicht hungern zu müssen, zu höchsten Ehren aufgestiegen. Obwohl wir in unserm Amt noch keinen Finger gekrümmt haben, behandelt man uns bereits wie altgediente Minister. Wo wir auch hinkommen, öffnen sich Türen, Höflinge grüssen uns höflich, ja sogar ehrerbietig, Diener knicksen, Soldaten salutieren, und mehrmals täglich erhalten wir Gelegenheit, mit einem Edelfräulein am Arm durch den Schlossgarten zu spazieren.
Selbstverständlich ist die Schlossküche exquisit, und an kulturellen Genüssen fehlt es auch nicht. Lesungen und Konzerte versetzen uns in andächtige Konzentration. Ballette und Opern betören uns mit opulenten Darbietungen. Mit Bochsler verstehe ich mich gut. Wir stammen beide aus der Provinz, aus der schäbigsten und miefigsten Gegend des Königreichs, und beide sind wir Lehrer. Das ist aber auch schon alles, was wir gemeinsam haben. Bochsler ist in allem viel gründlicher als ich, viel ordentlicher, er liebt die Systematik, seine Betätigungsfelder sind ausmessbar und schön quadratisch. Was nicht in diese Ordnung hineinpasst, hält er für belanglos und dumm. Sein Sternzeichen ist Stier. Er nimmt sich sehr viel Zeit für die Vorbereitung, stellt Lehrpläne auf, über die ich nur den Kopf schütteln kann. Die Realität, erkläre ich Bochsler, wird von deinen Plänen abweichen. Sie wird dir einen Strich durch die Rechnung machen. - Dann liegt die Realität eindeutig falsch, erwidert Bochsler ungerührt. Obwohl ich mich gegen diese Logik sträube, muss ich sie wohl oder übel akzeptieren. Weil sie logisch ist. Und weil Bochsler nicht nur ein logischer Kopf ist, sondern auch ein Mensch, der sich gerne mit den sogenannt schönen Dingen abgibt. Wenn einer das Einmaleins oder das Bruchrechnen beherrscht, ist das noch nichts. Aber wenn einer die trockenen und dürren Zahlen als Äpfel und Birnen imaginiert, bekommt die Rechnerei auf einmal ein ganz anderes Gewicht. Sie wird darstellbar und macht Lust, macht Laune, die Äpfel und Birnen lassen sich in kleine und kleinste Teile zerschneiden, in sogenannte Äpfel- und Birnenschnitze. Was nichts anderes als Bruchrechnen ist. Wenn nun diese Äpfel- und Birnenschnitze gedörrt werden, so hat man wieder etwas Trockenes und Dürres, allerdings ist das nun himmelweit von dem entfernt, was man üblicherweise mit Rechnen verbindet, die Schnitze sind keine Zahlen mehr, sondern etwas, das man riechen und essen kann, etwas Sinnliches. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, pflegt Bochsler zu sagen, er lebt auch vom Aufstrich. Bochslers Ordnungsmanie verbindet sich mit einem ausgeprägten Sinn für Sinnliches. Auf die Kraft der Imagination hält er grosse Stücke. Bochsler ist ein Kulturmensch, der nichts anbrennen lässt: kein Konzert, keine Lesung, keine Ausstellung. Er kennt alle Mittel und Formate, die in der Kultur gebräuchlich sind, er kennt auch viele Namen, kann endlos Dichter, Maler und Musiker aufzählen und ganz genau angeben, wer nun was und warum gemacht hat - und warum gerade so und nicht anders. Hier im Schloss findet Bochsler eine Kulturfülle wie nirgends sonst. Das Schloss ist ein Hauptfutterplatz für alle Kulturbeflissenen.
Freilich hat das auch seine Schattenseiten. Auf die kulturellen Genüsse reagiert Bochsler mit einer Art Fieber. Er schwankt zwischen Überreiztheit und Apathie, scheint kaum noch aufnahmefähig. In der königlichen Gemäldegalerie fällt mir auf, dass er beim Anblick eines Stillebens kreidebleich wird, er ringt nach Atem, verdreht die Augen. Später betupft er seine Stirn mit einem Taschentuch. Kunst, erklärt Bochsler, bedeutet mir viel. Aber ich muss aufpassen, dass sie mich nicht umbringt.... Nein, ich scherze nicht. Ich habe eine seltene und sehr gefährliche Krankheit: das sogenannte Stendhal-Syndrom. Ich gerate ausser mir, wenn ich etwas Schönes sehe. Ich hyperventiliere, zittere wie Espenlaub. Schaue ich dann nicht schleunigst woandershin, springe ich noch an die Decke oder stürze mich auf ein Edelfräulein... Das Stendhal-Syndrom ist kaum heilbar, man kann es höchstens eindämmen. Mein Psychiater hat mir den Kunstgenuss verboten. Vorbeugend, wie er sagt. Natürlich setze ich mich darüber hinweg. Ein Leben ohne Kunst scheint mir sinnlos. Ich denke, mit der Zuträglichkeit von Kunst ist es wie mit der Verrücktheit, besser gesagt: mit der Originalität. Es ist eine Frage der Dosierung....
Seine Krankheit ist ein Leiden am ästhetischen Genuss. Hier, in diesem Genuss, ist er gross oder fühlt sich gross und weiss doch, dass es eine Schwäche ist, eine Krankheit. Seine Kunstneigung ist stärker als die medizinische Vernunft. Von ihr kann er sich lösen, von der Kunstneigung nicht. Aber im Grunde sucht er den Kompromiss. Er nimmt Tabletten, hauptsächlich Valium, Veronal und Propofol, und nach wie vor geht er zu seinem Psychiater in der wohlbegründeten Annahme, der psychosomatische Knorz lasse sich wegtherapieren. Tatsächlich, die Behandlung schlägt an, wenn auch stockend und mit gelegentlichen Zusammenbrüchen, kein Fortschritt ohne Rückschritt. Seine gegenwärtige Lebenssituation, die ja besser nicht sein könnte, ermutigt ihn sehr. Seit ich hier bin, sagt er, sind die Dinge für mich recht gut gelaufen. Die kleinen Rückschläge kann ich verkraften. Kunst ja, aber massvoll und gemütlich, alles im richtigen Rahmen. Wie gesagt, eine Frage der Dosierung.
In Begleitung ihrer ältlichen und etwas buckligen Amme begrüsst uns Prinzessin Feodosia mit einem Knicks. Bochsler und ich verbeugen uns tief, dann küssen wir die zarte, weiche, kleine Hand. Verehrteste Prinzessin, sagt Bochsler, erlauben Sie uns, dass wir Ihro Gnaden in das Hofpropädeutikum einführen. Die Prinzessin lächelt verschämt, während die Amme ihre Augenbrauen hochzieht. Bochsler zieht ebenfalls die Augenbrauen hoch. Die beiden mustern sich kühl. Die Amme weiss Bescheid. Sie rafft die Röcke, mit einem beleidigten Grummeln entfernt sie sich, ihre Zeit ist um, sie ist entlassen. Kaum ist sie fort, nimmt Feodosia einen völlig anderen Gesichtsausdruck an. Hinter ihren Augen lauert ein Wiesel mit ausgefahrenen Krallen. Ihr dürft du zu mir sagen, sagt sie, nur keine Förmlichkeit, ich kann das Gesülze nämlich nicht ausstehen. Bochsler und ich, wir sind doch etwas erstaunt. Wir glauben nicht richtig gehört zu haben. Die Amme, Fräulein Birnbrot, hat man aus dem Milieu der Steinbrucharbeiter geholt, was der Erziehung Feodosias bestimmt nicht förderlich gewesen ist. Es unterliegt nicht dem geringsten Zweifel, dass Feodosia von der königlichen Gediegenheit des Äusserlichen und Innerlichen noch weit entfernt ist. Zum Beispiel malt sie sich die Lippen und kaut Kaugummi. Und wenn sie eine Wut hat, flucht sie wie die Müllabfuhr. Davon bekommen wir eine Kostprobe, als ihr Bochsler versehentlich auf den Fuss tritt. Scheissdepp, zischt sie, pass doch auf. Bochsler nimmt es gelassen. Es ist wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass ihn eine Frau “Scheissdepp” nennt. Aber bestimmt ist es das erste Mal, dass ihn eine Prinzessin “Scheissdepp” nennt. Darauf ist er vielleicht sogar ein bisschen stolz; und überhaupt, ganz so untröstlich, wie er aussieht, ist dieser Mensch auch in seinen schwärzesten Stunden nicht. In ihm brennt ein nie verlöschendes Licht, ich glaube, es ist ein Herzenslicht. Es besteht aus Güte und Verständnis. Nun, sagt Bochsler, dann wollen wir mal.
Die erste Lektion beinhaltet alles, was das sichere Auftreten einer Prinzessin ausmacht: vom Umgang mit unverzichtbaren Accessoires bis hin zum multioptionalen Handlungsspielraum unter günstigen und ungünstigen Bedingungen. Als Prinzessin wirkt Feodosia noch unglaubwürdig. Mit den Zähnen zupft sie an ihren gehäkelten Handschuhen, und ihren Kopf beschattet ein Sonnenschirmchen, dessen Griff sie sich in die Achselhöhle geklemmt hat. Doch wie sie es auch anstellt, sie hat Mühe damit, das Schirmchen droht herunterzufallen, und die Handschuhe lösen sich nicht von den Händen, so sehr sie auch zieht und zupft. Sie ist überfordert, der multioptionale Handlungszwang bringt sie gehörig ins Schwitzen. Sie keucht durch die Nase. Bochsler gibt Anweisungen, detailliert den Ablauf, korrigiert Fehler und streut auch hin und wieder ein Lob ein. Seine Geduld bürgt dafür, dass Feodosia trotz allem Fortschritte macht. Mit ihrer eigenen Geduld ist es allerdings noch nicht so weit her, daran muss sie noch arbeiten. Während sie sich mit einem Fächer Luft zufächelt, nimmt sie mit der freien Hand den Griff des Sonnenschirmchen aus der Achselhöhle und macht sich erneut mit den Zähnen an den Handschuhen zu schaffen. Dieser Anblick ist nicht gerade erbaulich, eher erbärmlich, aber darum geht es ja nicht. Bochsler hat da so seine Prinzipien. Er besteht darauf, dass Feodosia möglichst viele Dinge gleichzeitig tut. Der Fächer steigert die Schwierigkeit. Er dient zu nichts anderem. Eine Prinzessin muss ihn in jeder nur denkbaren Situation auf- und zuklappen können, und auch das Fächeln muss sie tadellos im Griff haben. Hier draussen im Schlossgarten, wo es sehr stark windet, gestaltet sich das Fächeln nicht eben einfach. Das Schirmchen stülpt sich klackend um, Feodosia stolpert und fängt sich auf. Sie macht weiter. Es ist gutes Wetter für solche Übungen. Sonne mit Westwind. Ich setze mich ins Gras. Bochsler blickt zufrieden zu den knatternden Turmfahnen hoch.
Seit Anfang Woche nehme ich mit Feodosia die Liebe durch. Mir fällt dabei die Rolle des Hofmachers zu. Eine nicht ganz unriskante Rolle. Denn Feodosia hat schon beträchtliche Fortschritte gemacht. Sie ist keine Anfängerin mehr. Sie weiss, wie es funktioniert. Sie gibt sich unnahbar. Sie ist eine Frau von Stand, eine Frau, an der man abrutscht. Man muss sie in Ruhe lassen. Es hat keinen Zweck, etwas von ihr zu wollen, kniefällig zu werden, lächerlich. Man muss ihr das Vorrecht des ersten Schrittes einräumen, den sie natürlich niemals tun wird, nicht in hundert Jahren. Sie rümpft die Nase, auf ihrem Mund bildet sich ein winzigkleines Spuckebläschen. Ich warte darauf, dass es zerplatzt. Aber dann kehrt sie sich von mir ab, gleichgültig, mit dieser hohheitsvollen Art, die nur einer Königin zusteht. Oder einer Prinzessin. Sie neigt sich über die Zimmerblumen. Das ist rührend. Das sieht richtig gut aus, das sieht aus, als krümme sich ein Kirchturm mit schwingenden Glocken in seinen schrumpfenden Schatten hinein. Sie riecht an den Blütenkelchen, zupft die Staubfäden aus, richtet sich auf und verdeckt die Sonne, die schräg ins Zimmer hineinleuchtet. Wie immer, wenn ich bei Feodosia bin, um sie in Liebesdingen zu unterrichten, macht sie Anstalten, mich hinauszuwerfen. Dass ich ihr eventuell einen Antrag machen könnte, behagt ihr nicht; noch immer ist sie überzeugt davon, ich wolle ihr den Hof machen, mich an sie heranmachen. In meiner sorgsam zurückgedämmten Verliebtheit bin ich für sie eine Bedrohung. Da ich die ganze Zeit über so erwartungsvoll dastehe, die Hände hinter dem Rücken, als hätte ich die Absicht, einen Rosenstrauss zu zücken, glaubt sie, ich hätte wirklich und wahrhaftig eine diesbezügliche Absicht und weist mir die Tür. Verschwinde, sagt sie, sonst passiert hier noch was. Ich rühre mich nicht von der Stelle. Ich weiss, ich bin unschuldig. Ich habe keine Absicht, ich stehe nur da und denke: muss das wirklich sein? Sie entspannt sich, weil ich nicht fortgehe. Sie hat es ja irgendwie gehofft, und jetzt ist sie beruhigt. Sie merkt nun selber, dass sie mich zu Unrecht verdächtigt hat. Sie bereut es. Ich habe nicht die leiseste Absicht in irgendeine Richtung. Ich starre gegen die Wand, dann zum Fenster hinaus, mein Blick ist ziellos, und ich weiss: sie hat die Liebeslektion gelernt. Ja, das hat sie. Dass ich sie besiegt habe, sie als Frau, das hat sie innerlich geknickt.
Mitleid wäre unangebracht. Eine Prinzessin muss stark sein, ein gewisses Quantum Liebesschmerz muss sie verkraften können. Feodosia hat es ja sonst recht gut. Man flatiert und hofiert ihr nach Strich und Faden, sie wird auf Händen getragen. Bei uns, den Erziehungsbevollmächtigten des königlichen Schlosses, ist sie jedenfalls in guten Händen. Bochsler und ich müssen ihr nun beibringen, wie sie es anstellen soll, in Ohnmacht zu sinken, ohne sich eine Blösse zu geben. Es genügt nicht, einfach nur die Schraube zu machen. Das ziemt sich für eine Prinzessin nicht. Eine Prinzessin macht nicht die Schraube, eine Prinzessin fällt oder sinkt in Ohnmacht, und auch das ist noch unwürdig ausgedrückt. Wie ein Zweimaster mit schönen geblähten Segeln sinkt sie in die Tiefe einer grünlichblauen Bewusstlosigkeit. Der Fächer entgleitet ihr, klappt seufzend zusammen. Eine Prinzessin, die umfällt, fällt weich, der Boden hat Erbarmen mit ihr. Er lässt sich erweichen. Sowie ihn eine zarte Schulter berührt, verwandelt er sich in ein Bett, das den Ohnmachtsanfall auffängt oder abfedert. Von alleine geschieht das natürlich nicht, das weiche Hinfallen wird ja nicht vom Boden bewirkt, sondern von der Hinfallenden selbst. Macht sie beim Hinfallen eine gute Figur, ist die halbe Arbeit schon getan. Das Schöne ist weich, das Hässliche hart. Der Rest hat mit der Beinstellung zu tun. Bochsler und ich, zwei berufene Könner des Ohnmächtigwerdens, machen es ihr vor. Wechselweise fallen wir in Ohnmacht. Mit einem verdrehten Bein, den Oberkörper abgewinkelt, eine Hand zur Wange erhoben, sinken wir ganz leicht und glatt zu Boden. Kein unpassendes Knallen, kein Stöhnen und Ächzen. Feodosia ist begeistert. Sie möchte es sofort ausprobieren. Auf dem Parkettboden des Lesekabinetts fällt sie gleich beim ersten Versuch in Ohnmacht wie eine richtige Prinzessin. Nachdem wir sie mit Riechsalz zurück ins Leben geholt haben, rappelt sie sich hoch und sagt: woah, geil.
Die nächste Lektion ist dem sprachlichen Ausdruck gewidmet. Feodosia sitzt auf einem Stuhl. Ich mache Frontalunterricht. Ich stehe hinter meinem Stehpult, mein Talar raschelt, als ich mit Schwung zu dozieren beginne. Mich deucht, sage ich, du hast immer noch den Slang deines Kindermädchens. Fürwahr, du redest zu proletarisch. Daran müssen wir jetzt arbeiten. Es gilt, den mündlichen Ausdruck zu verfeinern, ihn hoffähig zu machen. Eine Prinzessin sagt nicht Sülze, sie sagt Gelatine. Also, sprich mir nach: Gelatine.
Sülze, sagt Feodosia.
Nach diesem kleinen Sprachtraining bearbeiten wir einen Punkt, der in Adelskreisen als besonders heikel gilt. Auf dem Boden der Wandelhalle hat Bochsler eine Menge Schnittmuster ausgelegt, Kohlezeichnungen, die in etwa zeigen, was eine Adlige zu tragen hat, wenn sie à la mode sein will. Mit der Mode zu gehen, ist für eine Prinzessin, die sich ja stets ein bisschen abheben muss, eine delikate Herausforderung. Sie muss auffallen, ohne anzuecken. Bis jetzt hat Feodosia nur die allergebräuchlichsten höfischen Kleider getragen, mehr oder minder ausgehfeines Zeug von der Stange. Bochsler und ich sind uns einig: Feodosia soll sich neu erfinden, als Frau, als feminine Erscheinung, ein Umdenken ist hier schon lange überfällig. Ohne Extravanz geht es nicht. Wobei sich gerade hier - als Gegengewicht sozusagen - eine gut durchdachte geschmackliche Ausgewogenheit fühlbar machen muss. Die Bekleidungsfrage, sagt Bochsler, erfordert grosses Fingerspitzengefühl. Damit hält er den Finger auf die heikle Stelle. Die Bekleidungsfrage hat schon manche Schönheit zu Fall gebracht. Als Feodosia die vielen Schnittmuster sieht, bedeckt sie ihren Mund mit einer schlaff erhobenen Hand. Unmöglich zu sagen, ob sie gähnt oder nur ratlos ist. Bochsler verbeugt sich. Gnädigste Feodosia, sagt er, darf ich dir die brandaktuelle Frühsommerkollektion vorstellen? Man ist ja wieder einmal aufs Prächtigste französisch angetan, nicht wahr? Diese opulente Robe à la française mit abnehmbaren Überärmeln macht sich sehr gut zu einem stufig geschnittenen Rock aus Lyoner Feinseide. Der Innenrock ist übrigens aus Jacquard, der Aussenrock wurde von Fragonard entworfen, einem Brüsseler Modedesigner, der nebenher auch Hundekleider fabriziert, seine Spezialität ist die Hüfte. Die Art, wie er sie mit seinen Kreationen umschmeichelt, ist schon fast genial, die gemässigte Taillenbetonung wirkt ausserordentlich grazil, um nicht zu sagen graziös, und die Ranken, Schleifen, Falben, Spitzenborten, Schärpen und Kunstblumen vermehren sich ganz selbstständig, sobald sich die Stoffstufen beim Gehen verschieben. Könnte zuviel des Guten sein, aber da wollen wir mal ein Auge zudrücken. Wenn’s denn weniger Stoff sein soll, schlage ich was Schulterfreies vor. Die modebewusste Prinzessin darf auch Schulter zeigen, sie darf ein bisschen pikant sein, sozusagen im Rückgriff auf die Nacktheit der im Pleistozän als Beerenpflückerinnen auftretenden Urmenschenweibchen die Schultern frei machen, damit man sieht, was Gott gemeint hat, als er Frau gesagt hat. Wenn wir nun Frau sagen, meinen wir selbstverständlich auch Mode. In Brüssel gibt es Kleider, die man “Teufelsfenster” nennt, ein irreführender Begriff, sehr einseitig, denn schliesslich ist Mode recht eigentlich das passende Mittel, um einen gerade noch zulässigen Ausschnitt dessen zu zeigen, was nicht gezeigt werden darf, und eben darin erweist sich die Mode als ein unverzichtbares Instrument der Sittlichkeit. Hier fallen Gott und Teufel in eins, sie verbrüdern sich in Schönheit und Harmonie. Aber gehen wir weiter. Die diesjährige Frühsommerkollektion ist, wie ich meine, nicht unmassgeblich von Rousseau beeinflusst. Zurück zur Natur! In dieses Oberkleid ist eine Schürze für Schäferspiele eingenäht, sehr sinnreich, und in dem mit Baumwoll-Mousseline gefütterten Cul de Paris befindet sich eine Wärmflasche mit einem Stutzen, in den man das warme Wasser einfüllen kann, wenn man die Absicht hat, im frischen Frühsommerwind einen Gartenspaziergang zu machen. Die calvinistische Ausführung ohne Spitzenvolants eignet sich übrigens hervorragend für die Fastenzeit, passend dazu gibt es eine Gucci-Tasche für das Gebetbuch...
Bochsler redet und redet, während Feodosia mit den Füssen in den Schnittmustern herumstöbert. Sie wirkt gelangweilt, unschlüssig. Hin und wieder bückt sie sich, um einen Bogen im Detail zu betrachten. Mit leicht gekrümmten Händen verstreicht sie die Kohle, Fingerspitzen und Handballen sind schon ganz schwarz. Von der Theorie zur Praxis, sagt Bochsler, der Mensch besteht zu neunzig Prozent aus Wasser. Der Rest ist Kleidung. Du kannst dir denken, was das heisst, Feodosia. Auf dem Wasser unseres Körpers segeln wir dahin. Dafür brauchen wir die Textilien. Ohne sie wären wir nichts als Körper, eine Wasserwüste. Ich würde vorschlagen, du suchst dir übungshalber eine passende Abendgarderobe aus. Die Wahl überlasse ich dir. Beim nächsten Festbankett wirst du ganz nach deinem Ermessen als Vogelscheuche oder als Prinzessin auftreten können. Wähle also mit Bedacht. Geschmackvoll sind die Kleider ja alle, aber die Frage ist, ob sie dir auch alle stehen? Man schult jedenfalls seinen Geschmack, wenn man sich seine Aufmachung selber zusammenstellt, die Farben, Formen und Schnitte klüglich gegeneinander abwägt: da geht es ums Ganze. Wenn du eine Prinzessin sein willst, musst du dich auch wie eine Prinzessin herausbretzeln. Wenn du die Schönste sein willst, und wohlgemerkt, die Prinzessin ist immer die Schönste, dann musst du deine Kleider dem härtesten Geschmacksurteil unterwerfen, das überhaupt möglich ist.
Endlich, der grosse Tag ist da. Vor dem Gemach der Prinzessin haben wir Stellung bezogen. Die Tür ist verschlossen. Unter keinen Umständen darf jetzt jemand stören. Die Prinzessin kleidet sich um. Der königliche Hofschneider hat ihr die neuen Kleider gebracht, Prachtskleider, wie Bochsler betont. Heute Abend soll Feodosia ihren grossen Auftritt haben. Zur Feier des bestandenen Hofpropädeutikums lässt der König ein Frühsommerbankett ausrichten. Feodosia hat sämtliche Prüfungen bestanden. Sie ist nun eine wirkliche Prinzessin. Nur ungern denken Bochsler und ich an die Zeit zurück, als es Feodosia noch an Schliff und Eleganz gefehlt hat. Diese Zeit ist glücklicherweise vorbei. Feodosia ist zu einer würdigen Königstochter herangereift. Zumindest möchten wir das glauben. Der letzte Beweis fehlt noch. Wir sind gespannt: aus dem Kokon sollte nun endlich der Schmetterling schlüpfen. Vor der verschlossenen Tür gehen wir auf und ab, die Hände hinter dem Rücken. Unsere Schritte hallen durch den Gang. Wir sind nervös. Aus dem Innenhof des Schlosses hören wir Stimmen. Die Tafel wird gedeckt, die Diener eilen geschäftig umher. Der Tag ist bewölkt gewesen, gegen Abend hat es abgekühlt, ums Schloss pfeift der Wind wie ein rückwärts spielendes Flötenorchester. Die Nacht naht heran. Und während wir noch warten, springt plötzlich die Tür auf und Feodosia huscht wie ein Wirbelwind an uns vorüber. Huuu! macht sie. Sie hat sich ein Bettlaken umgetan. Sie rennt den Gang hinunter, macht eine übermütige Pirouette und trippelt barfuss zu uns zurück. Bochsler stellt sie zur Rede. Schon gut, sagt sie, war nur Spass. Ich werde mich zusammenreissen. Ich werde allen zeigen, dass ich eine würdige Prinzessin bin... Mit diesen Worten schlüpft sie wieder in ihr Gemach. Nachdem sie die Türkette vorgehängt hat, hören wir sie am Kleiderschrank hantieren. Bochsler und ich lauschen an der Tür. Dann wird uns die Warterei zu bunt. Wir gehen nach unten, hier ist es hell, die Kronleuchter strahlen wie Weihnachtsbäume. Der König sitzt mit seinen Ministern und der ganzen royalen Grossfamilie an der Tafel, die sich biegt unter dem Gewicht der Kaldaunen, Wildschweinpasteten, Ochsenhodenpuddings und Weinkaraffen. Eingezwängt sitzen wir in unseren Essstühlen. Noch fehlt Feodisia, aber das Festbankett ist vom König eröffnet worden. Jeder darf zulangen und sich den Bauch vollschlagen. Was sich Bochsler nicht zweimal sagen lässt. Bochsler hat Hunger. Ist ein wirklich anstrengender Tag gewesen, meint er, da hat man Kohldampf. Er nimmt die Gabel, sticht sie in ein Brötchen, energisch zieht er das Brötchen zum Mund, der ein bisschen erkältet ist, wie auch die Nase. Aus der Nase tropft es in die Suppe, was Bochsler keineswegs daran hindert, seiner Fresslust die Zügel schiessen zu lassen. Das Brötchen zerreisst er mit den Zähnen, es ist zäh. Hnnng, hnnng, macht Bochsler. Man merkt nun wirklich, dass Bochsler von auswärts kommt, aus der Provinz. Die gepflegte Esskultur ist bei ihm nicht angeboren. Da geht die Tür auf, und es ist ein Wunder, dass nicht auf der Stelle alle Anwesenden zu Stein erstarren. Feodosia kommt völlig verwandelt an den Tisch. Wie ein junges, überirdisch strahlendes Abbild ihrer Mutter sieht sie aus, eigentümlich in die Höhe geschossen ist sie, der ganze Körper satt eingeschnürt, nur an wenigen Stellen quillt das Fleisch hervor. Sie trägt ein sechsteiliges Kleid mit Hermelinbesatz, Ärmelspitzen aus Fen, und auf dem Kopf türmt sich eine komplizierte Kesselhaube. Feodosia ist wie von Strahlen umgeben, wie von glänzendem Raureif überzogen. Das Hofpropädeutikum zeitigt hier vielleicht doch die erhoffte Wirkung: Feodosia scheint sich auf die Grundsätze ihres Stammbaums besonnen zu haben. Sachte, als trüge sie in ihrem geschnürten Busen einen Schrank mit hochzerbrechlichen Porzellantässchen, setzt sich sich ans Stirnende der Tafel. Bevor sie ihrem Vater, dem König, zunicken und die vorgeschriebene Begrüssungsformel aufsagen kann, muss sie die Kleiderpracht ein wenig in Ordnung bringen. Zärtlich zupft sie an den Stoffwülsten herum, die sich da und dort kuglig zusammenbauschen und wie Katzenbuckel herausstehen. Sie lächelt verlegen. Man begafft sie aus einem ungeheuren Abstand, wie durch ein Teleskop: ihre Präsenz ist schamlos, unmässig und unangemessen. Selbst Bochsler, der Vielredner und Ober-Referent, ist auf einmal wie mit Stummheit geschlagen, sein Karpfenmaul steht offen, und die Suppe in unseren Tellern bekommt ein Häutchen, weil wir nicht mehr umrühren. Bochsler dreht den Kopf zu mir herüber, sein Blick heftet sich an mir fest. Ich ahne, was kommt. Bochsler verdreht die Augen bis zu einem Punkt, wo man fast nur noch das blanke Weiss der Augäpfel sieht, seine Arme hängen herab, er windet sich auf seinem Stuhl, stöhnt und sabbert. Ah, denke ich, jetzt geht es los. Ich spüre einen Ruck, dann noch einen: Bochsler zerrt am Tischtuch, sein Stuhl kippt nach hinten und bleibt wacklig auf den Hinterbeinen stehen, weil das Tischtuch nur langsam und ruckweise nachgibt. Dabei grölt er ein unanständiges Lied aus dem Milieu der Steinbrucharbeiter. Er scheint es darauf abzusehen, Feodosia die Schamröte ins Gesicht zu treiben und mich als denjenigen hier am Tisch zurückzulassen, der die Scherben auflesen muss. In aller Kürze versuche ich Feodosia zu erklären, warum Bochsler nicht ganz normal ist. Aber ich hole weiter aus. Irgendwie muss ich ihr begreiflich machen, dass Bochsler sehr deutlich von der gemeinsamen Linie abweicht und sich, auch zu meiner eigenen Schande, dem Niveau dieses Tisches gegenüber als unfähig erweist. Ich distanziere mich von Bochsler, indem ich die Verantwortung für ihn übernehme, ein Trick, der zu meiner Verwunderung einwandfrei funktioniert. Ist sein Verhalten psychologisch bedingt? fragt mich Feodosia mit grossen Augen. Ich nicke heftig, während Bochsler, der wie ein Verrückter um sich schlägt,von zwei Dienern abgeschleppt wird. Du Sau! schreit er. Sein Verhalten ist abscheulich, sage ich, unter jedem Hund. Manchmal wirft er sich mit dem Gesicht in eine Schlammpfütze, kein Patschloch oder Fettnäpfchen ist vor ihm sicher. Ihm fehlt jemand, der mässigend auf ihn einwirkt. Man sollte ihn unter Kuratel stellen, die erzieherische Fuchtel täte ihm gut. Übrigens, wenn ich hier noch eine kleine Korrektur anbringen darf, werteste Feodosia, es heisst: psychisch bedingt, nicht psychologisch bedingt.
Dadurch, dass ich die Verantwortung für Bochsler übernommen habe, bin ich selbst einigermassen gut weggekommen. Ich habe die Situation gerettet. Nicht aber Bochsler. Bochsler ist verloren. In der königlichen Rechtssprechung wird die Schuldfrage kurzerhand übers Knie gebrochen: über Schuld oder Schuldlosigkeit entscheidet das Verursacherprinzip. Noch an diesem Abend soll Bochsler dem Scharfrichter übergeben werden. Er soll geköpft werden, nicht der Scharfrichter, sondern Bochsler, und zwar mit dem Richtschwert. Der Scharfrichter, im Zivilleben wahrscheinlich Mitglied der Schulaufsichtsbehörde und Kirchenratspräsident, soll an Bochsler die Hinrichtung vollziehen wegen Majestätsbeleidigung und ungebührlichen Betragens bei Tisch. In der öffentlichen Urteilsverkündung heisst es, Bochsler habe die von Gott gesetzte Ordnung und Obrigkeit verhöhnt und müsse nun auf dem Richtblock zur Reue geführt werden, auf dass die sündige Seele errettet werde. Es ist klar, dass ich mir dieses Schauspiel auf keinen Fall entgehen lassen will. Feodosia begleitet mich. Sie ist etwas bedrückt. Für sie ist Bochsler schon geköpft, dabei findet die Hinrichtung erst in einer Stunde statt. Zuerst muss noch das Schwert geschärft werden. Wie es scheint, hat sie Bochsler irgendwie gemocht. Begreife jemand die Frauen, ihre Gefühle sind ein Rätsel. Als wir gemeinsam zum Richtplatz schlendern, erkläre ich Feodosia, warum Bochsler die Strafe verdient hat. Ich finde so viele Gründe, dass ich sogar selber staune. Schade, sage ich zu Feodosia, dass Bochsler nur einen Kopf hat.
Ja, Feodosia ist eine Prinzessin. An nichts sieht man das so deutlich wie an ihrem Zimmer, das natürlich kein Zimmer ist, sondern ein Gemach. Das Schönste an ihrem Gemach sind die Vorhänge, die die Flügeltüren des Balkons verschleiern. Die Vorhänge sind aus einem fernen Land importiert, aus China, das könnte sein, oder aus Qualalumpur. In ihnen sind die feinsten Garne zu einem spinnwebzarten, aber reissfesten Material verarbeitet. Samtvorhänge sind Feodosia zu schwer, Spitzenvorhänge erinnern sie unangenehm an den Handarbeitsunterricht, und die buntbedruckten Kattunvorhänge, die die Altweiberzimmer verdunkeln, verabscheut sie erst recht. Feodosia hat Geschmack, wenn auch keinen guten, und sie setzt ihn stets und überall an vorderster Stelle durch. Dort, wo man hinschaut, ohne es zu wollen. Zum Beispiel auch dort, wo eine Modesünde derart gut aufgehoben ist, dass sie fast schon verschwindet: am weiblichen Körper. Feodosia trägt ein Kleid aus Chiffon und Seide, und das Kleid ist so lang, wie es sein muss, um herabfallend den Boden zu berühren. Das Kleid ist also auch ein Besen, und wenn da irgendwas in Fussnähe raschelt, dann sind es die vielen Papierchen, die sich unter dem nachschleifenden Stoff angesammelt haben. Vorne ist ein gutes Stück Haut zu sehen, der Brustausschnitt betont die zerbrechlichen Schlüsselbeinknochen. Aber der eigentliche Blickfang ist der Hals. Ich glaube, dass eine Beschreibung dieses Halses ohne weiteres auf die Feststellung hinauslaufen könnte, dass das kein Hals ist, sondern ein Destillierkolben. Darin schluckt und gluckt es, und man weiss nie, was oben herauskommt. Jetzt, nach dem Abendessen, hat Feodosia den Schluckauf. Sie hält die Luft an. Das hilft. Sie hat sich umgezogen und frisch gemacht. (Ja, in dieser Reihenfolge. Zuerst die Kleider wechseln, dann ein bisschen Rosenwasser auf die Wangen tupfen). Ich schaue ihr zu, ich darf das jetzt, da ich meines Lehramts enthoben bin. Feodosia hat mich zu ihrem Kämmerer ernannt. Eine neue Aufgabe, eine neue Pflicht. Feodosia lächelt mir zu. Bin ich jetzt nicht eine vorbildliche Prinzessin? fragt sie mich. Doch, das bist du, sage ich. Vor dem Spiegel zupft sie sich eine Franse aus der Stirn. Dabei wird ihr Blick vom Spiegel in den Raum zurückgeworfen und trifft auf ein Tablar, auf dem ein rundlicher Glasbehälter steht. Darin schwimmt ein Kopf, der Feodosias Blick mit weit aufgerissenen Augen erwidert. Das Karpfenmaul steht offen, die Ohrmuscheln sind rot, durchscheinend. Hier hat Bochsler seine letzte Ruhe gefunden. Nicht der ganze Bochsler freilich, sondern nur sein Kopf: ein anatomisches Dekorationsstück. Nun denn, sagt Feodosia, gehn wir ein bisschen spazieren? Sie möchte Abstand gewinnen zur Gesellschaft im Schloss, zu den Zwängen, die sie immer noch einengen. Ich habe mich in mein Schicksal gefügt, sagt sie, aber im tiefsten Innern hasse ich sie alle, den ganzen Luxuspudel-Verein. Jeder stiehlt dem andern die Schau und muss sich doch bücken. Und ich, die Prinzessin, ich bücke mich am tiefsten. Ich bin die Unfreiste von allen. Ich ergebe mich diesem System, weil es in mir drin ist, in meinem Körper, in meinen Genen... So lässt sie sich über den Adel aus, das Geld, die ganze hochstämmige Familie, deren Frucht sie ist, und während sie so daherschimpft, spuckt sie auf den englischen Rasen, der bald schon hinter einer Taxushecke verschwindet. Ich nicke und habe vollstes Verständnis. Draussen fühlt man sich frei, da hat sie recht. Die Sonne scheint, und im frischen Frühsommerwind knattern die Fahnen. Feodosia spaziert sehr anmutig. Ich bin glücklich, dass sie mich dabei haben will. Auf den geharkten Wegen im Schlossgarten begleite ich sie wie ein Galan. Wir gehen langsam, das verbindet uns. Feodosia fängt sich wieder ein, wir reden leise und freundlich. Ich neige mich sanft zu ihr hin. Ich bin die Sanftheit in Person, und Feodosia weiss das zu schätzen. Ja, auf diesem Spaziergang werden wir es miteinander probieren. Auf diesem Spaziergang werden wir alles Unerfreuliche weit hinter uns zurücklassen.
2010
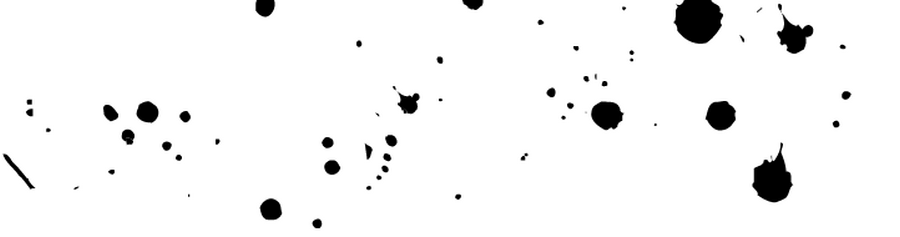 wörter
worte
wörter
worte