Der Maler am Berg
"Was ist Malerei? Man macht den ersten Pinselstrich, und schon ist die Leinwand versaut."
Varlin
Bald ist Silvester, hat Seppli am Telefon gesagt, dann läuten wieder überall die Glocken, und man ist gezwungen, sich mit einem spitzigen Hütchen auf dem Kopf auf das neue Jahr zu freuen. Vielleicht hast du ja noch nichts vor, und es fällt dir ganz spontan ein, mich besuchen zu kommen... Seine Stimme hat geklungen, als spräche er durch eine Mullbinde hindurch. Aber ja, habe ich gesagt - und eigentlich das Gegenteil gedacht. Das ist eine gute Idee, Seppli, habe ich gesagt. Ich werde dich total spontan und unaufgefordert besuchen kommen. Es wird eine tolle Überraschung für dich werden, aus den Schuhen wird es dich hauen, verlass dich drauf, wenn ich unangemeldet an deiner Tür erscheine wie der Weihnachtsmann zu Ostern - und dir ein Überraschungsgeschenk überreiche, zum Beispiel den Brieföffner aus Antilopenhorn, den du dir schon immer gewünscht hast. Silvester bei dir am Berg, wo es, wenn es im Flachland schneit, gleich doppelt schneit, ist durchaus ein Ereignis, das ich unter keinen Umständen verpassen möchte. Ich liebe Schnee, vor allem wenn er sich meterhoch auftürmt und anhäuft, und wenn du dich auch durch niemanden und kein Argument dazu bewegen lässt, deine Bilderproduktion anzukurbeln, so bin ich doch zuversichtlich, dass du in den nächsten Tagen oder Wochen endlich damit anfängst, die Bilder zu malen, die ich auf deiner Staffelei sehen möchte. Wunschdenken? Von mir aus. Ich wünsche mir einiges. Ich wünsche mir zum Beispiel, dass du dich hinter deine Aufgabe klemmst. Du bist Maler, Seppli. Auch deswegen werde ich dich besuchen kommen: um dich an deine Malerei zu erinnern.
Silvester in einem Künstleratelier in Schindboden, denke ich jetzt, während ich im Zug sitze und mit dem Rücken voran durch die Voralpen fahre, das verspricht ein krachendes Ereignis zu werden. Aber eigentlich könnte ich gut darauf verzichten. Meine Freundschaft mit Seppli ist nichts, worauf ich stolz bin, man sucht sich gewisse Freundschaften nicht aus, sie ergeben sich aus irgendwelchen Umständen, für die man nichts kann und die man verflucht wie eine Schulhofkeilerei, der man es zu verdanken hat, dass man noch Jahrzehnte später eine verunstaltete Nase im Spiegel anschauen muss. In einer solchen Freundschaft möchte man dauernd den Hut nehmen und sich aus dem Gesichtskreis des sogenannten Freundes entfernen, doch man klebt fest und kann die Sache nicht beenden, aus Freundschaft eben, denn Freundschaft ist halt so eine Sache. Freundschaft ist ein Fluch. Man kann sich ihr nicht entwinden, auch weil sie ganz offenkundig wenig Anlass dazu bietet. Sie tut einem in der Regel ja nichts. Sie bedeutet eigentlich nichts, verpflichtet zu nichts, lässt einen kalt; die Schwerpunkte des Lebens liegen woanders, und das ist auch der Grund, weshalb man nie wirklich den Entschluss aufbringt, eine Freundschaft zu beenden.
Und dann ist Seppli auch noch Künstler.
Seine Kunst muss sich der Künstler erarbeiten. Das gilt auch für Seppli, für ihn besonders, da er noch ganz am Anfang seines Schaffens steht. Nach einem harzigen Kunsthochschulstudium hat er in seinem Heimatkanton ein Atelierstipendium ergattert, hat nun endlich etwas erreicht, freilich etwas Äusserliches und Ungenügendes. Was ihm dumpf bewusst ist. Dass er sich noch keineswegs in die Riege der hochwertig und produktiv malenden Maler hinaufgearbeitet hat, belastet ihn, obwohl es das gar nicht sollte. Schliesslich haben auch die Grossen mal klein angefangen. Für Seppli ist das kein Trost, geschweige denn ein Ansporn. Er spürt, dass ihm etwas fehlt. Etwas Entscheidendes. Was? Zum Beispiel Fleiss. Zum Beispiel Willenskraft. Eine kantonale Kunstkommission hat ihm Anerkennung gezollt, etwas Unerhörtes ist geschehen, und Seppli, der dann doch nicht auf Beton schlafen möchte, wenn er ein Federbett geschenkt bekommt, hat das Angebot selbstverständlich angenommen. Wie jeden Künstler drängt es auch Seppli an die Öffentlichkeit. Er will ausstellen und einen eigenen Katalog drucken lassen. Die Druckerei hat er sich schon ausgesucht. Die Offerte steht. Gestalten will er den Katalog selber. Er will das selber in die Hand nehmen, hat er doch vor Jahren eine Ausbildung zum Grafiker absolviert. Was ihm jetzt noch fehlt, sind die Bilder. Ja, die Bilder. Über die fehlenden Bilder legt sich Seppli täglich Rechenschaft ab. Es quält ihn, dass sich die Bilder, die er malen möchte, nicht von selber malen. Ich arbeite doch hart, rechtfertigt er sich, die ganze Zeit arbeite ich wie ein Verrückter... Da hat er allerdings unrecht: von überrallher holt er sich seine Beschäftigungen und bündelt sie zu einem Unternehmen, in das er sich immer tiefer und leidenschaftlicher verstrickt. Er macht tausend Sachen und macht doch nichts. So gibt er sich den Anschein, die Gunst der Stunde zu nutzen, wo er doch eigentlich die ganze Zeit herumtrödelt. Er sieht sich als fleissig und zielstrebig, und das geräumige Atelier verpflichtet ihn, die Geräumigkeit auch zu nutzen. In seinem Atelier geht er ständig im Kreis herum, er dreht seine Runden, und solange er geht und seine Runden dreht, hält er den Glauben an sich selbst aufrecht. Und mit dem Glauben auch den Zweifel. Wer glaubt, zweifelt auch. Das Unvermögen, mit der eigentlichen Arbeit zu beginnen, nagt an Seppli, seit er in sein Atelier eingezogen ist. Ja, ja, ich arbeite, hat Seppli am Telefon beteuert. Ja, ja, ich arbeite wie verrückt... Wie ein Verrückter... Ach Seppli, ich kann diese ewigen Beteuerungen bald nicht mehr hören. Sie hängen mir zum Hals heraus. In Wirklichkeit ist Sepplis Arbeitseifer irgendwo verdunstet, in einer guten Absicht vielleicht, in einem Planungsstadium. Was er die ganze Zeit treibt, hat eher mit Aufwärmübungen als mit Arbeit zu tun. Was an sich ja gar nicht so schlecht wäre. Er bereitet sich auf eine grosse Aufgabe vor. Das ist doch löblich, ist doch schön. Doch schaut man genauer hin, erhält man ein ganz anderes Bild. Im Vorfeld seiner Malerei entwickelt Seppli eine Unrast, die so tut, als hätte sie ein Ziel. Wenn er nicht gerade Notvorräte bunkert, berechnet er Leinwandgrössen und überlegt, wie er sich vor der Staffelei positionieren muss, damit er keinen Haltungsschaden bekommt. Tagelang zerbricht sich Seppli den Kopf darüber, ob er beim Malen sitzen oder stehen soll. Und während er sich den Kopf darüber zerbricht, geht er in seinem Atelier unablässig im Kreis herum.
Arbeit. Das Wort ist dehnbar, es lässt sich verdünnen, bis es auf fast jede Tätigkeit anwendbar ist. Arbeiten wir an unserer Beziehung, sagt zum Beispiel ein Ehepaar. Und dann wird gehobelt und gebohrt, man mischt Mörtel und klatscht ihn sich gegenseitig ins Gesicht. Die Beziehung ist also etwas, an dem man arbeitet, idealerweise zu zweit. Aber man kann auch an sich selbst arbeiten. Ich arbeite an mir, sagt jemand, der sich in eine Psychotherapie begibt, um irgendetwas durch- oder aufzuarbeiten. Es ist ein Ziel, das viele Menschen verfolgen, das Ziel, etwas Sinnvolles aus dem Leben zu machen - oder überhaupt etwas aus dem Leben zu machen. Millionen und Abermillionen Menschen arbeiten an sich oder ihren Beziehungen, und das Ergebnis spricht für sich. Und du Seppli, was würdest du wählen, wenn du die Wahl hättest? habe ich Seppli am Telefon gefragt. Der glücklichste Mensch zu sein oder ein Bild zu malen, das die Mona Lisa in den Schatten stellt? - Habe ich denn die Wahl? hat Seppli zurückgefragt.
Die künstlerischen Erwartungen, hat Seppli am Telefon gejammert, erdrücken mich fast, sie sind ein Zentnergewicht, das ich jeden Tag aufs neue den Berg hochschleppe... Jeden neuen Tag aufs neue. Bei unsern Telefonaten hat sich Seppli nach Strich und Faden heruntergemacht. Sein Lamento begleitet mich auf der ganzen Zugsfahrt. Es betrifft eigentlich gar nicht so sehr die Arbeit, sondern eher die Unmöglichkeit, in die Arbeit einzusteigen. Die künstlerische Arbeit, die er doch so gerne im Mund führt, geht ihm nicht gerade leicht von der Hand. Sie widerstrebt ihm. Tatsächlich empfinden die meisten Künstler die künstlerische Arbeit als Zumutung. Schriftsteller hadern mit der Sprache, und Maler hadern mit den Farben. Das ist ja nichts Neues. Ich wundere mich nur, dass man es so hartnäckig ignoriert. Das Hadern der Künstler mit der Kunst ist etwas ganz Natürliches. Es entspricht einem verbreiteten Phänomen, nämlich dem Gesetz der grösstmöglichen Deplatzierung. Die meisten Menschen spezialisieren sich auf Tätigkeiten, die ihnen eigentlich gar nicht so sehr zusagen. Wie aus einem blinden Drang heraus stellen sie sich auf die Probe, tun also das, was sie gar nicht so gut können. Darin liegt denn auch der Grund, weshalb ausgerechnet die künstlerisch unbegabtesten Menschen den Drang verspüren, Künstler zu werden, während die eigentlichen Kunstgenies an allen möglichen Orten tätig sind, nur nicht in der Kunst.
Was ist los mit Seppli? Vielleicht haben seine Selbstzweifel auch mit der gängigen Arbeitsmoral zu tun. Vielleicht macht er heimlich Zugeständnisse an die ökonomischen Werte, die ihm - uns allen - schon in Kindertagen eingeimpft worden sind. Mit seiner Arbeit verdient er kein Geld. Ob er deswegen den Rank nicht findet? Wäre schade. Denn seine Entscheidung für die freie Kunst könnte er sich durchaus zugute halten. Die Entscheidung für die freie Kunst ist mutig und sinnvoll. Damit macht er sich wenigstens nicht zum Narren. Geld verdienen, das man ausgibt, notgedrungen oder spasseshalber, eine vergängliche Substanz also, die einfach nur da ist und zirkuliert wie das Blut im Körper: dafür soll man arbeiten? Für etwas so Selbstverständliches? Um den Kreislauf der Dinge aufrechtzuerhalten, die blosse Existenz? Was die Lohnempfänger als Arbeit bezeichnen, ist in Wahrheit nichts anderes als bezahlte Knechtschaft, um nicht von Sklaverei zu reden. Die Regierungen und Wirtschaftsbosse zwingen uns zur Arbeit. Sie haben jedes Interesse daran, uns in ihre Tretmühlen zu sperren und als Konsumenten bei der Stange zu halten. Das erschuftete Geld sollen wir schön brav wieder in den Kreislauf einspeisen, damit es ein endloses Weiterschuften ermöglicht zwecks Kapitalanhäufung auf den Konten einiger weniger Milliardäre. Ja, Seppli, möchte ich dir zurufen: du hast recht. Du arbeitest. Du arbeitest eben nicht wie ein Normaler, sondern wie ein Verrückter. Du arbeitest sinnlos, weil kein Taxometer und keine Stempeluhr deine Arbeitsmoral misst, und deshalb fühlst du dich als Sisyphus. Eigentlich paradox. Deine Arbeit dient nicht dem auf dem Niveau von Termiten sich abspielenden Kreislauf pekuniärer Nützlichkeit. Ökonomisch ist deine Arbeit sinnlos. Sie dient nur sich selbst, sie stützt ein anderes Wertesystem als das ökonomische. Sie beruht nicht auf Quantifizierbarkeit, sondern einzig und allein auf dem schöpferischen Spiel. Das sogenannte Erwerbsleben ist dem Künstler zuwider, weil es seine kreative Freiheit bedroht, im schlimmsten Fall sogar vollständig zerstört. Es ist sein Todfeind. Wie ein Betonklotz begräbt es jeden Ansatz zu einer höheren Bestrebung unter einer massiven und tyrannischen Materialität. Nun, was ist die sogenannte höhere Bestrebung? Es ist das, was sich nur in Freiheit realisieren lässt. Nicht in jener Freiheit, die uns unablässig eingepaukt wird, die Freiheit des Geldausgebens zu jeder Tages- und Nachtzeit, ich meine die andere Freiheit, die richtige Freiheit. Nur dort findet der Mensch zu sich selbst. Für die Systemerhalter und Menschenkontrolleure ist das freilich ein Graus. Freie Menschen sind das Letzte, was sie brauchen können. Nur logisch, dass sie alles daran setzen, den Heranwachsenden das Bedürfnis nach Freiheit frühzeitig auszutreiben. Ganz gelingt das nicht. Was davon übrig bleibt, wird in Freizeitverhalten umgewandelt. So wird es wenigstens ein Stückweit beherrschbar. Es wird Konsum. Die Menschen sollen wirtschaftlich funktionieren, für die Wirtschaft leben und sterben sie, und die einzige Freiheit, die sie zu schmecken bekommen, ist die Freiheit des Konsums. Kaum dem Sandkasten entwachsen, werden sie gezwungen, sich für einen Beruf zu entscheiden, eine Lehre, eine Studienrichtung, irgendeine Spezialisierung. Kaum haben sie einen eigenen Kopf entwickelt, wird ihnen dieser Kopf enteignet und abgeschraubt, um dann igendwo aufgeschraubt zu werden, wo er sich nützlich machen kann. Kaum hat man einen eigenen Kopf, wird man schon geköpft. Kaum hat man einen eigenen Mund, wird man schon entmündigt. Und hat ein junger Mensch nach langer Grübelei endlich seine Berufswahl getroffen, heisst es schon: du musst dich umschulen. Du musst dich weiterschulen. Den Zug, den du bestiegen hast, gibt es nicht mehr. Und so geraten die Geschulten, Ausgebildeten und Berufsmenschen von einer Übergangssituation in die nächste. Immerfort gilt es umzusteigen. Auf dieser unsicheren Basis lässt sich nichts realisieren, nichts von Bestand jedenfalls, die unsichere Basis wird zur ewigen Baustelle, aus der nichts hervorgeht. Flexibilität als Selbstzweck: die Lebensphilosophie der Dummköpfe, das Mantra der Liberalisierungsapostel. Leute wie Einstein und Picasso haben das Gegenteil gemacht. Sie haben ihr Leben lang den gleichen Job gemacht, stur und unbeirrt. Deshalb ist auch etwas dabei herausgekommen. Je kreativer ein Mensch, desto unflexibler verhält er sich. Warum wohl? Flexibilität heisst Verfügbarkeit, Fremdbestimmung. Ein Mensch, der sich flexibel verhält, ist nützlich, ein nützlicher Idiot. Die Menschen, die heute ins Berufsleben einsteigen, werden nur noch herumgehetzt. Ständig müssen sie weiter, sich weiterbilden, besser werden oder zumindest anders werden. Sie müssen flexibel sein. Und aus dieser unablässigen Gehirnumprogrammierung, der sie sich zähneknirschend oder freudig unterwerfen, um das jeweils nächstbeste Pöstchen oder Salärchen zu ergattern, schöpfen sie ein Lebenlang ein falsches Selbstwertgefühl. Ja, sie liegen falsch. Nicht nur in Bezug auf die fehlende Beständigkeit, die Tatsache, dass ihnen Flexibilität als Tugend vorgegaukelt wird, nein, auch in Bezug auf die Freiheit. Nur im Erproben seiner schöpferischen Kräfte ist der Mensch auf seiner Höhe. Nur in der ökonomischen und geistigen Unverfügbarkeit findet er seine Freiheit. In der Arbeit ist er Sklave. Die Reduzierung seiner Anlagen auf das gesellschaftlich Verlangte lässt ihn verkümmern. Wenn ihn das Nützlichkeitsdenken regiert, ist der Mensch kein Mensch, sondern ein Nutztier. Ein Ackergaul. Und machen wir uns nichts vor. Dem Nützlichkeitszwang entkommen nur die wenigsten Menschen. Etwa die Künstler. Oder die Arbeitslosen. Oder die Invaliden. Oder die Millionäre. Oder die Pensionäre. Ob durch Willenskraft oder Schicksalsfügung, sie sind es los, das Joch, das die meisten Menschen mit sich herumtragen. Das Joch, das darin besteht, Geld verdienen zu müssen, so wie der Ackergaul sein Heu verdienen muss. Das Joch, das uns entmenschlicht und erniedrigt. Denn eines ist wahr: Arbeit macht unfrei. Die sogenannten Nichtstuer stehen auf keiner Lohnliste, sie verdienen nichts, gewinnen dafür aber eine Freiheit, die eigentlich allen Menschen zusteht. Im Nichtstun liegt das Elementare. Hat man sich darin sesshaft gemacht, erlangt man eine Freiheit, auf der sich eine sinnvolle Arbeit - eine selbstbestimmte Arbeit - aufbauen lässt. Alles andere ist Mumpitz. Du, Seppli, bist ein Nichtstuer, du hast, so kann man vielleicht sagen, den Nutztierstatus überwunden. Du bist ein Mensch, ein richtiger Mensch, und als solcher weisst du, was du dir wert bist. Du verdienst kein Geld. Du lässt es dir schenken.
Schenken lasse ich mir nichts, hat mich Seppli am Telefon belehrt. Und überhaupt, was fällt dir eigentlich ein, mich mit Invaliden und Arbeitslosen in einen Topf zu werfen? Du hast ja keine Ahnung, was Arbeiten bedeutet. Bei dir läuft das anders. Du verdienst dein Geld nicht mit grossartigen Schaffensideen. Du bleibst auf dem Boden, im Flachen, und insofern hast du dich gut gesichert, abstürzen kannst du nicht. Als Flachlandbewohner lebst du relativ schwindelfrei. In deinem Laufgitter tigerst du hin und her und beneidest mich um meine Freiheit. Aber wie ist es um diese Freiheit wirklich bestellt? Sie ist erbärmlich. Sie macht aus mir einen Querulanten wider Willen. Während du in deinem Laufgitter herumtigerst, tigere ich in meiner Freiheit herum. Ich sehe sie als Zumutung und bin genauso unzufrieden wie du in deiner Unfreiheit. Erhebliche Zweifel plagen mich. Warum geniesse ich solche Privilegien? Warum werde ich von Amts wegen wie eine seltene Viehrasse behandelt? Warum subventioniert man mich? Ist das rechtens? Kann mir irgendjemand nachweisen, dass das Geld, das man in mich hineinsteckt, nicht verlocht ist? Bin ich ein Loch? Was nützt mir meine Freiheit, wenn sie aus lauter Abhängigkeiten besteht? Was nützt mir meine Freiheit, wenn ich ständig gegen sie aufbegehren muss, weil sie im Grunde genommen ein Lügenmärchen ist? Obwohl ich an das Märchen ja ganz gern glauben würde, das Märchen, ich sei ein Tiger in freier Wildbahn, eine Grossartigkeit mit Seltenheitswert, widerstrebt es mir, unter Artenschutz gestellt zu werden. Sondervergünstigungen lehne ich ab. Ich habe das Recht, mit meiner Arbeit Geld zu verdienen. Ich bin kein Nichtstuer. Ich bestehe darauf, dass meine Leistungen angemessen entlöhnt werden. Mit Geschenken gebe ich mich nicht zufrieden, sie verletzen meinen Stolz. Mein Ego bekommt einen Knacks, wenn ich auf Gunstbezeigungen angewiesen sein soll. Ich möchte auf eigenen Beinen stehen. Andererseits bin ich mir sehr wohl bewusst, dass ich in dieser Hinsicht noch wenig erreicht habe. Ich hänge am Topf der kantonalen Kunstförderung; ohne sie wäre ich schon längst verhungert. Ohne sie wäre ich ein Nichts. Dass ich als förderungswürdig anerkannt worden bin, hat mich für den Moment gerettet. Noch einmal davongekommen! Ich bin also ein Atelierkünstler, das heisst: ich muss nicht verhungern. Aber nur für den Moment! Und woher will ich denn wissen, ob ich diese Anerkennung überhaupt verdiene? Vielleicht bin ich ja nur ein Quotenkünstler, vielleicht habe ich dank meiner Herkunft gerade noch so knapp in das Kontingent der förderungswürdigen Atelierkünstler hineingepasst. Machen wir uns nichts vor. Ein innerschweizer Künstler, das ist etwas Ähnliches wie ein Fussmaler, ein hübsches Kuriosum. Wenn ich bis anhin etwas verdient habe, dann ist es wohl eine Tracht Prügel...
Es stimmt. Wenn Seppli bis anhin etwas verdient hat, dann ist es eine Tracht Prügel. Von seiner Freiheit macht er einen schlechten Gebrauch. Er spürt das. Und weil er mit seiner Freiheit nicht zurande kommt, bedroht ihn das Chaos. Was unternimmt er dagegen? Wie versucht er das Chaos zu bändigen? Ganz einfach. Er bemüht sich um Disziplin, er praktiziert praktisches Denken. Ich bin recht unkompliziert, behauptet er. Beim Duschen behalte ich immer die Schuhe an. Die Füsse wasche ich separat... Seppli weiss sehr wohl, dass er Künstler ist. Und weil dies weitherum niemand so sicher weiss wie er, spricht er gerne über die allgemeine Kunstignoranz. Sie ist es, was ihn daran hindert, “gross” zu werden. Verdriesslich hält er nach einer Gelegenheit Ausschau, sein Künstlertum unter Beweis zu stellen. Als Künstler habe ich ein gewisses Können, das mich von der Masse abhebt, hat Seppli am Telefon behauptet. Wer schon ausser mir kann so malen wie ich? Niemand! Mein Farbauftrag ist unnachahmlich, meine Pinselführung würde jeden Fälscher vor unüberwindliche Schwierigkeiten stellen, und meine Pigmentmischungen, die ich endlosen Tüfteleien verdanke, sind mir oft selbst ein Rätsel. Wie hat er das bloss gemacht? fragen sich die Leute, wenn ich sie ausnahmsweise mal einen Blick auf meine Bilder werfen lasse. Wie habe ich das bloss gemacht? frage ich mich oftmals selber, wenn ich ein Bild fertig habe und es im Garten an einen Baum hänge, um es bei Sonnenlicht zu betrachten. Entgegen allen Behauptungen ist der Malvorgang mit dem fertigen Bild noch überhaupt nicht abgeschlossen. Im Kopf drin malt es weiter... Im Kopf drin malt es weiter, denn der Kopf hat keinen Abschaltknopf, das Malen ist ein Automatismus wie die Atmung oder der Herzschlag. Da ist kein Platz für Selbstzergliederung, entweder man malt oder man malt nicht, und wenn man sich zergliedert, weil man nicht malt, untersucht man eigentlich immer nur das, was abwesend ist, ein Phantom. Über das Malen nachdenken kann ich nur, wenn ich nicht male, wenn sich die Distanz zwischen mir und der Malerei so weit gefestigt hat, dass ich die Malerei als etwas von mir Abgetrenntes begreifen kann. Dann aber ist die Malerei bloss noch ein Phantom, und die Malerei, die ich wirklich erlebe und ausübe, hat nicht die geringste Ähnlichkeit damit. Was ich über das Malen sage und denke, ist völlig unerheblich, ich könnte genausogut gar nichts darüber sagen und denken, ich könnte als der grösste Hohlkopf herumlaufen und trotzdem ein guter Maler sein. Wenn ich das Malen erklären soll, komme ich in eine Erklärungsnot, die mich sprachlos machen würde, könnte ich sie nicht durch einen Seitenblick auf die Biologie ein bisschen abschwächen. Wie ist es möglich, frage ich mich, dass mein Körper seine komplizierten Stoffwechselvorgänge abwickelt, ohne meinen Willen einzuschalten? Ohne mein Bewusstsein in diese Vorgänge einzuweihen? Ich weiss es nicht. Mein Bewusstsein hat nichts damit zu tun. Es ist das falsche Auskunftsbüro. Auch für das Malen hat es keine Erklärung parat. Ich male nicht, weil ich das will, sondern ich will malen, weil es in mir die ganze Zeit schon malt, schon immer gemalt hat. Es wäre töricht von mir, das Malen als beschämende Vergeblichkeit zu betrachten, nur weil ich im Moment kein Bild male. Was ist denn schon ein Bild? Geht es beim Malen etwa darum, Bilder herzustellen? Das meint auch nur, wer vom Malen keinen blassen Schimmer hat. Wenn ich male, zerstöre ich das Bild, das ich malen könnte, weil das Bild, das ich malen könnte, nie und nimmer mit dem Bild zusammenfällt, das beim Malen tatsächlich entsteht: somit ist das Malen auch ein Vorgang der Bildvernichtung. Was ein Maler mit seiner Malerei betreibt, ist die pure bildnerische Destruktion: Vandalismus in Gelb, Rot und Blau. Und andererseits, wenn ich nicht male, male ich dann tatsächlich nicht? Das meint auch nur, wer vom Malen keinen blassen Schimmer hat. Wenn ich nicht male, male ich zwar kein Bild und befinde mich als Maler im Schlafzustand, im Wartebetrieb, aber ich gebe mir damit wenigstens die Chance, bald oder in naher Zukunft ein Bild malen zu können, das besser ist als das Bild, das ich malen würde, wenn ich mir diese Chance vorenthalten würde. Verstehst du?
Manchmal ist die Aufmerksamkeit herabgesetzt und das Interesse gering: dann will einem einfach nichts gelingen. Dann hilft es auch nichts, dass man sich auf etwas versteift und mit dem Kopf durch die Wand will. Vielleicht muss Seppli das Malen vorübergehend ruhen lassen, es gibt ja schliesslich noch andere Beschäftigungen für einen Künstler. Beschäftigungen, die weniger anstrengend sind. Vor kurzem hat Seppli das Zeichnen entdeckt. Zeichnen könnte mich aus meiner Stagnation erlösen, hat Seppli am Telefon gesagt. Zeichnen ist Glukose für das Künstlerblut. Zeichnen ist eine Frischzellenkur. Weil es Kopf und Hand nicht trennt, sondern zu einem einzigen Impuls vereinigt. Wie bei einer Zen-Übung. Beim Zeichnen fühlt man eine Energie, die direkt in den Strich fliesst, vom Kopf zur Hand und in den Strich ohne jede Unterbrechung, wie wenn das alles am Stück wäre, und man braucht den Strich weder zu denken noch zu lenken, er findet seinen Weg von alleine, ganz flüssig läuft er aus einem heraus und aufs Papier, jede bewusste Lenkung könnte ihn verwirren und zerstören, weshalb es vor allem darauf ankommt, ihn nicht bemeistern zu wollen, es gilt, die Kontrolle abzugeben und den Ruhepunkt, aus dem der Strich herausfliesst, zu erhalten. Das geht nur, wenn man sich nicht anstrengt. Wenn man sich dem Zeichnen einfach überlässt. Dann macht man die beglückende Erfahrung, dass man dran bleibt und im innern Gleichgewicht. Wie beim Velofahren oder Seiltanzen ist es die Bewegung, die das Gleichgewicht erhält, eine Bewegung, die nicht über sich selbst nachsinnen darf. Nun, ich möchte zeichnen. Ich möchte eine Frau zeichnen, die auf einem Stuhl sitzt. Ein richtiges Modell muss her, ein schönes Modell mit einer nicht zu kurzen Frisur und nicht zu grossen Füssen. Und ihre Bluse muss hübsch drapiert sein, faltig wie eine Schneelandschaft...
In der näheren oder weiteren Umgebung des Bergateliers eine Frau zu finden, die bereit wäre, stundenlang mit drapierter Bluse auf einem Stuhl zu sitzen, dürfte allerdings gar nicht so einfach sein. Die Bergbevölkerung hat in der Regel anderes zu tun, als irgendeinem dahergelaufenen Künstler Modell zu sitzen. Seppli weiss das, und es bedrückt ihn. Ein bisschen gezeichnet hat er trotzdem, und zwar nach der Natur. In einem freistehenden Stall in der Nähe seines Ateliers überwintert eine Ziege, mit der sich Seppli angefreundet hat. Sieh an, habe ich zu ihm gesagt, Träume werden wahr... So ist es, hat Seppli erwidert. Diese Ziege kommt mir wie gerufen. Sie heisst Meggy. Sie hat ein wunderschönes weisses Fell, und sie frisst mir aus der Hand. Eine Superziege! Ihr Besitzer, der Bio-Bauer Madöri, der auch mein Atelierverwalter ist, hat mir das Zeichnen in seinem Stall erlaubt. Ich darf dort ein- und ausgehen, wie es mir beliebt. Ein Glücksfall. Meggy zeigt sich sehr anstellig. Sie lässt sich ausgiebig porträtieren. Und ob du's glaubst oder nicht: alle Ziegen-Zeichnungen, die ich bis jetzt gemacht habe, sind bereits in Madöris Besitz. Stapelweise hat er mir die Zeichnungen abgekauft. Einfach so. Mehrere Hundert Franken hat er hingeblättert, einfach so, aus seinen schmutzigen Cordhosen hat er die Scheine gezogen, aus dem Bauernbankomaten sozusagen, und es scheint mir sonnenklar, dass er nur deswegen so viel hingeblättert hat, weil auf den Zeichnungen seine Ziege abgebildet ist. Hätte ich eine andere Ziege gezeichnet, zum Beispiel die Ziege des Nachbarn, eines gewissen Hans Stöffli, den Madöri verächtlich als “zugewanderten Fötzel” bezeichnet, so würde Madöri niemals soviel Geld locker gemacht haben. Mit ziemlichem Behagen hat er sich auch meine früheren Arbeiten angeschaut. Er hat sie für gut befunden, für “brauchbar”, und nachher, du glaubst es nicht, hat er mich zu einem gediegenen Nachtessen nach Schindboden eingeladen, irgendwas mit Kutteln, ich habe tüchtig reingehauen. Da siehst du es wieder, wir sind voller Vorurteile. Die meisten Bergler stehen der Kunst gar nicht so banausisch gegenüber, wie wir immer denken. Sie lassen auch Künstler gelten, die nicht so akurat malen und zeichnen wie Albert Anker. Madöri hat mir einen Bärendienst erwiesen, nicht nur als Geldgeber und Mäzen. Er hat mich auch künstlerisch gefördert. Dank seiner Ziege habe ich den Zeichner in mir entdeckt, und der Zeichner in mir hat die Ziege entdeckt, und die Ziege ihrerseits hat mein Brot entdeckt. Sooft ich ihr einen Brotbrocken zuwerfe, schnappt sie ihn freudig meckernd und lässt ihn mit einem backenausstülpenden Käuen und Malmen zwischen ihren Zähnen zerkrachen.
Sepplis Aufenthalt am Berg dauert schon viel zu lange. Er hat noch kein einziges Bild gemalt. Wenn ein Künstler nach über zwei Monaten Atelieraufenthalt noch kein einziges Bild gemalt hat, wird es ernst, dann klingeln bei mir die Alarmglocken. Was tut Seppli die ganze Zeit? Er zeichnet. Aber letztlich ist das nicht so seine Sache. Es ist eine Verlegenheitslösung. Neben dem Zeichnen bleibt alles, wie es ist. Seppli versäumt sich im gleichförmigen Tagesablauf des Nichts- oder Wenigtuns, kocht Ravioli auf einem Minikocher und mischt - wahrscheinlich in derselben Pfanne, in der er seine Ravioli kocht - pflanzliche und mineralische Pigmente mit Harz und Eigelb, woraus Farben entstehen, die sehr schnell eintrocknen, weil die Malerei, für die sie ja gedacht wären, immer wieder aufgeschoben wird und irgendeiner scheinbar dringlichen, aber eigentlich ganz und gar unnötigen Beschäftigung weichen muss. Und natürlich ist das nicht Faulenzerei und schon gar nicht wenig oder nichts. Es ist eine interessante Situation. Mich nimmt wunder, wie es bei Seppli aussieht. Ich möchte sehen, womit sich ein Künstler in seinem Atelier beschäftigt, wenn er nicht malt. Mich interessiert auch die Vorgeschichte des Malens, die Mühsal der Selbstmotivation. Das Forschen und Suchen in einer Phase, in der noch kein einziger Pinselstrich getan ist. Die Bildlosigkeit, an der sich Seppli abmüht, regt meine Phantasie an. Ich sehe sie bildlich vor mir, diese Bildlosigkeit, sie inspiriert mich. Seppli, der Maler, betätigt sich bildnerisch und malt doch kein einziges Bild. Ein interessanter Ansatz, kratzt er doch am herkömmlichen Werkbegriff. Die Leinwände bleiben leer, die Bildschätze ungehoben. Mehrmals hat Seppli angerufen und seine Quengelei bei mir deponiert, dies und das und jenes behindere ihn und verzögere das Malen, er könne nicht stillsitzen oder stillstehen und sich konzentrieren, weil ihn dies und das und jenes mit Beschlag belege, ja, vermutlich sei er hochgradig abgelenkt, permanent auf dem falschen Sender, aber was noch schlimmer sei, er brüte innerlich über das Malen und mache es herunter. Ja Seppli, das ist nun mal so, wenn ein Maler malen möchte, dann plagen ihn Zweifel. Und weil er nicht loskommt von seinen Zweifeln, verheddert er sich in maltechnischen Zurüstungen. Und weil er sich in maltechnischen Zurüstungen verheddert, kommt er nicht zum Malen. Und weil er nicht zum Malen kommt, treiben ihn berechtigte Zweifel um.... Nicht dass ich Seppli nicht gut zugeredet hätte. Ich habe es versucht. Habe mich als Mut- und Muntermacher betätigt und zu Sepplis Entlastung sogar auf den Allerhöchsten hingewiesen. Gott, habe ich gesagt, hat für die Erschaffung der Welt sechs Tage gebraucht. Und das ist, wie wir wissen, nur ein Gleichnis. In Wirklichkeit hat Gott einige Milliarden Jahre gebraucht. Er hat nicht nach einer Woche schon alles fertig in seinen Regalen gehabt. Nein, er hat Jahrmilliarden lang herumgepröbelt, mit Planeten und Monden jongliert und allerhand Unsinn angestellt. Zum Beispiel hat er das Licht erschaffen, und erst später ist er auf die Idee gekommen, dass es vielleicht sinnvoll wäre, zum Licht auch noch eine Lichtquelle zu machen. Und so schuf Gott die Sonne, nachdem er das Sonnenlicht eigentlich schon erschaffen hatte, und er sah, dass es gut war und war sehr zufrieden mit sich. Ja, Seppli, Gott hat manchmal ganz schön improvisiert. Herumgewurstelt, müsste man sagen. Wer bist du, dass du dich deiner Wursteleien schämen müsstest? Als Mensch bist du von vornherein entschuldigt. Es ist anstrengend, Mensch zu sein. Kräfteraubend. Es ist fast nicht zumutbar, und trotzdem müssen wir das erdulden. Ja, Seppli, mit deinem beschränkten Körper und deinem stupiden Geist lebst du in einer Welt der ausgedehntesten Wirklichkeit. Kein Wunder, bist du zum Scheitern verurteilt.
Bietet sich Gelegenheit, einen Maler zu besuchen, besser gesagt einen Kunstmaler, so ist das ein Glücksfall. Das Atelier eines Malers ist zwar keine Dunkelkammer, im Gegenteil, was sich darin entwickelt, entwickelt sich in der natürlichsten Sichtbarkeit, im vollen Tageslicht. Doch andererseits haben Atelier und Dunkelkammer auch einiges gemeinsam, zum Beispiel unterliegen sie ähnlichen Zutrittsbeschränkungen. Besucher sind nicht unbedingt erwünscht. Wird man dennoch eingelassen, betritt man eine Zone, in der man nichts zu suchen hat, wo unerklärliche Dinge geschehen und jeder Handgriff ein bisschen geheimnistuerisch wirkt. Die Künstler fördern diesen Eindruck ja nach Kräften. Sie werden grantig, wenn man ihnen über die Schulter schaut, und noch grantiger werden sie, wenn man, anstatt schön brav im Hintergrund zu bleiben, wo man als Kunstliebhaber eigentlich hingehört, den Kopf mitten in die Leinwand hineinstösst, um auf die andere Seite blicken. Wenn man, anstatt den Mund zu halten, ein sogenanntes Werkgespräch zu führen versucht. Damit stört man den Arbeitsfluss des Künstlers, beeinträchtigt sein Schaffen und macht sich zum Vollidioten. Aber auch ohne dieses Fehlverhalten dürfte es manchem Kunstliebhaber schwerfallen, mit Künstlern ins Gespräch zu kommen. Notwendigerweise auf die Leinwand fixiert, die sie bearbeiten, verschmähen sie den zwischenmenschlichen Kontakt und halten die Geselligkeit, dieses perfide Druckmittel der Gesellschaft, so weit wie möglich von sich fern. Das Misstrauen der Künstler jenen gegenüber, die ihnen auf die Schliche kommen wollen, ist berechtigt und muss in jedem Fall respektiert werden. Wenn man darauf verzichtet, die Künstler zu bedrängen, und sich ihnen gegenüber nicht als Kunstliebhaber aufspielt, sondern bescheiden daran festhält, dass man im Grunde genommen von Kunst so gut wie überhaupt nichts versteht, so ist dies vielleicht der erste Schritt zu einem erspriesslichen Miteinander. Künstlerbekanntschaften zu pflegen, ist ein Hobby von mir, vielleicht kein besonders geistreiches Hobby, aber immer noch besser als Schweinehüten. In einem Punkt, das gebe ich zu, bin ich schrecklich ordinär: ich interessiere mich für Kunst. Und für Künstler interessiere ich mich ausschliesslich deswegen, weil sie die Kunst herstellen. Die menschliche Seite der Künstler interessiert mich weniger. Nichts Dümmeres als Künstlerbiografien. Als Menschen sind Künstler, ich muss es leider sagen, überhaupt nicht erwähnenswert. Wenn ich Seppli am Telefon habe, würde ich am liebsten aufhängen. Mach du deine Kunst, sage ich ihm, mach du deine Kunst, und zwar kommentarlos. Hör auf, mir auf die Nerven zu gehen mit deinem Altweibergequengel. Hör auf, durch dein Atelier zu wackeln mit deinem Gespucke und deinen Kopfkratzgeräuschen, während du mit mir telefonierst. Alles Menschliche an dir ist irgendwie peinlich. Es ist ungehörig. Eine Luderei! Wenn Künstler nicht arbeiten, sollte man sie mit Äther betäuben, damit sie nicht noch auf die Idee kommen, eine Lebensäusserungen von sich zu geben. Künstler sollten Kunst machen und sonst nichts. Vor allem sollten sie ihre Zeit nicht mit Telefonieren vertrödeln und ihre Umwelt belästigen mit Quengeleien. Künstler, die nicht arbeiten, sind die schlimmsten Jammersäcke, und sie jammern zu Recht, denn sie sind einfach nichts wert! Ja Seppli, ich sage dir auf den Kopf zu, dass du, solange du jammerst, an der Sache vorbeigehst. Erst wenn du aufhörst mit Jammern, wirst du auf die Sache zugehen, die uns beiden so wichtig ist, nämlich die Kunst.
Wir werden zusammen Silvester und Neujahr feiern. Doch was heisst hier feiern? Die Situation ist ernst. Wir feiern, um nicht trübsinnig zu werden. Zu feiern gibt es eigentlich nichts - es sei denn, wir sehen grosszügig darüber hinweg, dass Sepplis Atelieraufenthalt mit einem dramatischen Zuwachs an Sorgen verbunden ist. Diese Sorgen müssen wir in Alkohol ertränken, denn nur mit Alkohol können wir uns dazu bringen, Sepplis Atelieraufenthalt als Chance zu feiern. Gratuliere, Seppli, du hast es geschafft. Endlich hast du ein Atelier und bist auf dem Sprung, ein anerkannter Künstler zu werden. Du wirst gefördert, man flösst dir die Opiumtropfen des Erfolgs ein und setzt dir ein Papierkrönchen auf den Kopf wie am Dreikönigstag. Für die Dauer deines Atelieraufenthalts darfst du im Rampenlicht stehen und Kunst machen, dass sich die Balken biegen. Du geniesst das Vertrauen von Kunstexperten, die dich empfehlen und anpreisen, so wie sie auch sich selber empfehlen und anpreisen, und so lernst du Menschen kennen, Kunstliebhaber, die es gut mit dir meinen und deinen Bekanntheitsgrad zu steigern vermögen. Sie stellen dich aus, sie lancieren dich als Künstler, nennen dich aber nicht Künstler, weil das zu altbacken und vielleicht auch zu unseriös klingt, offiziell bist du ein Kunstschaffender, also jemand, der sein Grundeinkommen ordnungsgemäss versteuert. Jemand, der seinen Beruf nicht zu verstecken braucht. Beruf? Ja, tatsächlich, es ist ein vollgültiger Beruf. In der Eidgenössischen Berufsregistratur findest du den Kunstschaffenden direkt vor dem Kunststoffsachbearbeiter. Man hat dich quasi geadelt und zur Vertrauensperson erhoben, als Kunstschaffender schaffst du Vertrauen in die Kunst und vor allem auch in deine Förderer, und so wirst du erleben, dass man dir von allen Seiten hofiert, weil du, so die offizielle Verlautbarung, das kulturelle Leben der Region bereicherst und aufwertest. Ja, die Kunstförderer und Kunstliebhaber werden deine Nähe suchen wie die Motten das Licht, und sie werden über deine Witze lachen, über die niemals zuvor jemand gelacht hat. Wir, deine Freunde, kennen ja deine Witze zur Genüge, und deshalb distanzieren wir uns von dir, bevor es in deinem Umkreis quasi obligatorisch wird, über deine albernen und geschmacklosen Witze zu lachen. Diese Leute, die Kunstförderer und Kunstliebhaber, werden sich nicht zu schade sein, mit dir gleichzuziehen, keine Gelegenheit werden sie auslassen, über deine Witze zu lachen. Schon jetzt schmeicheln sie dir mit Vorbedacht. Sie kalkulieren bereits deinen Erfolg, sie hoffen, dass der Wetterfrosch das Erfolgsleiterchen hochklettern wird. Sie machen dich zu ihrem Spekulationsobjekt. Sie, diese Leute, die du mit deinen albernen und geschmacklosen Witzen zum Lachen bringen wirst, geben dir Vorschusslorbeeren, denn sie lieben es, ein Talent zu entdecken, es gross rauszubringen. Plötzlich wird da einer berühmt, den man persönlich gefördert hat und über dessen Witze man gelacht hat, um ihn aufzumuntern. Sie werden deine Ausstellung besuchen und dir die Hand schütteln, als würdest du zu ihnen gehören. Denn das haben die einflussreichen und kunstliebenden Menschen so an sich: sie brauchen die Kunst, um sich in ihr zu verwirklichen. Und mit den Künstlern gehen sie eine oberflächliche Komplizenschaft ein, um sich selber einen Hauch von Künstlertum zu geben. Sie sonnen sich im Glanze einer Kreativität, die ihnen so vollkommen abgeht, dass sie logischerweise davon fasziniert sind, ja besessen. Man schwärmt nur für Dinge, die man nicht erreichen kann, und oft genug sind es sogar Dinge, die man nicht einmal begreifen kann. Jeder Esel versteht mehr von Kunst als die sogenannten Kunstliebhaber. Es sind Leute, die mit offenem Mund durchs Museum gehen und selbst den Feuerlöscher noch anstaunen, nur weil der in einem Kunsttempel hängt. Von sich selber sind sie natürlich sehr eingenommen, sie halten sich für kultiviert, sie verstehen sich auf modische Attitüden, auf schöne Kleider und tolle Frisuren. Auf schöne Dinge reagieren sie mit kribbliger Bewunderung, es spielt dann auch fast gar keine Rolle, worum es sich handelt: eine Bachkandate gilt ihnen gleich viel wie eine hübsch bemalte Zuckerdose. Kultur ist für sie eine Dienstleistung, die das Bedürfnis nach schönen Sachen und Sächelchen befriedigt. In den Kunstwerken sehen sie etwas, das den Mehrwert des blossen Schönseins besitzt, ohne sich im Gegenstandslosen zu verflüchtigen. Kunstwerke sind für sie Sachen, wertvolle Sachen natürlich, und Bilder sehen sie nicht einfach nur als Bilder, sondern als etwas Handfestes zum Aufhängen. Mit Bildern verschönern sie ihr Interieur. Das Wort Interieur ist denn auch eines ihrer Lieblingswörter. Überhaupt stehen sie auf Fremdwörter, die man durch die Nase aussprechen muss, und es macht sich für jeden Künstler bezahlt, wenn er seine Bilder mit englischen oder französischen Titeln versieht. Hauptsache: hip oder schick. Das gibt dir diesen Hauch von Weltläufigkeit, ohne den du im Kunstbusiness sofort als Irrenhauskünstler abgestempelt bist, oder schlimmer noch: als malende Hausfrau. Du kannst malen, wie du willst und was du willst: mit den Bildern allein erreichst du noch nichts, mit den Bildern allein machst du dich höchstens zum Bettler und handelst dir ein sogenanntes Imageproblem ein. Es braucht schon sehr viele Zutaten, damit die Kunst als solche gewürdigt wird. Zum Beispiel Information. Zum Beispiel Kontakte. Das gesellschaftliche Drumherum, das Geschwätz, die Wichtigtuerei. Fast mehr noch als die Bilder schätzen die Kunstliebhaber den Ausstellungskatalog. Mit ihm können sie sich im Gedränge der Vernissage Luft zufächeln. Wenn das dann auch noch cool aussieht, sind sie restlos glücklich und verzeihen dir deine schlimmsten Marotten. Er ist halt Künstler, sagen sie. Er hat keine Manieren. Oder besser gesagt: er hat spezielle Manieren. Er trinkt den Campari ohne Strohhalm, und seine Fingernagelränder sind schwarz. Aber malen, das kann er.
Seppli wird mich am Bahnhof abholen kommen. Ich weiss, dass er darauf bestehen wird, den Ort nach einer Fressbeiz abzuklappern. So wie ich ihn kenne, wird ihm das ganz spontan einfallen. He, wie wär’s? Wolltest du nicht schon immer eine richtige Fressbeiz kennenlernen? Wie wär’s mit einem Silvestermenü? Am besten etwas Regionales, mit Kutteln? Natürlich werden wir darauf verzichten müssen. Am Silvesterabend spontan in eine Beiz gehen, um etwas Währschaftes zu essen? Vergiss es! Die Beizen werden gerammelt voll sein. Und die einzigen unbesetzten Plätze werden natürlich reserviert sein, nicht für Spontangäste, sondern für Gäste, die sich frühzeitig angemeldet haben. In der grössten Winterkälte werden wir also durch Schindboden marschieren und unter jedem Wirtshausschild in die erleuchteten und von Eisblumen überkrusteten Butzenscheiben spähen, und Seppli wird die Faust im Sack machen, und die Augen werden ihm tränen von der Kälte. Reserviert hat er wohl nichts. Seppli plant nie, er improvisiert mit dem grössten Vertrauen in die jeweiligen Umstände. Das zeugt von Unbekümmertheit, könnte man denken. Oder von Leichtsinn. Aber so einfach ist es nicht. Nach Belieben nimmt sich Seppli Dinge vor, die er nie geplant hat. Nicht einmal andeutungsweise hat er diese Dinge auch nur in Erwägung gezogen. Er redet ins Blaue hinein, und in seiner verquasten Spontanität beruft er sich auf Überlegungen, die man ihm abkauft, weil sie weder blauäugig noch verquast sind. Als sein eigener Advokat wirkt Seppli überzeugend. Er lässt keinen Zweifel daran, dass er glaubt, was er sagt, dass seine Worte nicht einfach aus der Luft gegriffen sind, sondern wohlüberlegt. Infolgedessen überlässt man ihm bereitwillig das Feld. Man lässt ihn machen. Was er sagt, hört sich vernünftig an. Dass es in der Realität, also ausserhalb des blossen Argumentierens, nicht trittfest ist, merkt man erst später. Wenn es zu spät ist. Seppli geht niemals von realistischen Annahmen aus. Realistisch ist für ihn das, was ihm gerade durch den Kopf geht, also im Prinzip auch Blödsinn. Und er ist verteufelt gut darin, von einer Sekunde zur andern irgendeine oberschlaue Begründung aus dem Hut zu zaubern, um sich im Schlamassel seiner Fehleinschätzungen auf die sichere Seite zu bringen. Vernunft kann man ihm nicht attestieren, Schlauheit schon. Ist Seppli ein Chaot? Ja und nein. Momentweise gelingt es ihm, einen geordneten Eindruck zu machen. Er zückt seine Agenda und trifft Abmachungen, die meistens nur so lange gültig sind, wie sie ihm keine allzu feste Verbindlichkeit abverlangen. Sobald er etwas ernst nehmen muss, weil es nicht mehr zu umgehen ist, verwirft er es blitzartig und bringt eine neue Idee ins Spiel. Was dabei herauskommt, kann man sich ja denken. Seine Planlosigkeit ist kaum zu beschreiben. Sie ähnelt verdächtig ihrem Gegenteil. Er habe ein Konzept, hat Seppli am Telefon behauptet, er male so und so. Das sei sein Konzept. Was ich davon halte. Aber du malst doch gar nicht, habe ich eingewendet. Du stellst ein Konzept auf, das ist alles.
Du bist eben ein Bürotiger, hat mich Seppli am Telefon abgekanzelt. Du hast keine Ahnung, was Arbeiten bedeutet. Bei dir läuft das anders. Bei dir sagt der Chef, was du zu tun hast, und er schreibt dir haarklein vor, wie du vorzugehen hast, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, und das Ziel ist schon da, bevor du dich überhaupt mit ihm auseinandersetzen musst, so wie auch dein Bürostuhl schon da ist und die ganze Firma, für die du arbeitest. Du bist ersetzbar und im höchsten Grade manipulierbar. Man zieht an deinem Schlips - und du spurst. Man gibt dir einen Tritt in den Hintern, wenn du einschläfst. Und hast du, unter welchen Repressalien auch immer, eine Arbeit erledigt, so bist du damit noch lange nicht aus dem Schneider, denn jetzt kommt das Nachspiel, die sogenannte Selbstevaluation, ein Verfahren, das übrigens Stalin erfunden hat. Du bekommst einen Qualifikationsbogen ausgehändigt, auf dem du deine Leistung hinsichtlich der erledigten Arbeit mit einer Punkteskala von eins bis zehn bewerten sollst. Natürlich wirst du niemals eine Zehn ankreuzen, weil du dich als ehrlich und bescheiden einschätzt und die Offenheit, die der Qualifikationsbogen suggeriert, nicht ausnützen möchtest. Und natürlich hegst du die grosse Hoffnung, dass dein Chef, der manchmal überraschend nett sein kann, dein Entgegenkommen zu würdigen versteht. So hält er dich unter Kontrolle und versucht dein psychisches Selbstbelohnungssystem anzureizen. Dabei besteht deine ganze Tätigkeit ja nur darin, eine plumpe Vorgabe zu erfüllen. Wenn du von Arbeit redest, redest du nicht von Arbeit, sondern von einer Methode, Schablonen auszumalen. Fast jede Erwerbstätigkeit besteht im Grunde aus nichts anderem. Man malt Schablonen aus. Man tut etwas, das auch ein anderer tun könnte. Und weil du das nicht begreifst, unterstellst du mir Arbeitsunwilligkeit. Damit liegst du definitiv falsch. Eigentlich bin ich ein Schwerarbeiter. Während andere Leute die Arbeit machen, die sie bekommen, mache ich mir meine Arbeit selber. Niemand gibt mir diese Arbeit, und niemand steigt mir auf den Rücken mit Anweisungen und Lohnanreizen. Niemand plagt mich mit Qualifikationsbögen und läppischen Arbeitsanreizen. Ich bin selber dafür zuständig, dass ich meine Arbeit erledige, ich bin mein eigener Chef und werde bei mir selber vorstellig, wenn ich ein Arbeitszeugnis brauche. Die Zutaten für die richtige Arbeit sind mir noch unbekannt, aber ich werde daran arbeiten, am richtigen Arbeitsrezept, so wie ich auch an der Motivation arbeite, indem ich mir zum voraus ein gutes Arbeitszeugnis ausstelle. Freilich ist das gar nicht so einfach. Worauf soll sich denn die Bewertung abstützen, wenn noch gar nichts da ist, das ich bewerten könnte? Ist sie nicht da, die Arbeit, so ist es auch nichts mit der Bewertung, die dieser Arbeit einen Sinn attestieren könnte. Demzufolge ist das Arbeiten blockiert, und ich muss über die Bücher gehen, weil da nämlich etwas Grundlegendes nicht in Ordnung ist mit mir, mit meiner Arbeitsmotivation. Daran siehst du, dass meine Arbeit nichts Vorfabriziertes ist. Wüsste ich jederzeit Bescheid über mein weiteres Vorgehen, so wäre ich nicht Künstler, sondern Bürogummi oder Hosenverkäufer. Ich sei arbeitsunwillig, sagst du. Eine kühne Behauptung! Dir entgeht eben, dass ich schon längst zu arbeiten begonnen habe. Wo du mich noch jammern hörst, bin ich schon mitten in der Arbeit drin. Sie hat mich am Wickel. Es ist die Arbeit, die der eigentlichen Arbeit vorangeht, die Präventivarbeit. Sie beugt dem Misslingen vor, indem sie es schon mal in Rechnung stellt.
Meine Komplikationen, hat Seppli am Telefon gesagt, sind in einem Künstlerleben nichts Ungewöhnliches. Sie haben eine einfache Ursache. Sie sind entstanden, als ich mir vorgenommen habe, zu malen. Und jetzt halten sie an. Mein Alltag ist weitgehend bestimmt durch das, was ich An die Kunst denken nenne. Meine Kunst, die sich gedanklich vorformt, ehe sie zum Gegenstand einer Handlung wird, kann es kaum erwarten, dass meine Schädeldecke knackend aufspringt und ein fertiges Bild in die Welt entlässt. Ich brenne darauf, dass sich meine Kunst, die so lange im Verborgenen geschlummert hat, explosionsartig enthüllt. Aber das tut sie natürlich nicht, nicht so ohne weiteres. Noch nicht. In diesem Stadium entsteht nichts Fertiges, kein Finitum, sondern lediglich eine Stimmung, aus der sich eine gewisse innere Empfänglichkeit ergibt, die das Kunstmachen zwar nicht immer begünstigt, aber doch zumindest nicht verunmöglicht. Man könnte dieses Stadium als ein Schweben zwischen verschiedenen Möglichkeiten beschreiben. Die Gedanken schweifen, sie erproben, inwieweit sie der Kunst, die ich vorhabe, gewachsen sind, aber diese Gedankenarbeit ist noch keine Arbeit im eigentlich Sinn, die Arbeit im eigentlichen Sinn entsteht erst bei völliger innerer Freiheit des Denkens, die in diesem Stadium erst angedeutet, aber noch weit davon entfernt ist, eine tatsächliche Form anzunehmen. Die eigentliche Arbeit kommt aus der Musse. Dem Schweifen der Gedanken, den täglichen Handhabungen. Beim Einkaufen, Salatrüsten und Raviolikochen denke ich immerzu an die Kunst, ohne an etwas Bestimmtes zu denken, ich denke ans Machen, ohne daran zu denken, dass ich mir unter dem Machen schon irgendetwas vorstellen könnte, etwas Machbares zum Beispiel, ja, die Vorstellung an sich ist mir noch völlig fern, das Machen schwebt mir lediglich als Hohlform vor, als etwas Unbestimmbares, und dann - dann kommt mir plötzlich eine Eingebung, ich stosse durch, ich renne zu meinem Notizbuch und kritzle ein Sätzchen hin. Zum Beispiel:
Der Apfel ist kein Gemüse.
Der Apfel ist kein Gemüse... Ein Ruck befördert mich aus meinen Gedanken. Die Dächer neben dem Bahnhof sind mit Schnee bedeckt. Da bin ich also. In Schindboden.
2008
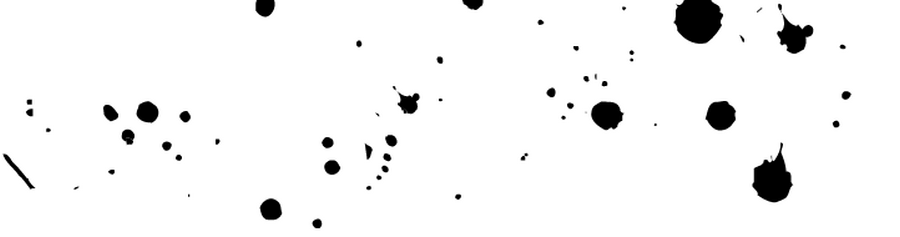 wörter
worte
wörter
worte