Die Ferienkolonie
Mehlschwalben überfliegen das Wasser im Tiefflug. Es ist flach wie ein Blech. Zwischen den Uferweiden steht der Professor aus St. Gallen und wirft seine Angelschnur aus. Sobald ein Ruck durch die Angel geht, haspelt er mit hochrotem Kopf die Schnur auf, an der etwas Lebendiges hin und her schiesst, sich zappelnd zur Wehr setzt. Gegen Abend kommt er mit einem Eimer voller Weissfische in den Palazzo zurück. Er klopft bei uns an, zeigt seinen Fang vor: die Fische liegen dicht übereinander. Als wären sie mit Sprengstoff getötet worden. Der Professor schiebt seine Brille auf die Stirne hinauf. Er grinst wie ein Pferd, und dann legt er los. Er redet über Plinius und die Bedeutung der Weissfische in der Antike. Seinem Redeschwall ist kaum Einhalt zu gebieten. Mutter und Vater versuchen ihn abzuwimmeln. Schliesslich geht er. Aber einen Weissfisch hat er dagelassen: es ist das Zugeständnis, das wir gemacht haben, um den Professor loszuwerden. Der Fisch soll nun auf den Tisch kommen. Mutter hat keine Ahnung, wie sie das anstellen soll. Sie müsste den Fisch zuerst ausnehmen, ihn so zurechtmachen, dass er einigermassen schmackhaft aussieht. Ständig sagt sie: der schaut mich so komisch an, bis ihr Vater das Messer aus der Hand nimmt und dem Fisch, den er nur mit den Fingerspitzen zu berühren wagt, hastig den Bauch öffnet. Sofort quillt alles heraus: Gedärm, Galle, Herz und Niere, und dazu ein grünlicher, blasiger Schleim, der auf den Fussboden tropft. Danach versaut uns der Fisch auch noch die Bratpfanne. Als er dann endlich auf dem Servierteller liegt, ist uns der Appetit gründlich vergangen. Wenig später stattet uns Kater Mischmasch - wir nennen ihn so wegen seines gemischtfarbigen Fells - wie zufällig einen Besuch ab.
Im Stockwerk über uns wohnen die drei Cousinen. Unmöglich könnte ich leugnen, dass sie mit uns verwandt sind, es wäre zwecklos. Immer sind sie in unserer Nähe. Sie gehören in den Zuständigkeitsbereich meiner Schwester. Wenn die Mädchen zusammen etwas aushecken, halte ich mich meistens heraus. Halte mich vornehm zurück. Die Cousinen sind zwar nett, aber alles, was sie tun, ist mit besonderen Umständen behaftet, erfordert Rücksichten und Vorsichtsmassnahmen. Es sind sehr empfindliche Geschöpfe. Jederzeit droht eine Verkühlung. Mückenstiche entwickeln sich zu Infektionen. Bienen und Wespen sind eine tödliche Gefahr. Blütenpollen lösen Allergien aus. Trinkwasserkeime führen zu Durchfall. Ein harmloser Schnupfen wird zur Bronchitis. Aus der Bronchitis wird ein Ohrenbrennen. Aus dem Ohrenbrennen ein Schnupfen. Dass die Cousinen überhaupt noch leben, grenzt an ein Wunder. Sie schlottern, wenn sie ins Wasser gehen, und sie schlottern, wenn sie wieder herauskommen. Im Schatten verkühlen sie sich, und ein Sonnenstrahl genügt, um ihnen die Haut zu verbrennen. Selbst beim Schwimmen tragen sie ihre Sonnenhüte. Aus dem Kreis der Gesunden und Gebräunten, die sich sorglos in der Sonne räkeln, sind sie von Geburt auf ausgeschlossen. Ihre Mutter umhegt und pflegt sie mit tausend Pflästerchen, Salbeien und Tinkturen. Und damit diese medikamentöse Mutter schön auf Trab bleibt, lösen sich die Cousinen im Kranksein pflichtschuldigst ab: kaum ist die eine wiederhergestellt, beginnt schon die nächste zu husten oder übergibt sich am Esstisch.
Beim Schreibspiel sind die Cousinen sehr gewitzt. Ihre Wehwehchen sind dann mit einem Schlag vergessen, wie ausradiert, kein Niesen oder Husten stört die heitere Runde. Niemand übergibt sich oder kippt vom Stuhl. Alle sind bei der Sache. Das Spiel geht so: wir nehmen ein Stück Papier, das wir einmal oder mehrmals herumgehen lassen. Wer das Papier in die Hand nimmt, schreibt einen zweiteiligen Satz. Danach wird der obere Satzteil so umgefalzt, dass man ihn nicht sieht, und der untere Satzteil bildet dann die Nahtstelle für den nächsten Satz. So entsteht eine Geschichte, die sich unberechenbar dahinschlängelt. Bis zum Schluss wissen wir nicht, wovon sie handelt. Dann aber wird das mehrfach versiegelte Geschichtchen entsiegelt, jemand liest vor, und alle finden das Geschichtchen entsetzlich lustig, alle greifen nach dem Zettel, um das Unglaubliche mit eigenen Augen zu sehen.
Herr Mohr, ein Primarschullehrer aus Glarus, ist der stolze Vater einer Meute Buben und Burschen, von denen der jüngste vielleicht sechs, der älteste vielleicht vierzehn ist. Für uns sind es einfach die Burschen aus der Innerschweiz, und wieviele es sind, weiss vermutlich nicht einmal Herr Mohr. Hat er sie jemals gezählt? Manchmal verlädt er die ganze Meute in ein Gummibötlein und rudert sie auf den See hinaus. Obwohl das Gummibötlein bei diesen Ausfahrten bedenklich überladen ist und fast umkippt, werden wir mehrmals angefragt, ob wir nicht Lust hätten, mitzufahren. Die drei Cousinen lassen sich nicht dazu bewegen, aber meine Schwester findet die Burschen lustig, und ich bin eigentlich auch nicht abgeneigt. Das Unternehmen ist nämlich gar nicht so blödsinnig, wie es scheint, es ist ein physikalisches Experiment. Sagt jedenfalls Herr Mohr. Als uns Herr Mohr in das Gummibötlein zu den Burschen gepackt hat, rudert er trotz Schräglage und eindringendem Wasser ein Stück am Ufer entlang. Das Vergnügen dauert nur kurz. Als Herr Mohr das linke, zu stark belastete Ruder in einer verzweifelten Kraftanstrengung abrupt nach oben reisst, kippt das Bötlein ganz plötzlich um, und Herr Mohr verliert seine Brille.
Mit der Luftmatratze unter dem Arm steht er wie verloren am Ufer. Für die Wasserratten ein gewohnter Anblick. Wenn Onkel Willi ins Wasser geht, geschieht das sehr zögerlich. Manchmal dauert es eine halbe Stunde, bis er überhaupt nur seine Unterwaden benetzt hat. Manchmal tunkt er nur seinen Fuss in den See, schüttelt den Kopf und trottet mit der Luftmatratze unter dem Arm wieder davon. Später findet man ihn vielleicht am Gartentisch oder in der Wohnung, wo er sich ein Bierchen genehmigt, und wenn man ihn fragt, weshalb er nicht im Wasser sei, meint er nur, er sei doch kein Teebeutel. Onkel Willi ist wasserscheu. Und er ist das, was man ein Original nennt. In den Ferien trägt er immer ein weisses Touristenhütchen und ein gestreiftes Matrosenleibchen. Begleitet man ihn ins Dorf hinauf, wo er regelmässig seine Brissagos einkaufen geht, wundert man sich über seine Gleichgültigkeit den Einheimischen gegenüber. Die verhutzelten Ticinesi-Weiber im Kleinkram-Laden um die Ecke gaffen ihn an, als käme er von einem andern Planeten. Wahrscheinlich halten sie ihn für einen Ostfriesen, der sich das Bärtchen eines Grosswesirs angeklebt hat, um nicht aufzufallen. Seinen drei Töchtern sieht er sehr ähnlich, er ist schmächtig und blass, eine halbe Portion. Trotzdem darf man ihn nicht unterschätzen. Vor allem nicht seinen Sarkasmus. Aus dem Herrn Mohr macht er den "Herrn Näger" oder den "Herrn Mohrekopf". Den Namen nimmt er beim Wort. Und das nicht etwa nur einmal, sondern bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit - und ohne jede Rücksicht auf das allgemeinmenschliche Humorverständnis. Jeden seiner Wortwitze reitet er buchstäblich zu Tode.
Ein Wind rauscht durch die Bäume, und an den Vorhangstangen klappern die Vorhänge. Schon früh am Morgen verschwindet das gegenüberliegende Ufer in einer grollenden schwarzen Wolke, die sich rasch nähert. Niemand getraut sich jetzt noch ins Wasser. Jede Freiluftaktivität fällt aus, wird ausgesetzt. Man bleibt im Palazzo, verkriecht sich, schlüpft unter, zündet die Lampen an. So rückt man zusammen, während das Unwetter näher und näher kommt. Das Frühstücksgeschirr ist noch nicht einmal abgeräumt, da stellt Mutter schon eine Flasche Gianti auf den Tisch. Onkel Willi schlägt die Basler Zeitung auf: sein Leibblatt. Er hat sie abonniert. Dank einer speziellen Zustellungsvereinbarung bekommt er sie täglich in sein Feriendomizil geliefert. Zeitunglesen ist für ihn etwas Öffentliches. Jeden Artikel, den er für mitteilungswürdig hält, liest er laut vor. Niemand, der mit ihm frühstückt, kommt darum herum, über alles Mögliche und Unmögliche informiert zu werden. Doch heute geht Onkel Willis Darbietung unter. Gegen das Donnerkrachen kommt er nicht an. Mutter schenkt ihm Gianti ein. Meine Schwester und ich zählen die Sekunden, die zwischen Blitz und Donner vergehen. Die drei Cousinen starren aus dem Fenster. Windböen peitschen den See, bis er ganz zerfurcht ist, ein grünliches Gebrodel. In den Bäumen schauert es. Blitze gabeln sich in alle Richtungen, wir verzählen uns, wissen nicht mehr, welcher Donner zu welchem Blitz gehört, und schliesslich prasselt der Regen so laut, dass er den Donner übertönt.
Schon am Nachmittag ist der Spuk vorbei, es scheint wieder die Sonne, als wäre nichts gewesen. Und es wird heisser und heisser.
Niemand von uns zweifelt daran, dass der Sommer 1983 einen Hitzerekord ausbrütet. Ja, dieser Sommer wird in die Geschichte eingehen. Als Übersommer. In Basel misst man 38 Grad, und im Tessin ist es auch nicht viel besser. Morgen für Morgen brummelt Onkel Willi hinter seiner Basler Zeitung etwas von "steigenden Temperaturen".
Wir sind nicht zum ersten Mal hier - und bestimmt auch nicht zum letzten Mal. Unser Domizil teilen wir mit Feriengästen aus der ganzen Schweiz. Es ist ein weitläufiger, etwas heruntergekommener Gebäudekomplex, den die Einheimischen Palazzo Grande nennen. Für uns ist es eine Ferienkolonie. Die Wohnungen sind sehr individuell, kein Raum ähnelt einem andern, und die Möbel sind einfach und zweckdienlich, Plastiktischtuch und Brockenstuben-Wäscheständer inbegriffen. Die Küchenbenutzung beschränkt sich auf die Herstellung sommerlicher Leichtkost, zum Beispiel auf das eilige Zusammenrühren von Gurkensalat und Dosenfisch. Backöfen gibt es keine, dafür aber leistungsfähige Kühlschränke mit Eisfächern, in denen man die Gelati einlagern kann. Wenn man Glück hat, erwischt man eine Wohnung, in der der Kühlschrankkompressor wohltuend leise vor sich hinsummt. Die meisten dieser Kühlschränke bullern wie Schiffsmotoren, was vor allem nachts ein wenig lästig sein kann. Für die im Tessin gar nicht so seltenen Regenwetter-Perioden ist vorgesorgt. In der muffigen Tiefe irgendeiner abschliessbaren Schublade, die ein bisschen klemmt und mit vergilbtem Geschenkpapier ausgekleidet ist, findet man verschiedene, schrecklich altmodische Brettspiele mit bunten Hütchen und Kegelfigürchen - und natürlich auch das obligate Jasskartenset. Wie gesagt, das ganze Gebäude ist alt und etwas marode, würde es in Venedig stehen und nicht am Lago Maggiore, so müsste man befürchten, dass es bald einmal in den Fluten versinkt. Von den Wänden blättert die Bemalung. In den Fugen und Rissen krabbeln Ameisen. Wenn im Dorf oben die Eisenbahn vorüberfährt, rieselt immer irgendwo Mörtel herunter. Meistens über den Betten. In den Dachlukarnen gibt es Einflugslöcher für Eulen und Käuzchen, und die kleinen Balkone, die selten jemand betritt, sind mit Taubenmist besprengt. Gleich neben dem Palazzo beginnt der Gemeinschaftsgarten, der sich in Stufen und Windungen zum Lago Maggiore hinabzieht. Ein Seeanschluss, wie man ihn sich nur wünschen kann. Der für die Feriengäste reservierte Badeplatz befindet sich unterhalb einer grob gefügten Mauer. Dort ist das Ufer steinig und mit Bäumen bestanden.
Ich habe mich mit einem Deutschen angefreundet. Er wohnt mit seinen Eltern in einem adretten Ferienhäuschen. Er heisst Uli. Wir erkunden das verwinkelte Dörfchen, das zu beiden Seiten des Gartens jäh am Wasser endet. In Ronco, weiter oben am Berg, durchstöbern wir den Schutt der zerfallenen Tessinerhäuschen. Ich finde einen rostigen Schlüssel. Uli kramt zwei Zigaretten hervor. Da ich nicht mitrauche, raucht er stereo. Ich sage ihm, dass ich lieber Stumpen rauche. Danach trinkt er Cola, um den Brechreiz zu dämpfen. Wir sind dreizehn Jahre alt, und mit der Schule tun wir uns schwer, überhaupt mit allem, was obligatorisch ist. Das verbindet uns.
Uli und die Burschen aus der Innerschweiz wollen mich für das Ferien-Grümpelturnier gewinnen. Anfangs sträube ich mich, ich bin nicht so der Sportstyp, aber dann lenke ich doch ein. Immerhin bin ich ein gutes Stück grösser als die meisten meiner Mitspieler und insofern in einer überlegenen Position. Wir trainieren auf dem grossen Rasenplatz vor dem Haus. Wir trainieren hart. Wenn ich am Ball bin, presche ich mit knackenden Kniegelenken voran. Die Burschen aus der Innerschweiz haben keine Chance. Ich renne sie um, hacke sie nieder. Mein Dribbling hinterlässt eine Blutspur. Doch die Ballabgabe ist dann wieder eine andere Sache. Der Ball, den ich eigentlich Uli zuspielen will, entwischt in hohem Bogen, durchbricht eine Blätterwand, knickt die Blumen, fliegt über die jungen Granatapfelbäume hinweg, zerstört die Melissen, fetzt durchs Gurkenbeet, klatscht in die Tomaten, überrollt die Salatköpfe und bleibt dann irgendwo neben den Rabatten liegen. Ich gehe ihn holen. Der Garten umbraust mich mit seinen Geräuschen. Bienen summen. Irgendwo zischelt die Sprenkleranlage. Ich nehme den Ball. Geduckt schaue ich mich um. Ich stolpere über einen Spaten. Unter einer Tomatenstaude liegen zwei umgestülpte Gärtnerhandschuhe. Ich habe Glück: um diese Tageszeit ist das Risiko recht klein, beim Betreten der "Betreten-Verboten-Zone" erwischt zu werden. Der bucklige Gärtner, der hier manchmal den Aufpasser spielt, ist vorwiegend dämmerungsaktiv. Wenig später bin ich wieder auf dem Rasen. Weit und breit niemand zu sehen. Ich frage mich, was los ist. Habe ich etwas verpasst? Ich gehe zum Palazzo, und auf der Eingangstreppe kommt mir Uli entgegen. Er gibt sich betont gleichgültig. Im Durchgangsbereich des Parterres stehen die Burschen aus der Innerschweiz noch immer Spalier. Irgendetwas hat sie dazu gebracht, in zwei Reihen Aufstellung zu nehmen. Es sei jemand eingezogen, informiert mich Uli. Als die Burschen, ohne Hast, als wäre nun alles geregelt, auf uns zukommen, bringt der Kleinste von ihnen den Sachverhalt klar auf den Punkt: lauter Mädchen, und zwei davon sind ein echtes Kuriosum!
Wenig später ist das Kuriosum öffentlich zu besichtigen. Es hat zwei Köpfe und vier Arme. Es schlenkert mit allen vier Beinen, während es auf einem Mäuerchen sitzt und vorwitzig Umschau hält. Es ist eine Laune der Natur. Es zieht alle Blicke auf sich, und doch gibt es sich ganz unbefangen. Das Kuriosum weiss, dass es kurios ist. Es weiss gut über sich Bescheid. Etwas hastig beantwortet es die üblichen Fragen, etwas hastig erzählt es die üblichen Verwechslungsgeschichten. Der eine Mund fällt dem andern Mund ins Wort. Die beiden Hälften biegen sich auseinander, schliessen sich wieder zusammen. Die eine Hälfte trägt ein rotes Badkleid, die andere Hälfte ein blaues. Jede Hälfte für sich betrachtet ergibt natürlich ein Ganzes, aber sobald die andere Hälfte hinzukommt, hat man etwas Zweiteiliges vor sich, ein Ganzes aus zwei Teilen. Es sind eineiige Schwestern, die einander so ähnlich geraten sind wie zwei Eier, ohne ihre Farben könnte man sie kaum auseinanderhalten. So etwas habe ich bisher nur im Fernsehen gesehen. Jeder kennt natürlich das Doppelte Lottchen oder die Kessler-Zwillinge. Aber so etwas im echten Leben zu sehen, ist schon recht eigentümlich. Ausserdem sind Zwillinge mein Sternzeichen, mein magischer Talisman. Gut möglich, dass die beiden ein bisschen zaubern können. Vielleicht bringen sie mir ja Glück. Sehr schnell ist alles über sie bekannt. Zum Beispiel dass sie aus der Gegend des Vierwaldstättersees kommen und eine ältere Schwester haben, die im Gegensatz zu ihnen kein Naturwunder ist. Sie ähnelt höchstens sich selbst. Die Familie heisst Vogel oder so ähnlich, eine Proletenfamilie, die Mutter ist Mutter, und der Vater ist Lastwagenchauffeur.
Gleich neben dem Palazzo befindet sich der Rasenplatz mit den Gartenstühlen und dem Ping-Pong-Tisch. Auf dem seewärts gelegenen Mäuerchen flitzen Eidechsen herum. Der Weg zum See führt zuerst durch einen schattigen Laubengang. Man geht unter Weinranken hindurch. Die Trauben sind im Hochsommer noch mickrig und grün, wenn überhaupt sichtbar. Die Bodenplatten sind kühl. Vögel schwirren querbeetein, Blumen, wohin man blickt. Zwischen den Zypressen lachen Verbenen, Petunien und Kamelien hervor. Dann taucht eine gewundene Treppe in den Gemüsegarten. Von früh bis spät läuft hier eine Sprenkleranlage, zischend und in schwenkenden Bögen verteilt sie das Wasser über einige Dutzend Meter hinweg. Mit etwas Glück bekommt man eine Gratis-Dusche. Der bucklige Gärtner verstellt sie häufig. Jeden Morgen kürzt oder verlängert er den Schlauch, indem er ihn auf- oder abrollt. Der ständige Sprühregen zieht Schnecken an. Einzelne Beete sind abgedeckt. An den Kletterrosen, die die Treppenmauer überwuchern, gaukeln Schmetterlinge auf und ab. In den Sonnenflecken leuchten ihre Flügel. Es riecht nach Geranientöpfen. Am Ende der Mauer steht eine zerlöcherte Giesskanne. Hier hört die Treppe auf. Zwischen kurzgeschnittenen Zitronenbäumchen läuft ein Kiesweg zum Ufer hinab. Man hört schon das Geplätscher, riecht das Wasser. Hinter Millionen von Blättern glitzert es in den dunstigen Himmel hinein. Wo der Gemüsegarten endet, beginnt ein Unkrautparadies, das die angehäuften Gartenabfälle umwuchert, die herausgejäteten Stauden und das moderige Holz. Hier wimmelt es von Ameisen. In den Komposthaufen schmatzt noch die Nässe eines Gewitters, das sich längst verzogen hat. In den stachligen Büschen ringeln sich Schlangen, tanzen winzige Skorpione mit Drohgebärden umeinander herum und durchwühlen Totenkäfer die Erde. Aus kotigen Grabkammern lassen sie neues Leben entstehen. Das ist der Garten. Zuletzt passiert man noch den Durchgang in der dicken Ufermauer, eine abschüssige Höhle, die an ihrem unteren Ende mit einem schweren Eisengatter verschlossen werden kann.
Kommt man dort hinaus, hat man die Füsse schon fast im Wasser.
Im Uferbereich gibt es einen Wall aus aufgehäuften Steinen, der nur knapp unter der Wasseroberfläche in den See hineinführt. Man geht dort auf einer geraden Linie, geht halbwegs trocken in die Schwimmzone hinein, indem man sich mit den Füssen vortastet. Die Steine sind recht gross, halbe Felstrümmer. Dort, wo die Füsse keinen Halt mehr bekommen, weil die gerade Linie absinkt, sieht man, wie sich der Wall in einem Abwärtswinkel in die dunkelolivgrüne Tiefe hinein fortsetzt. Wenige Meter weiter draussen sind die Trümmer fast nicht mehr zu sehen, nur ganz schwach schimmert da und dort noch etwas, das wie Moos aussieht, eine Granitkante blitzt auf, Fische flitzen vorüber: ein bisschen weiter noch, und man blickt ins Bodenlose. Beim Hinausschwimmen sind es vor allem diese Übergänge, die den Blick immer wieder nach unten ziehen. Ist man ausserhalb des Uferbereichs, entspannt man sich automatisch. Stehen oder sich abstossen kann man hier nicht mehr. Man ist ganz auf seine eigene Kraft angewiesen, und das tut gut. Hier dümpeln die Bojen, und gelegentlich liegt ein Boot vor Anker. Mit ein paar Schwimmzügen verschafft man sich Weite. Wie man sich auch dreht, überall hat man es mit dem gleichen zähen Element zu tun. Unmerklich zieht es am Körper, eine grünliche Masse mit vielen kleinen Bewegungen an der Oberfläche. Man kommt in eine warme oder kalte Strömung, in die leichte Drift nach Süden. Das Wasser schwappt dumpf um einen herum, während der Uferstreifen mit seinen Bäumen und Häusern dasteht wie eine Kulisse, eine andere Welt, die langsam kleiner wird. Mehr und mehr wendet man sich von dieser Spielzeugwelt ab. Das Hinausschwimmen hat etwas Hypnotisches. Der See ist zwar viel länger als breit, und trotzdem scheint das andere Ufer Lichtjahre entfernt. Weit entfernt liegen auch die beiden Brissago Inseln, zwei undeutliche Tupfer im hellen Geglitzer.
Wenn auf dem Rasenplatz nichts los ist, sitze ich dort irgendwo im Schatten und lese. Das Buch, das ich lese, kennt ausser mir niemand. Ich will damit sagen: ich kenne niemanden, der es auch kennt. Es ist ein Buch für Kenner und Eingeweihte. Dort, wo darüber befunden wird, was man gelesen haben muss, scheint dieses Buch überhaupt nicht angesagt zu sein. Wer es liest, muss es verstecken oder so tun, als sei es ihm einfach so in die Hände gefallen. Dieses Buch kann man ja gar nicht lesen wollen! In unserer Dorfbibliothek gehört es zu den Büchern, die man im Keller eingelagert hat, weil sie kaum verlangt werden. Es trägt den merkwürdigen Titel “Der Herr der Ringe”. Die grüne Billigbroschur mit dem langweiligen Coverbild wirkt wohl abschreckend. Ich habe mal mit dem zweiten Band angefangen. Bis jetzt finde ich die Geschichte gar nicht so übel, sie hat was. Sie ist speziell. Keine Ahnung, weshalb die Leute jeden Schund lesen, aber die guten Sachen verschmähen. Ich habe das Buch für mich entdeckt und freue mich darüber wie ein Dieb. Ständig trage ich es mit mir herum. Eines Vormittags, als ich gerade wieder am Lesen bin, setzt sich Regula zu mir, die Schwester der Zwillinge. Sie rutscht etwas näher, äugt mit schief gelegtem Kopf in das Buch hinein. Ich finde das ziemlich unangenehm. Sie stört mich beim Lesen. Plötzlich fragt sie, ob das ein Liebesroman sei. Ich verneine. Dann klappe ich das Buch zu und verschwinde, so schnell ich kann.
Das Ferien-Grümpelturnier halten wir auf dem Fussballplatz ab, gleich neben der Via alla Chesa, wo die Feriengäste ihre Autos abgestellt haben. Ein Stück weiter unten mündet der Dorfbach in einem kleinen Delta aus Geröll in den Lago Maggiore. Freilich führt der Bach kaum noch Wasser. Da es schon länger nicht mehr geregnet hat, ist der Fussballrasen ziemlich verdorrt. Die Erde ist krustig und hart. Nichts für Weichlinge. Die Burschen aus der Innerschweiz haben sich eine Strategie ausgedacht, eine Abwehrstrategie. Sie betreiben eine defensive Territorialpolitik. Sie mauern ihre Verteidigung total zu. Um den Ball über die Strafraumlinie zu bringen, muss ich die Mauer wie ein Büffel durchbrechen. Uli bekommt den Ball fast nie. Am Ende spielen wir Rugby anstatt Fussball: die Burschen trampeln auf mir herum, während ich den Ball unter meinem Bauch verstecke. Nach diesem unzimperlichen Kräftemessen werden die Mannschaften neu gemischt, und schon geht es nicht mehr so rüde zu. Auch zwei Mädchen spielen mit: Madame Curie, die wir so nennen, weil sie eine Welsche ist, und Regula, die in ausgelatschten Sandalen Fussball spielt und trotzdem ständig das Tor trifft. Den Dicksten in der Ferienkolonie ernennen wir zum Schiedsrichter. Er stammt aus Aarwangen, ein Pöstlersohn. Die Trillerpfeife benutzt er nur, um Stimmung zu machen, und manchmal schleicht er sich mitten in einem Spiel davon, um sich im See abzukühlen.
Was dann jeden Tag für Wettkampfstimmung sorgt, ist nicht etwa Fussball, es ist ein Spiel, bei dem es nicht so sehr auf Körperkraft ankommt. Und Fouls gar nicht erst möglich sind. Ein kompakter weisser Zelluloidball wird über ein Netz hin und her gespielt, der Ball schlägt auf, und man schlägt ihn zurück. So geht es stundenlang. Häufig wird Rundlauf gespielt, bei dem eine ganze Gruppe um den Tisch herumjagt. Wer den Ball erfolgreich abgespielt hat, wechselt die Seite. Wer ihn nicht auffängt oder den Abschlag verhunzt, scheidet aus. Die Burschen aus der Innerschweiz benehmen sich wie ein Wald voll Affen, aber ins Finale kommen sie nie. Meistens hacken sie am Ball vorbei. Die Mädchen können es besser. Besonders gefürchtet sind die drei Cousinen: manchmal treffen sie den Ball derart ungeschickt, dass er in einem widernatürlichen Bogen viel zu hoch über das Netz fliegt, dann aber gegen jede Erwartung doch noch die Tischkante erwischt und daran abprallt wie eine Gewehrkugel. Auf so etwas kann man unmöglich reagieren. Das Gute daran ist, dass die Cousinen auch gegeneinander spielen. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass sie sich gegenseitig ausschalten: was allerdings nicht ganz aufgeht. Fast immer bleibt eine übrig, die man im Finale noch abservieren muss. Am angenehmsten spielt wohl Madame Curie. Sie spielt elegant, ihr Schläger scheint den Ball kaum zu berühren. Regula dagegen spielt wie eine Maschine. Oder um es freundlicher zu sagen: wie eine Chinesin. Zäh und präzis. Ihre Schwestern, die Zwillinge, spielen flink und leicht, flitzen nur so herum, wobei die Rote ein bisschen mutiger spielt als die Blaue, nur eine Nuance, aber doch so, dass man den Unterschied erkennt.
Im Palazzo, im Garten und am Ufer ist wenig davon zu merken. Am Berghang, ungefähr auf der Grenze zu Italien, aber diesseits des Sees, ist ein Waldbrand ausgebrochen. In den klarblauen Himmel wälzt sich eine Rauchwolke. Das Feuer fegt durch die Sträucher und zerkrümelt sie zu Asche. Helikopter sind im Einsatz. Wir beobachten sie in San Abbondio von einer Gartenwirtschaft aus. Uli hat einen Feldstecher mitgenommen. Mit aufgestützen Ellbogen und offenem Mund stiert er durch die Gläser in Richtung Italien. Vater bestellt das zweite Bier. Meine Schwester hat die Kopfhörer ihres Walkmans aufgesetzt und hört zum hundertsten Mal ihre Andreas-Vollenweider-Kassette. Uli, der ganz cool bleibt, reicht mir den Feldstecher. Ich setze ihn an, sehe aber eigentlich nichts: alles verschwommen. Ich schwitze Bäche, während ich mir vorstelle, wie ich die Zwillinge aus den Flammen befreie. Ich rette sie gerade in letzter Sekunde, bevor das Haus über ihnen zusammenstürzt. Ich trage sie auf den Schultern aus dem Inferno heraus, eine links, die andere rechts. Dann korrigiere ich diese Vorstellung, weil sie mir zu anstrengend ist. Ich beschränke mich auf Fränzi, die Zwillingsschwester mit dem roten Badkleid. Wenn ich sie aus den Flammen befreie, genügt das ja eigentlich. Vater wedelt eine Fliege fort. Nervös ruft er: pagare perfavore! Ein mulmiges Gefühl sagt uns, dass das Feuer näher kommt. Hat es schon den nächstgelegenen Waldrand erreicht? Wenige hundert Meter entfernt schiesst ein Helikopter zwischen den Bäumen hervor. Er trudelt weg. Auf der Tischplatte sammeln sich Russpartikel, sie schweben überall in der Luft herum. Im Dorf sperrt die Polizei eine Strasse. Vater gibt grosszügig Trinkgeld, vermutlich kompensiert er damit seine mangelnden Italienischkenntnisse; dann hasten wir den Abhang hinab und durch einen lichten Kastanienwald, der noch nicht Feuer gefangen hat. An unsern Beinen raschelt das dürre Gras, bald sind wir in der Ferienkolonie und in Sicherheit. Mutter erwartet uns schon. Aufgeregt erzählt sie uns, dass ganz in der Nähe ein Waldbrand wüte. Im Radio sei es gemeldet worden. Nein aber auch, sagt Vater, das ist ja schlimm.
Tagsüber sieht man ihn selten. Vielleicht ist er ein Tagschläfer, der nur nachts in die Gänge kommt. Er ist Chemiestudent im letzten oder vorletzten Semester und bereitet sich auf ein wichtiges Examen vor. Kaum ist die Sonne hinter den Bäumen verschwunden, kommt er aus seinem Loch heraus und setzt sich an seinen Stammplatz, auf die Bank neben dem Gartentisch. Dort hantiert er mit einer ausfaltbaren Periodentabelle, kritzelt vor sich hin, kaut an Bleistiften herum, schiebt Fresszettelchen in die Bücher. Den Kindern, die gerade erst lesen und schreiben gelernt haben, erscheint er als Zauberer. Sein Gekritzel verleitet sie zur Nachahmung. Bald ist der ganze Gartentisch mit kabbalistischen, sabäischen, hermetischen und zodiakischen Formeln vollgekritzelt. Das scheint den Studenten zu amüsieren. Wahrscheinlich ist er sich bewusst, dass sein Studienfach für die Allgemeinheit nicht besonders verständlich ist. Eines Abends unterbricht er seine Büffelei, um den Kindern die Welt zu erklären. Die Materie, erklärt er, existiert eigentlich gar nicht. Die Atome sind so ungeheuer winzig und stehen so ungeheuer weit auseinander, dass es eigentlich überall nur Zwischenräume gibt. Atome sind keine Bausteine, sie sind nichts Greifbares, nichts Festes. Wenn wir etwas anfassen, ist die Berührung eine Illusion. Keine Sekunde lang berühren wir überhaupt irgendetwas. Es gibt keine Berührungsflächen. Alles Illusion.... Für die Kinder, die ihm zuhören, ist diese Mitteilung ein Schock. Dass so selbstverständliche Dinge wie Steine, Häuser oder Bleistifte gar nicht existieren, haben sie in der Schule noch nicht gelernt.
Auf dem Rasenplatz werden Tische aufgestellt, Vater und Onkel Willi feuern den Grill an. Die Abendsonne blendet. Schwatzend und lachend schlendern die Feriengäste im Garten umher. Sie schauen auf den goldgesprenkelten See hinaus, geniessen das Sirren der Zikaden, die Blumendüfte, jede Minute, die sie noch hier sein dürfen. Später wird es gemütlich, auf dem Grill brutzelt das Fleisch, eine Girlande mit Lämpchen dient als Festbeleuchtung. Wo das künstliche Licht nicht hinreicht, erscheinen in den Büschen und Bäumen kleine glosende Punkte. Anfangs sind sie schwer auszumachen. Aber wenn sich die Augen mal an die Dunkelheit gewöhnt haben, sieht man die Glühwürmchen überall. Blassbläulich und schwerelos wie Unterwasser-Mikroben gleiten sie durch die laue Schwärze. Onkel Willi zündet sich eine Brissago an. Er steigt auf einen Stuhl, um eine Rede zu halten. Das Tessin, sagt er, sei wunderschön... Er nuckelt an seiner Brissago, klopft die Asche ab, schaut zum nächtlichen Himmel hinauf. Ja, das Tessin.... Nun sei bald wieder Schluss mit Dolce far niente... Die schönen Tage seien gezählt... Den folgenden Satz versteht kaum jemand. Onkel Willi nuschelt irgendwas in sein Bärtchen. Dann aber kommt das Fallbeil: er freue sich halt doch wieder auf die Fasnacht. Und aus dem Hintergrund ruft Vater: du hast doch das ganze Jahr Fasnacht!
1998
(Dieser Text wurde für eine Leseveranstaltung des Efringer Literaturzirkels geschrieben. Das vorgegebene Thema war "Kindheitserinnerungen").
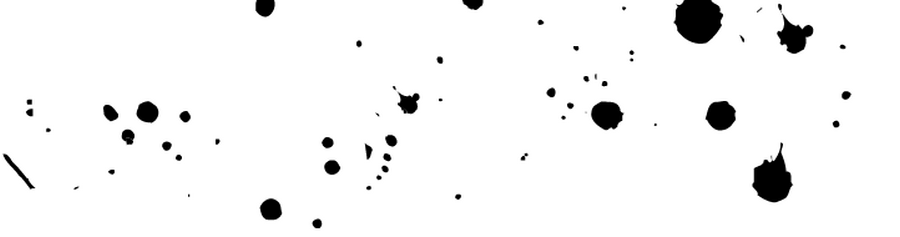 wörter
worte
wörter
worte