Holzbödelihaus
Unscheinbar schmiegt sich das Holzbödelihaus an den weitgeschwungenen Hang. Tannenwaldflecken und Waldblössen, Braunviehweiden und kleine schattige Ziegenklüfte, alles liegt wohlgeordnet nebeneinander, auch Bäche gibt es und Strassen mit endlosen Kurven, Jasskartendächer gibt es und Wiesen, deren aufdringliches Grün an die Jasskartenmatten auf den Wirtshaustischen erinnert. Photographiere ich hinunter auf die parkierten Autos, schiesse ich Bilder, deren Inhalt schräg ist, wie zur Seite gekippt. Am Ganzen bin ich weniger interessiert. Es überfordert mich, es ist zu weit, es hat eine ungeheure Ausdehnung: immer weiter und weiter geht es da auf und ab ohne Ende. Ich habe immer noch mein Reisehemd an. Ich stehe am Fenster und knipse wie ein Anfänger herum, zoome das Braunvieh heran, zoome es wieder weg. Meine Sachen sind ausgepackt, Kopf und Hände habe ich frei bekommen, ich nehme Fühlung auf mit der Umgebung, dem Haus, dem Zimmer. Ich stapfe über den kahlen Holzboden. Jeder Gast existiert hier für sich, in seinem Zimmer, mit einer eigenen Aussicht auf die umliegende Landschaft. Zum Haus gehörig, ein Gast mit Zimmerschlüssel und verbrieftem Gastrecht, so sehe ich mich gerne, es gefällt mir, Gast zu sein, es gefällt mir, eine eigene Aussicht zu haben. Ich schiesse Photos, wertlose Photos, die Aussicht passt nicht in den Sucher, und ich sehe den Tagen und Wochen entgegen, da ich hier entweder zu rotieren beginne vor lauter Nichtstun oder Immer-das-Gleiche-tun, oder die andere Möglichkeit: ich komme zu dieser Umgebung in ein für mich halbwegs akzeptables Verhältnis.
Später, es dämmert bereits, verlange ich an der Theke ein Bier. Die Wirtin trägt eine Tracht mit Schnallen und Schnüren. Was ihr noch fehlt, ist ein Kopfschmuck, ein buntbemaltes Geweih wäre passend. Langsam und bedächtig schiebt sie das schäumende Glas zu mir herüber. Ich bedanke mich, nehme einen langen, langen Schluck, wische mir den Mund ab. Dann stehe ich auf, das Bier in der Hand, von dem ich keinen Blick wende. Ich setze mich an einen der Holztische. Nach ein paar weiteren Schlucken, schiebe ich das Glas von mir weg, hebe endlich den Blick, nehme die Umgebung in mich auf: Hirsch- und Gamsschädel an allen Wänden. Riesige Augenhöhlen. Irgendwie unheimlich, auch wenn es nur Schädel sind, nicht die ausgestopften, glasig vor sich hinstarrenden Bambi-Köpfe, die man in Landgasthöfen so häufig antrifft. Irgendwie unheimlich, diese Schädel mit nichts drin und nichts dran. Sie sind so kahl, wie nur blanker Knochen sein kann. Mir läuft es kalt den Rücken hinab. Ich denke an den Tod. Ist der Mensch nicht auch nur ein Tier? Als ich mein Bier ausgetrunken habe, bestelle ich Rehpfeffer.
Die halbe Nacht liege ich wach. Das Nachttischlämpchen lasse ich vorsätzlich brennen. Ich starre gegen die Decke, die Wände. Alles ist aus Holz, aus schweren Hölzern. Wie eine hyperrealistische Phototapete, die nichts als Furniere zeigt, schwingt sich die Maserung von einer Zimmerecke zur andern. Die überdeutlich gezeichneten Linien beruhigen das Auge. Andererseits wird man selber angeschaut, wenn man sie anschaut. Was hier so fest und kantig um einen herumgebaut ist, lebt sein eigenes heimliches Leben, die geschwungenen Linien sind etwas Gewachsenes, Gewobenes, und die Astlöcher sind wie Augen. Das Holz atmet, es knackt, die Fugen dehnen sich oder ziehen sich zusammen. In der Nacht kühlt das Zimmer ab, und die Wände reagieren darauf wie Lebewesen, die sich durch Häutung oder Pelzwechsel auf eine Klimaveränderung einstellen.
Irgendwann zwischen Wachliegen und Schlaf stehe ich auf, fingere den Film aus dem Photoapparat, setze einen neuen Film ein. Einen ganzen Film habe ich schon verknipst. Fast nicht zu glauben. Ich habe photographiert wie ein Verrückter: Autos, Ausschnitte des Parkplatzes, Braunvieh beim Fressen und Käuen, nichts Landschaftliches. Für diese Landschaft, sage ich mir, braucht man überhaupt nichts übrig zu haben. Sie ist viel zu gross. Eine Zumutung. Man muss an ihr vorbeiphotographieren. Ich stapfe über den kahlen Holzboden. Im Zimmer unter mir muss das zu hören sein. Aber niemand beschwert sich. Vielleicht ist das Zimmer unter mir gar nicht besetzt, ich möchte mich morgen bei der Wirtin danach erkundigen. Es ist mir aufgefallen, dass das Hotel nur schwach belegt ist, das könnte ein Anknüpfungspunkt für ein Gespräch sein. Die Saison läuft schlecht. Wirtschaftskrise und Reiseunlust... Wenigstens ist die Nachtruhe gewährleistet. Die Nachtruhe lässt einen allein, und das ist gut. Im Schlaf ist Alleinsein das Normale, im Schlaf liegt man wie in einer Holzkiste, die genau die Grösse des schlafenden Körpers hat.
Ich trage eine Strickjacke, da ich häufig am offenen Fenster stehe. Die Aussicht mit Verkühlungsfaktor gehört zu meinem Zimmer, und ich mache sie mir photographisch zunutze, so gut es geht. Von hier oben sieht man vor allem die Landschaft, was natürlich dazu verführt, sie zu photographieren. Die Landschaft ist schön, an einem lichten Tag wie heute fast zu schön, zu hell, zu freundlich. Das stichige Grün, wie für einen Landschaftskalender gemacht. Und diese Weite! Die perfekte Photographenfalle. Nein danke, sage ich, bei mir läuft das anders. Ich photographiere mit einer gewissen Kleingläubigkeit. Ich glaube nämlich nicht, dass die Landschaft etwas hergibt. Die Landschaft habe ich einmal angesehen, ganz in mich aufgenommen, und das hat mir genügt. Ich habe sie gleich wieder ausgekotzt. Die Landschaft ist viel zu gross. Sie liegt meinem Interesse fern. Was mich wirklich interessiert, sind die Autos auf dem Parkplatz. Gäste und Personal parkieren da wild durcheinander. Die parkierten Autos gehören wahrscheinlich mehrheitlich dem Personal, die Gäste machen sich in dieser Saison rar. Ganz ausgeblieben sind sie nicht. Manchmal rumort es doch ein wenig im Haus. In der Küche wird gekocht, und auf den Fluren rumpelt das Schuhwerk von Menschen, die zu langen Wanderungen aufbrechen. Ich selber wandere nicht. Ich wandle höchstens. Nein, das ist der falsche Ausdruck. Ich stapfe über den kahlen Holzboden, ich rumple in meinem Zimmer herum. Davon verstehe ich mittlerweilen was. Ich bin ein Holzbodentrampel-Experte. Ich habe herausgefunden, wie stark ich auftreten muss, damit das Holz die richtigen Geräusche macht. Das Zimmer ist ein Holzinstrument.
Es gefällt mir, Gast zu sein, es gefällt mir, eine eigene Aussicht zu haben. Ich schiesse Photos, wertlose Photos, die Aussicht, ein Kitschbild zwischen zwei Vorhängen, interessiert mich nicht als Aussicht, sondern weil ich von hier oben unbeobachtet photographieren kann. Ich schiesse Photos - von Braunvieh, von Autos, manchmal auch von Menschen. Das ist neu. Die wenigen Menschen, die in mein Blickfeld kommen, zoome ich so nah zu mir heran, dass ich ihre Augenfarbe bestimmen kann. Skrupel habe ich keine, ich habe etwas Grausames in mir, eine Kälte, die sich anfühlt wie Hitze: das ist der Jagdinstinkt. Wenn ein Mensch vorbeikommt, bin ich wie ein Tierfänger auf der Pirsch. Ich werfe mein Fangnetz aus. Knips. Hab ich dich. Drei bis vier Gäste in Wandermontur, der Postbote, ein Besucher, ein Lieferant, die Frau vom Wäsche-Service, der Koch, die Wirtin höchstselbst, mit und ohne Tracht, und hin und wieder eine Rotte Jäger, die sich nach der Jagd einen genehmigen wollen. An einem Tag können das bis zu fünfzehn Leute sein. Sie kommen alle in meine Menschensammlung. Sobald es Nacht wird, präpariere ich das Entwicklungsbad. Am nächsten Morgen, wenn ich die Fensterläden entriegle und die Sonne hereinlasse, hängen die Bilder schön gruppiert über meinem Bett. Ich betrachte sie mit Stolz. Meine Trophäen.
Nein, ich bin kein Tierfänger, ich bin Jäger. Ich spähe durch mein Zielfernrohr; so bin ich den Köpfen, die ich auf meinen Rollfilm banne, ganz nah. Ich weiss, dass meine Hand im entscheidenden Moment nicht zittern darf. Die Menschen, die ich aufs Korn nehme, merken nichts, ich tue ihnen nichts, und doch sind sie meine Opfer. Ich erlege sie, lasse sie auf Photopapier ein zweites Leben beginnen. Im Entwicklungsbad, unter der roten Lampe, die ich über dem Schreibtisch montiert habe, kommen sie nach kurzer Abwesenheit wieder zu sich. Obwohl es immer die gleichen Köpfe sind, die ich photographiere, sehen sie jeden Tag ein wenig anders aus, was natürlich nicht ausschliesst, dass es Identitäten gibt, Wiedererkennungszeichen. Diese Nase, dieser Mund, unverkennbar. Die verstoppelten Wangen, der Grübchenkinn, das halb geschlossene Augenlid. Das Potential dieser Verschiedenheiten und Ähnlichkeiten entfaltet sich erst, wenn ich die Bilder aufhänge. Dazu trample ich auf dem Holzboden herum. Ich habe diesbezüglich jede Hemmung verloren. Unter mir logiert tatsächlich niemand. Die Wirtin hat es mir bestätigt. Sie hat gesagt: Sie dürfen trampeln und stampfen, soviel Sie wollen. Auch im Flur. Wir sind hier im Holzbödelihaus und nicht im Hilton.
In das Holzbödelihaus kommen manchmal die Jäger nach der Jagd. Rumpelnd und polternd beziehen sie ihren Stammtisch, der ein Rauchertisch ist, der einzige Rauchertisch im hoch brennbaren, aus nichts als naturreinen Hölzern bestehenden Holzbödelihaus. Der Aschenbecher ist mit bronzenen Eichenblättern verziert. Wenn die Jäger ein Wild erlegt haben, geben sie es gleich in der Küche ab, damit der Koch es in die Beize einlegen kann. Der Koch ist ein Wildfanatiker, er bedankt sich jedesmal überschwänglich. Überschwänglich sind auch die Jäger. Sie sind laut, hier dürfen sie es sein, weil es im Holzbödelihaus kein Wild gibt, das sie verscheuchen könnten. Das Wild auf dem Teller ist nicht wild, es ist zahm, es ist Nebensache. Die Jäger sind keine grossen Wildesser, das ist mir bald einmal klar geworden. Sie essen lieber Himbeertörtchen. Dazu trinken sie Kaffee-Lutz. Ihre Gesprächsthemen sind immer etwa die gleichen. Ich sitze lauschend am Nebentisch, das Immer-Gleiche wird variiert, ausgeschmückt, mit Zutaten angereichert. Wenn ich diesen ganzen Dorftratsch aufschreiben würde, gäbe das einen wunderschönen Heimatroman. “Jäger Alois und die Wildsauplage”. Ich feile schon mal am Titel herum. Dazu trinke ich Bier, die Wirtin ist sich nicht zu fein, mein Glas so hoch zu füllen, dass der überfliessende Schaum auf dem Tisch eine Überschwemmung anrichtet. Auf Tischtücher verzichtet man hier generell, eine Pfütze lässt sich innert Sekunden aufwischen, ein nasses Tischtuch muss man aufwendig waschen und glätten. Die Wirtin meint es gut mit mir, letzthin hat sie mir ein Grosses spendiert. Sie ist sehr gastfreundlich. Ihre Schnäpse sind berüchtigt; ich bin froh, darf ich beim Bier bleiben. Falls es mal brennt, sagt die Wirtin, löschen wir das Feuer mit Bierschaum.
Am Tag meiner Abreise lasse ich mir Rehpfeffer servieren. Ich esse bedächtig, fast andächtig. Ich rülpse. Die Hirsch- und Gamsschädel starren auf mich herab, stumme Zeugen meines letzten Mahls im Holzbödelihaus. Die Augenhöhlen beunruhigen mich nicht. Ich habe mich an sie gewöhnt, wie überhaupt an alles hier. Es sind schöne Ferien gewesen. Ich habe mich kein bisschen gelangweilt. Und ich habe sogar ein neues Hobby gefunden: das Köpfesammeln. Ich bin Kopfjäger geworden. In einem harmlosen Sinn natürlich. Und ich habe stark das Gefühl, dass ich früher oder später einen Heimatroman schreiben werde. Mit wilden Sachen drin. Jagdgeschichten und so. Meine nächsten Wanderferien werde ich bestimmt wieder im Holzbödelihaus verbringen.
2010
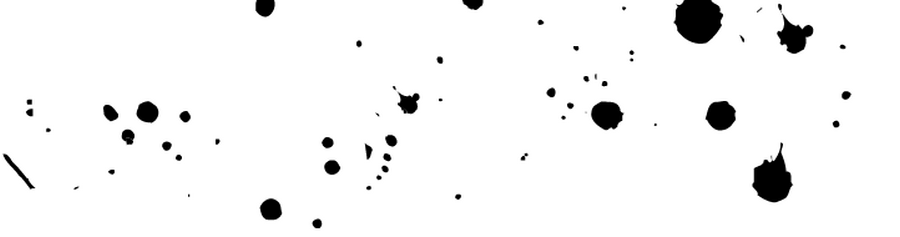 wörter
worte
wörter
worte