Pauls Hund
Paul nahm seinen Hund nicht an die Leine, er kraulte ihm nur ein bisschen die Kehle und lobte ihn für etwas, das wohl eine Sache zwischen Herr und Hund war. Uns ging das eigentlich gar nichts an. Braver Hund, guter Hund, sagte Paul. Hin und wieder sah er zu uns herüber, zwinkerte uns zu. Dann ging er, eine Pastille im Mund, die zwischen seinen Zähnen krachte wie ein Schieferstein, mit schlenkernden Schritten die Wiese hinab. Unter gelegentlichem Zurückschauen, die schlabbrige Hängezunge wie eine Krawatte vor der Brust, lief der Hund voran. Seufzend wandten wir uns den Gläsern zu, den Flaschen, den verbliebenen Kuchenteilchen. In Pauls Garten war ein rustikaler Sitzplatz in den Boden einbetoniert, Eichenholztisch mit Eichenholzstühlen, jedes Möbel, selbst das Beitischchen, auf dem die Flaschen standen, unverrückbar festgeschraubt in einer Bodenplatte. Hier, in diesem windgeschützten Winkel des weitläufigen Anwesens, das Paul sein eigen nannte, fühlten wir uns der Natur sehr nahe, Büsche und Bäume umgaben uns mit ihrem Geflirr, ihren Lichtkringeln, daneben Blumenrabatten mit viel mehr Unkraut als Blumen, wir waren in einer Überfülle von Grün begraben, und wäre in der wuchernden Gartenhecke nicht eine Lücke gewesen, breit genug für das Hindurchtreiben einer Kuhherde, so wäre uns die Sicht auf die Wiese hoffnungslos versperrt gewesen. Die Wiese grenzte direkt an den Garten und zog sich leicht abfallend ein Stückweit in den Wald hinein. Dort bildete sie eine Bucht, eine schöne Spielwiese. Als Paul sich endlich am richtigen Ort hingestellt hatte, auf dem zentralen Punkt zwischen den Waldrändern, die diese Bucht einfassten, und mit weit ausholenden Bewegungen ein Stöcklein zu schwingen begann, sahen wir uns mit vielsagenden Blicken an. Unsere kleine Tischgesellschaft musste jetzt ohne Paul zurechtkommen. Paul, unser Gastgeber, war beschäftigt. Nur leider nicht mit uns. Was für ein Theater, dachte ich, dachten wir hier am Tisch wohl alle. Doch was uns auch immer im Kopf herumgehen mochte, Pauls Getue hatte System. Es war ein Spiel, und das Spiel lief an, umständlich in Szene gesetzt von Paul, der uns wieder einmal seine Hundeliebhaberei vorführte. Das Spielfeld liess er noch frei, das Stöcklein ragte aus seiner Hand und beherrschte die Leere des Spielfelds wie ein Szepter. Der Hund war zapplig, aber auch ein bisschen schwerfällig, komisch schleifend und haltlos sein Gang durchs halbhohe Gras, irgendwie bauchlastig. Wie an zu kurzer Leine trabte er hin und her, sein heiseres Bellen weckte knallende Echos. Dieser Hund, dachte ich, während ich mit Augenzukneifen das Gegenlicht zu dämpfen versuchte, dieser Hund, dachte ich, steckt voller Erwartungen, die nach aussen drängen, in eine fliegende Bewegung hinein. Würde man diese Erwartungen nur ein klein wenig anstupsen, so könnte das Spiel beginnen. Aber was für ein Spiel? Das Spiel, auf das sich der Hund schon seit einer Weile eingeschossen hatte, war noch nicht erkennbar. Es hatte sich noch nicht eingespielt. Dass da einer mit seinem Hund und mit einem Stöcklein in der Hand die Wiese hinabgegangen war, besagte noch nichts. Vorläufig war dieses Spiel nichts als eine Ankündigung mit Gebell und einem Stöcklein. Kaum genug, um uns für Pauls Abwesenheit zu entschädigen. Aber immerhin ein Präludium für Schaulustige, also für uns, die wir halb emporgerichtet zusahen (wobei eigentlich?) und kaum erwarten konnten, dass da etwas geschah. Allzu lange brauchten wir nicht zu warten, und unsere Erwartungen waren auch nicht zu hoch gesteckt: es tat sich etwas, das sich recht gut anliess. Aufgepeitscht wie ein Jagdhund, dazu auch noch patschig wie ein junger Bär, ein schlecht geschnürtes Bündel Rauf- und Lauflust, so duckte sich der Hund ins Gras, warf sich hin und her, warf sich herum, schnellte vor und zurück und scharrte mit den Vorderpfoten die Erde auf. Als das Stöcklein auf ihn zuflog, hob er so rasch und freudig vom Boden ab, dass wir lächeln mussten. Was für ein Hund! Wir entspannten uns, zogen die Beine dicht zu uns heran und warfen sie flegelhaft über die Stuhllehnen. Es war die schiere Erleichterung darüber, dass Paul seinem Hund endlich etwas zu tun gab. Er stellt ihm eine Aufgabe, nahm ihn spielerisch in Pflicht. Es war jetzt alles in Ordnung, das Spiel ging flott voran. Jemand, ich glaube es war Knoll, griff nach der Weinflasche und schenkte grosszügig nach: vor allem sich selber. Mit seiner Hundeliebhaberei hatte Paul uns schon oft gelangweilt, aber diesmal unterhielt er uns prächtig. Das Spiel war schlichtweg sensationell. So etwas hatten wir noch nie gesehen, auch nicht bei Paul. Bei seinen mehr oder weniger öffentlichen Hundevorführungen hatte er noch nie ein Stöcklein gebraucht. Er hatte auf jedes Beiwerk verzichtet, woraus sich ein Mittelding zwischen Zirkusdressur und einfachem Gassigehen entwickelt hatte, Pauls ganz eigene Hundenummer. Die kannten wir. Sie bestand darin, dass Paul seinen Hund beiläufig beschäftigte, ihn mit Händeklatschen und Herumrennen in Atem hielt, ohne irgendwie fordernd zu sein, es war ja nicht einmal ein Spiel, es war weniger als ein Spiel, eine winzige Nebensache am Weg- oder Wiesenrand zwischen Herr und Hund, nichts Angestrengtes oder Demonstratives. Mit dem Stöcklein ging er nun einen Schritt weiter; er setzte die Schwierigkeiten für den Hund wie auch für sich selbst herauf. Insofern war das Stöcklein eine Bereicherung. Es brachte Spannung in die Sache. Es vergrösserte den Aktionsradius von Mensch und Hund, und auch wir, die Zuschauer, konnten dem unermüdlichen Stöcklein-Werfen und Stöcklein-Aportieren etwas abgewinnen. Durch das Stöcklein wurden wir gleichsam in einen vergrösserten Radius mithineingenommen. An diesem massiven Eichenholztisch, den wir seit Stunden nicht mehr verlassen hatten, war sich niemand im unklaren darüber, dass Paul seine Hundeliebhaberei um ein Beträchtliches erweitert hatte. Dementsprechend erweiterten sich auch unsere Gespräche, wir sprachen bald über nichts anderes mehr als über Hunde und Hündeler, und es glich schon fast einem Wettkampf, wie jeder von uns seine Erfahrungen und Kenntnisse auf diesem weitläufigen Gebiet herausstrich. Jeder von uns war erpicht darauf, seine Hundeerfahrungen und Hundekenntnisse als etwas Wichtiges und Diskussionswürdiges herauszustellen. Vor allem Knoll erwies sich als grosser Hundekenner. Während ich den absurd gestutzten Pudel meiner Cousine beschrieb, lehnte sich Knoll behaglich zurück und grinste wie jemand, der so etwas schon hundertmal gehört hat. Pudel, meinte Knoll, sind wahrscheinlich die schwulsten Tiere, die es gibt. Man muss sie künstlich befruchten, sonst sterben sie aus... Lachend legte er seine riesigen Landarbeiterhände auf den Tisch. Für die Handhabung von Hundebürsten waren sie wie geschafffen. Ich hatte auch einmal einen Hund, sagte Knoll, indem er meine Pudelgeschichte einfach wegwischte. Mein Hund, sagte Knoll, hiess Stoffel. Er war gemütlich und gemütvoll und folgte immer getreu meinem Wort. Täglich ging ich mit ihm zum nächsten Waldrand. Auf diesen Spaziergängen verhielt sich Stoffel immer sehr gesittet und ruhig. Auch wenn ich ihn von der Leine liess, damit er sich austoben konnte. Sein Getobe hielt sich üblicherweise in Grenzen. Er sprang ein bisschen herum, untersuchte, ohne ins Einzelne oder Tiefere zu gehen, die Bodenoberfläche, das Gras, die kleinstämmigen Ausläufer des Waldes, und trottete dann schleunigst wieder zu mir zurück. Eines Tages blieb er dicht vor dem Waldrand stehen und begann wie ein Irrer die Bäume zu verbellen. Potztausend, dachte ich, was ist denn in diesen Hund gefahren? Ich war doch sehr verwundert. Auf einmal wurde mir klar, dass es ihm recht wohl war mit seinem Gebell. Was er da tat, war die natürlichste Sache der Welt. Mein Hund war scharf auf sein eigenes Echo, er bellte in den Wald hinein, weil der Wald trotz seiner Dichte und Verfilztheit das Gebell nicht etwa verschluckte, sondern zuverlässig zurückwarf. Mein Hund, ansonsten gar nicht so dumm, glaubte es mit einem Eindringling zu tun zu haben und verteidigte seine Revieransprüche mit dem Stolz und dem Mut eines bodenständigen Wächters. Doch der Eindringling war auch nicht gerade von der feigsten Sorte, hartnäckig schien er sich gegen das Gebell meines Hundes zu behaupten und gab keine Sekunde lang nach. Ohne zu ahnen, dass er nur auf seine eigene Reaktion reagierte, beantwortete Stoffel diese Brüskierung mit lautstarkem Gebell. Was nicht unerwidert blieb. Und so ging es hin und her, was eigentlich zum Totlachen wäre, hätte ich nicht den Umstand zu beklagen gehabt, dass es Stoffel war, der sich so verhielt, und nicht irgendein dahergelaufener Köter aus dem Ausländerviertel. Da ich ihn nicht wegzerren mochte, liess ich ihn am Waldrand zurück. Erst spät am Abend kam er nach Hause getrottet. Von da an wiederholte sich dieses Bellmanöver täglich, ohne dass ich mich dazu hätte entschliessen können, Stoffel zur Vernunft zu bringen. Ich hätte es einfach nicht übers Herz gebracht, irgendeinen Zwang auf ihn auszuüben. Anstatt einzugreifen, spielte ich die Rolle des besorgten Beobachters. Ich duckte mich in ein Versteck, um ihn nicht zu stören, machte mich dann aber nach einer Weile auf den Nachhauseweg, ohne Stoffe natürlich. Den liess ich am Waldrand zurück. Nach etwa einer Woche mehrten sich die Anzeichen eines Nachgebens, einer Resignation. Stoffel war heiser und müde. Er hockte sich einfach nur hin, gab keinen Laut von sich, lauschte. Der andere, dieser geheimnisvolle, jetzt auf einmal so schweigsame Hund war immer noch da und hielt seine Stellung, das wusste mein Hund, und das Schweigen kam ihm offensichtlich genauso bedrohlich vor wie das Bellen. Eines Abends kam er, wie schon viele Abende zuvor, mit hängendem Kopf ins Haus getrottet, schnüffelte lustlos an seinem Spielzeug herum und legte sich dann auf seine Strohmatte. Aber nicht für lange. Der Gedanke, dass sich im Wald ein Hund herumtrieb, der schlau genug war, nicht zu bellen, liess ihm offensichtlich keine Ruhe, und nachdem er sein Abendbrot verschlungen hatte, das währschafte Kraftfutter aus der Dose, lief er wieder hinaus, um seinen Posten zu beziehen. Ich meinerseits schlich wieder in mein Versteck, um Stoffel zu beobachten. Im schwachen Mondlicht sah ich ihn vor dem Waldrand stehen wie eine Statue. Er liess nur ein einziges Kläffen hören, eine Art Probekläffen, um sicherzugehen, dass der andere Hund noch da war, dieser ebenso schlaue wie fanatische Gegner, der es drauf absah, jedes Kläffen meines Hundes ohne Verzögerung zu beantworten, sich im übrigen aber schweigsam verhielt. So wurde die Pattsituation erneuert, und mein Hund setzte sich mit aufrecht gestellten Ohren hin, um die ganze lange Nacht hindurch zu schweigen und das grosse Schweigen des Waldes zu belauschen. So ging es nun jede Nacht, während Stoffel die Tage mit schläfrigem Herumliegen verbrachte. So sammelte er seine Kraft für die nächste Nacht und das nächste Zusammentreffen mit dem geheimnisvollen Waldhund. Ihm machte Stoffel Nacht für Nacht seine Aufwartung. Jede Nacht lief er hinaus, als wäre dort draussen eine grosse Sache im Gange, die er auf keinen Fall verpassen durfte, und ich erlaubte es ihm. Es war ihm ja offensichtlich ein Bedürfnis, die Nächte draussen zu verbringen, am Waldrand bei seinen Bäumen. Meistens schlich ich mich schon nach wenigen Stunden davon, froh, in mein Bett schlüpfen zu können. Ich war mir sicher, dass er sich nicht von der Stelle rühren würde, der andere Hund rührte sich ja auch nicht, wie festgebannt blieben beide dort sitzen, jeder auf seinem Platz, der dem Platz des andern genau gegenüberlag, und so verharrten sie reglos beidseits des Waldrands, der eine Hund im Wald drinnen, der andere draussen, und beide lauschten und starrten in die nächtliche Stille hinein. Der Wald in der Nacht, eine grausige Masse aus Holz voll Fäulnis und Schwärze, war für Stoffel vermutlich ebenso beängstigend wie verlockend, weil er nachts noch viel weniger als am Tag irgendetwas über diesen andern Hund herausfinden konnte und es trotzdem immer wieder versuchen musste. Diese Zwanghaftigkeit machte mir zu schaffen. Wo blieb ich? Ich fühlte mich zurückgesetzt, übergangen. Allem Anschein nach war Stoffel in Gedanken überhaupt nicht mehr bei mir. Ich, der ich ja innigst an ihm hing und es nie für möglich gehalten hätte, dass jemals irgendetwas Trennendes zwischen uns geraten könnte, machte mir so meine Gedanken. Ich ertappte mich dabei, wie ich den Irrglauben meines Hundes zu teilen begann. Die Existenz dieses zweiten Hundes erschien mir - auch gegen jede Wahrscheinlichkeit - immer wahrscheinlicher. Was sprach dagegen, dass es ihn gab? Im Dunkel des Waldes musste etwas verborgen sein, das erklären konnte, warum Stoffel nicht lockerliess, warum er wieder und wieder an den Ort seines Lauschens und Bellens zurückkehrte. Ja, was war es? Was zog Stoffel ständig wieder dorthin? Er war weder verdreht noch dumm, das wusste ich, und schliesslich hatte er das bessere Gehör als ich, vom Geruchsempfinden ganz zu schweigen. Ich versuchte ihn zu verstehen. Ich versuchte in sein Fell zu schlüpfen. Indem ich auf allen Vieren und mit der Nase am Boden seine Sichtweise einnahm, sein Schnuppern imitierte und meine Ohrmuscheln mit Klebeband in eine für das Lauschen günstige Position brachte, gelang es mir annäherungsweise, in seine Welt einzudringen. Ich kam auf den Hund. Was damals, mir selber noch unbewusst, in mir heranreifte, war ein völlig neues Verständnis für meinen Hund, es war die perfekte Hundeliebe.
Während Knoll über die perfekte Hundeliebe sprach, entfernten sich Paul und sein Hund immer weiter vom Gartensitzplatz. Ich meine das nicht wörtlich, Herr und Hund entfernten sich nicht wirklich, nicht räumlich, sie waren immer noch dort, wo sie schon eine ganze Weile miteinander gespielt hatten, aber es schien uns, als hätte sich das Spiel von uns abgekoppelt und sich in eine für uns nicht mehr ganz einsehbare Richtung entwickelt. Wenn wir hinabblickten auf die Wiese, taten wir es mit einer gewissen Verlegenheit. Pauls Eifer war uns unheimlich, wir hofften, dass Paul den Punkt finden würde, wo man solche Spiele abbricht, aus Erschöpfung oder einfach nur aus Anstand. Paul hatte diesen Punkt womöglich schon längst überschritten. An seinem Tun war etwas Unerhörtes, das uns beeindruckte, aber auch erschreckte. Wir sahen ihn herumlaufen, wir sahen ihn dastehen und dem Hund ein Zeichen geben. Paul schwenkte in seiner Hand das Stöcklein. Uns schien er vergessen zu haben. Wir akzeptierten das. Wir deuteten auf diesen hemdsärmligen Mann, der sich so sehr auf seinen Hund konzentrierte, dass er für die ganze übrige Welt verloren schien. Wir schubsten uns und sagten: ist das noch Paul? Wir sahen ihn die Arme hochwerfen. Er machte Wirbeldrehungen und dirigierte mit dem Stöcklein den Hund in diese oder jene Richtung. Zwischen den beiden ging einiges vor sich. Wir Zuschauer rührten uns nicht von der Stelle. Wir blieben am Tisch. Wir blieben aus dem Spiel. Paul, denke ich, war das nur recht. Uns Hundelaien war der Umgang mit seinem Hund verboten, oder genauer gesagt: um nicht wirrköpfig zu werden, sollte der Hund daran gehindert werden, sich mit uns abzugeben. Pauls Hund gehörte zu Paul und zu niemandem sonst. Der Hund gehört zu seinem Herrn und ist von ihm abhängig. Das klingt vielleicht nicht sehr hundefreundlich, ist aber eine Tatsache, die in jedem Hundebrevier als Schlüssel zum Verständnis des Hundes beschrieben wird. Der Hund braucht keinen Schulungsvortrag, um Gehorsam zu lernen, auf Anhänglichkeit und Gehorsam versteht er sich von Natur aus. Was natürlicherweise eine besondere Beziehung voraussetzt. Ein Hundehalter, der die Fühlung mit seinem Hund verliert, verliert auch den Hund. Wer wüsste das nicht? Jeder Hund braucht einen Menschen, der ihm ungeteilt zur Verfügung steht, eine konstante und verlässliche Bezugsperson, eine feste Hand. Und der Mensch kann daran wachsen, an einer Hundebeziehung kann ein Mensch tatsächlich wachsen. Die instinkthafte Gefügigkeit seines Hundes war für Paul eine Aufgabe, die sein hundepsychologisches Einfühlungsvermögen in ungeahnte Höhen trieb. Dort auf jenen Höhen, wo der Mensch nicht mehr auf Handzeichen, Befehle und Läckerlis angewiesen ist, um seinen Hund im Griff zu haben, sondern im Hundetraining eigentlich nur noch die reine Gedankenkraft benötigt, die reine Willenskraft, bildet sich der menschliche Charakter wie nirgendwo sonst. Dort bewährt sich jene befehlsgeberische Selbstsicherheit, die den guten Hundehalter auszeichnet. Dieser Hund war freilich nicht irgendein Hund, er war etwas Besonderes. Zum Beispiel zeichnete es ihn in besonderem Masse aus, dass er Paul gehörte, das allein schon war eine respekteinflössende Besonderheit, aber darüber hinaus war dieser Hund auch noch ein Charakterhund, mit dem man, um ihn nicht zu beleidigen, sozusagen auf höchster Ebene verkehren musste. Paul warf ihm das Stöcklein nicht direkt zu, das wäre dann doch zu einfach gewesen, eine unsportliche Erleichterung, Paul warf es über den Hund hinweg in die Weite des Umlands, also irgendwohin in die Ferne, und der Hund kugelte sich, fing sich auf und sprintete dem Stöcklein voran oder unter ihm hindurch, federte hoch wie ein Delfin und drehte sich dabei auch noch auf den Rücken: so schnitt er die Flugbahn des Stöckleins und holte es mit einem gezielten Zuklappen der Schnauze aus der Luft. Die Wurfweite war jeweils erstaunlich. Paul war ein guter Werfer. Einmal war der Hund da, dann wieder dort. Man kam fast nicht mit. Ein silbrig schimmerndes Aufwirbeln von Gras begleitete sein Hin- und Herflitzen wie ein Schatten. Weil er so unglaublich schnell war und in so kurzer Zeit so unglaublich weite Strecken zurücklegte, schlossen wir Wetten darüber ab, wie lange er noch durchhalten würde. Wenn Paul es drauf angelegt hätte, hätte er aus diesem Hund einen Champion machen können. Pauls Hund hätte jedes Rennen, jeden Hindernislauf mit Leichtigkeit gewinnen können. Wir brachten den beiden eine sportliche Zuneigung entgegen. Wir klatschten und pfiffen, um unserer Begeisterung Luft zu machen. Es war uns ein Bedürfnis, diesen Hund anzufeuern. Durch die Schalltrichter unserer Hände riefen wir frei erfundene Hundenamen, die auf Seiten des Hundes natürlich keinerlei Reaktion hervorriefen. Was wir da taten, war kindisch. Selbstverständlich hörte Pauls Hund nur auf seinen angestammten Rufnamen, und auch dann nur, wenn Paul es war, der diesen Namen rief. Nur Paul stand es zu, Einfluss auf seinen Hund zu nehmen, und er wahrte darin eine gewisse Diskretion, wandte seinen Einfluss nur gerade so weit wie unbedingt nötig an. Im grossen und ganzen kam Paul fast ohne Zurufe aus. Der Hund gehorchte auch so, wie durch Gedankenkraft gelenkt, nur selten einmal rief Paul ihm etwas zu oder gab einen Pfiff ab, wenn sich der Hund in seiner spieltriebgesteuerten Kühnheit oder Gedankenlosigkeit zu weit vom Ausgangspunkt entfernte, insbesondere bei den Weitwürfen in Richtung Nordost, wo die Wiese sehr undeutlich in Kuhweiden und Kleefelder überging. Wie aber lässt sich erklären, dass der Hund zu weit springen konnte, wenn doch Paul mit dem Stöcklein die Wurfweite wie auch die Springweite jeweils vorgab, es also in der Hand hatte, wie weit der Hund jeweils hinter dem Stöcklein herzuhecheln hatte? Nun, die Sache war die: Wurfweite und Springweite waren keineswegs immer identisch. Manchmal sprang der Hund, bevor er das Stöcklein schnappte, irgendwo ins Kraut hinein, um sich in einem Akt unnötiger Akrobatik zurück- und dem Stöcklein entgegenzuwerfen. Und manchmal drehte er, kaum hatte er das Stöcklein im Maul, noch eine allürenhafte Extrarunde, brach in irgendeine Richtung aus, um die überschiessende Freude über seinen geglückten Fang abzureagieren. Paul spielte dann den Aufpasser, eine wichtige Rolle in diesem Spiel. Für den Hund war es bestimmt nicht immer leicht abzuschätzen, bis wohin er sprinten durfte, ausser den Waldrändern gab es ja auch keinen festgesetzten Rahmen, keine Abschrankung. Aber auch die gut sichtbaren Waldränder waren für diesen Hund kein Hindernis, hechelnd und mit grossem Körpereinsatz durchbrach er jede naturgewachsene Schranke. Mehrmals stürmte er Hals über Kopf in die frühherbstliche Blätterwand hinein, krachte wie eine Granate ins Gestrüpp, verschwand zwischen den Bäumen und kämpfte kläffend, wenn auch nie länger als einen kurzen Augenblick, gegen das Unterholz an. Er sprang hinein und gleich wieder heraus. Eine erstaunliche Leistung. Da Paul, nicht anders als sein Hund, immer ausgelassener wurde, flog das Stöcklein nicht nur bis zum Waldrand, sondern immer häufiger auch in den Wald hinein. Wie ein willkürlich geschossener Pfeil fetzte das Stöcklein durch die Laubwand hindurch und in den Wirrwarr aus Gestrüppen, Baumstrünken, Jungbäumen und herumliegendem Totholz. Der Hund zögerte keine Sekunde. Er fischte das Stöcklein gewissermassen aus der unendlich verzweigten Holzmasse des Waldes, tauchte immer und immer wieder in diesen Wirrwarr aus Millionen von Stöcklein und Ästlein, ohne auch nur einmal das falsche Stöcklein zu erwischen. Das von Paul geworfene Stöcklein brachte er jedesmal zuverlässig zurück, was Paul uns bestätigte, als er eine gute Stunde später wieder bei uns am Tisch sass und es sich natürlich nicht nehmen liess, uns die Taten seines Hundes haarklein zu beschreiben.
Wir bewunderten Paul. Andererseits bewunderten wir auch ein bisschen uns selbst. Völlig ohne Hundekenntnisse waren wir nämlich nicht, niemand von uns. Auch ich, sagte Lorenz, hatte einmal einen Hund, es war ein Zwergphönizier... Lorenz stöpselte die Plastikkanne zu, nachdem er sich einen Kaffee eingegossen hatte. Er hantierte mit dem Zucker. Mein Hund, fuhr Lorenz fort, hiess verwirrenderweise wie ich. Er hiess Lorenz. Das ist leicht zu erklären. Ich finde, dass man bei der Auswahl eines Hundes immer nur von sich selbst ausgehen kann. Man hat grosse Ohren, also entscheidet man sich für einen Hund mit grossen Ohren. Ich heisse Lorenz, also habe ich mich für einen Hund namens Lorenz entschieden. Lorenz, mein Hund, war gutmütig, aber nervös, leicht aufregbar. In diesen und noch vielen weiteren Punkten ähnelten wir uns sehr, auch seine Beweglichkeit war mir nur allzu bekannt, sie erinnerte mich an mich selbst, an meine eigene Beweglichkeit und Bewegungslust, und diesen gemeinsamen Stärken und Schwächen trugen wir Rechnung, indem wir uns so oft wie möglich dem gemeinsamen Bewegungsdrang ergaben, man regt sich ja immer so leicht auf, wenn man zu wenig Bewegung bekommt. Zumindest mir geht es so, ich brauche gute, regelmässige Bewegung, und für diesen Zweck hatte ich in Lorenz die ideale vierbeinige Ergänzung gefunden. Wir waren uns sehr verbunden. Mein Hund war dennoch ein Hund, und ich war ihm als Mensch vor die Nase gesetzt, damit er jemanden hatte, zu dem er hochschauen konnte. Das hatte schon seine Richtigkeit. Ich war sein Vorgesetzter, er mein Untergebener. Damit waren wir beide einverstanden, und ich war rücksichtsvoll genug, ihn meine menschliche Überlegenheit nicht allzusehr spüren zu lassen. Nur weil der beste Freund, den man hat, ein Hund ist, heisst das noch lange nicht, dass man ihn auch wie einen Hund behandeln muss. Das heisst: von oben herab. Von oben herab sollte man nicht einmal Kinder und Dienstmädchen behandeln, geschweige denn Hunde. Man komme mir nicht mit Leinenobligatorium und solchem Zeug! Einen Hund an der Leine zu führen ist das Letzte, was man einem Hund zumuten darf. So darf man einen Hund nicht behandeln, vor allem nicht den eigenen! Ein Hund ist ein Hund - und kein Gürteltier, das man an der Leine führen muss, weil es auf die Leute zutatzeln und sie zu Tode erschrecken könnte. Meinen Lorenz von der Leine zu lassen, war mir ein absolutes Bedürfnis, da es auch seinem Bedürfnis entsprach. Auf unsern Spaziergängen und Wanderungen erlebte ich ihn oft als Wirbelwind. Jawohl, wie ein Wirbelwind jagte er die Wiesen hinauf und hinunter und durchbrach die Weidenhecken, und mehr als einmal wäre er fast von einer Kuh aufgespiesst worden! Grosse Tiere, die in dumpf stampfenden, lokomotivartig schnaufenden Herden auftraten, weckten sein lebhaftestes Interesse. Obwohl solchen Tieren an Grösse und Kraft weit unterlegen, kehrte er ihnen gegenüber den Leithund heraus, sprang mit spitzem Alphatier-Gekläff um sie herum. Bei Kühen mit Jungvieh konnte es schon mal vorkommen, dass sie mit gesenkten Hörnern auf ihn zuwalzten und ihn zwangen, das Feld zu räumen. Nicht immer ging das so glimpflich aus. Unvergesslich bleibt mir eine Kuh, die uns mit verdrehten Augen und Schaum vor dem Maul bis ans Kuhgatter nachstampfte, wo ich mich trotz meines Bierbauchs über das kotige Gestänge schwang, dicht gefolgt von Lorenz, der wie ein Flughund hinter mir dreinflog.
Lorenz, der Mensch, sah uns eindringlich an. Nachdenklich schoben wir unsere Teller hin und her. Die Sonne stand auf einmal sehr tief. Da, sagte Knoll. Der Tonfall seiner Stimme verriet, dass sich etwas verschoben hatte, es bahnte sich etwas an, das uns vielleicht auf neue Gedanken bringen konnte. Paul schlurfte langsam auf uns zu. Ohne Hund. Der Hund hockte verlassen auf der Wiese. Er schnappte nach Luft, und die Luft stand still. Es war die gewohnte Windstille des Abends, kein Blättchen rührte sich, während sich der Himmel auffällig verfärbte. Zwischendurch blieb Paul stehen und wischte sich die Stirn ab, blickte kurz zurück und rief: Was ist denn? Komm schon! Paul klopfte sich auf den Oberschenkel. Willst du wohl! Der Hund guckte ihn an, als sei das richtige Stichwort noch nicht gefallen. Als Paul bei uns ankam, versank die Sonne in grünlichgelben Schlieren hinter dem Wald. Pauls Hund, über den sich langsam die Schatten der Dämmerung legten, schien sich einen Aufschub oder eine Verlängerung verschaffen zu wollen. Er schnappte weiterhin um sich, als jage er immer noch einem Stöcklein hinterher.
Paul rückte sich einen Stuhl zurecht, setzte sich breitbeinig hin. Wir schenkten ihm ein. Paul wollte Wasser, nur Wasser. Das Glas in der Hand, sah er über die Distanz hinweg, die er soeben zurückgelegt hatte. Der Hund war ein wuscheliger Fleck. Ohne Mensch war die Wiese dort unten ein riesiges Feld, das den Hund zusammenschrumpfen liess, ihn fast zum Verschwinden brachte. Es war drollig, wie er dort unten wieder in Bewegung kam, heftig und vielleicht auch ein bisschen vorwurfsvoll nach dem Stöcklein zu stöbern begann; zweifellos wünschte er sich Paul zurück. Das ist ein Hund, was! lachte Paul. Er schnippte mit den Fingern und zwinkerte uns zu. Er war stolz auf seinen Hund. Wenn er die Sprünge seines Hundes beschrieb, war das keine Angeberei. Es war Stolz, und er beschrieb diese Sprünge wie die Lausbubereien eines Kameraden, den er zwar belächelte, aber trotzdem mit geniesserischem Zungenschlag aufs Podest hob und zum Helden einer ausufernden Erzählung machte. Paul genoss es, uns seinen Hund nicht nur vorzuführen, sondern auch zu beschreiben, auf welch verblüffende Weise dieser Hund sich vorführen liess, wie er sich dabei anstellte. In Sachen Sprungtechnik, sag ich euch, unglaublich, lachte Paul, der kleine Kerl geht ab wie ein Känguruh! Man könnte ihm alle vier Beine wegnehmen, und er würde immer noch herumhüpfen, weil er dazu nämlich gar keine Beine braucht, er kann das nämlich auch mit dem Bauch... Mit dem Bauch!
Kurze Zeit später - wir lachten gerade über irgendeine Bemerkung, eine Witzelei von Knoll vielleicht - geschah es, dass einer nach dem andern in die gleiche Richtung zu schauen begann, nämlich die Wiese hinab zum Wald, während das Gelächter langsam verebbte. Die Wiese lag verlassen in der Dämmerung, und von Pauls Hund war weit und breit nichts zu sehen. Eine Lagebeurteilung wäre jetzt mehr als angebracht gewesen. Doch worauf hätte sie sich stützen sollen? Immerhin bemerkten wir am Waldrand unten ein Huschen, und fast gleichzeitig drang aus dem Gewirr der Stämme und Dickichte ein Gebell zu uns herauf, das sich unglaublich rasch entfernte und sich abrupt nach oben schraubte, gerade so, als würde es sich durch den Zustrom von Helium in ein Zwergenstimmchen verwandeln. Es wurde immer zittriger und dünner. Schliesslich wurde es zu einem hohlen, flattrigen Sirren, das sich irgendwo im Himmel zu verlieren schien. Wir pressten unsere Hände gegen die Tischkante. Das Holz fühlte sich kalt an. Mir kamen die wildesten Vermutungen. Ich ahnte schon das Richtige, wollte es aber noch nicht wahrhaben. Das Richtige wäre das Absurde gewesen, das Unmögliche, doch das Richtige wollte ich nicht wahrhaben, also begnügte ich mich mit einer Vermutung, die sich dann später als falsch herausstellen sollte. Pauls Hund, dachte ich, dachten wohl auch Knoll, Dürr, Möckli, Stücklisberger und Lorenz, hat sich bestimmt nicht mutwillig davongemacht, sondern irgendeine unwiderstehliche Witterung aufgenommen. Es überraschte uns, dass Paul seinen Hund nicht herrief. Paul war völlig handlungsunfähig. Als wäre das Band zwischen ihm und seinem Hund zerrissen, war auch die ganze Lebhaftigkeit fort, die sich während des Spiels zwischen Paul und seinem Hund aufgebaut hatte, eine Kraft, die sich fortwährend von Paul auf seinen Hund wie auch von dem Hund auf Paul übertragen hatte, ein hin und her schiesssendes elektrisches Fluidum, das nun vollständig erloschen war. Der Hund war fort, und Paul versank in Apathie. Der Hund war in die Luft oder in das Nichts eingekehrt, war nicht mehr da, wo Paul war, der Hund lief ins Ungefähre, vielleicht sogar in eine andere Dimension hinein, und Paul hatte ihn losgelassen, ohne sich dagegen zu sträuben, hatte es widerstandslos akzeptiert. Ich nahm an, dass dieses Geschehen für ihn derart unbegreiflich war, dass er sich und seinen Verstand davor schützen musste. Paul hatte sich in sich selbst zurückgezogen, in ein dumpfes Desinteresse hinein, wo ihn nichts und niemand mehr erreichen konnte. Die Verstörung blieb draussen, in dieser dumpf gegen ihn anbrandenden Welt, die er nicht mehr wahrhaben und zu sich hereinlassen wollte. Die Hände legte er in den Schoss, anstatt sie wie noch vor wenigen Minuten in den Mund zu stecken, um einen seiner schrillen Pfiffe abzulassen. Wer weiss, ob er damit jetzt noch Erfolg gehabt hätte. Ich glaube nicht, ich glaube, dass da auch die feurigsten Hundepfiffe nichts mehr hätten ausrichten können, auf die üblichen Mittel war kein Verlass mehr. Der vorliegende Fall war kein Normalfall, deshalb. Wie um uns zu foppen, tauchte der Hund zwischendurch ganz überraschend wieder auf. Ein Stück Fell, ein Gehaspel aus Beinen, ein Wischen. Von Mal zu Mal war ein bisschen weniger von ihm zu sehen und schliesslich fast gar nichts mehr. Nur hie und da - oh Gott, riefen wir, schaut mal da, schon wieder! - noch etwas Hundeähnliches mit kleinen rotierenden Beinchen dran, das war alles. Und dann wieder nichts... Und dann... Es war kaum zu vermeiden, dass wir mit Ungläubigkeit reagierten. Wir zweifelten an unserm Verstand. Wir begriffen nichts und griffen uns an den Kopf. Jedesmal, wenn wir schon glaubten, der Hund sei uns endgültig entwischt, tauchte er irgendwo ganz unerwartet und plötzlich wieder auf, momentweise zumindest sahen wir sein Fell, sahen seine verwischte und halb von Blättern bedeckte Gestalt und hie und da irgendeine aus dem Unterholz hervorschnellende flüchtige Bewegung. Nach und nach wurde uns dann aber klar, dass der Hund sich trotz der unaufhörlichen Schlaufen und Bögen, die er zog, von uns entfernte. Und nicht nur von uns. Knoll sprach zögernd von einem “Aus-der-Welt-Fallen”. Und Stücklisberger doppelte nach, indem er das Verschwinden des Hundes als “Entmaterialisierung” bezeichnete. Das dämmerhafte Versteckspiel war kaum noch auszumachen, wir konnten es höchstens noch ein bisschen erahnen, wenn irgendwo eine leichte Unruhe durch den Wald ging, ein Geraschel oder Seufzen, und wir fragten uns: war das noch der Hund? Wie kamen wir denn darauf! Das konnte auch sonstwas sein, ein Getrappel von Hundepfoten konnten wir da unmöglich heraushören. Bald fiel kein Laut mehr, es war totenstill. Mehr noch als Pauls Untätigkeit verblüffte uns das Verhalten dieses Hundes, sein Davonspringen und Entschwinden in völliger Losgelöstheit, seine Unbändigkeit, die uns Menschen weit hinter sich zurückgelassen hatte. Dass ein Hund, der sich, wie Paul uns immer wieder versichert hatte, nie die leiseste Unbotmässigkeit hatte zuschulden kommen lassen, dass ausgerechnet dieser Vorzeigehund, der vorbildlichste Hund in unserm ganzen Bekanntenkreis, unaufgefordert in einen Wald hineingestürzt und darin verschwunden war, und mehr noch: dass er sich dabei sichtbar entmaterialisiert hatte, erschien uns so unbegreiflich wie ein chinesisches Zauberkunststück mit fliegenden Menschen und singenden Affen.
Knoll, Dürr, Möckli und Stücklisberger schlossen sich zu einem Suchtrupp zusammen. Das kleine, scharfäugige Grüppchen wagte sich ohne Taschenlampe in den nachtschwarzen Wald hinein. Lorenz und ich begnügten uns mit dem Waldrand. Paul hatten wir zurückgelassen. Es war uns einfach nichts in den Sinn gekommen, womit wir ihn hätten aufscheuchen können. Zu gross war sein Schock. Alles, was mit ihm und seinem Hund zu tun hatte, war in diesem Menschen ausgelöscht. Paul war nicht mehr Paul, und sein Hund war nicht mehr sein Hund.... Lorenz und ich machten uns grosse Sorgen um Paul, fast mehr noch als um seinen Hund. Der arme Paul, seufzte ich. Der arme Paul, seufzte Lorenz. Den Hund erwähnten wir nicht. Während ich mich von Baum zu Baum tastete, kam Lorenz, der in seinen raschelnden Kordhosen neben mir herging, wieder ins Reden. Ich habe die Geschichte von meinen Hund noch gar nicht zu Ende erzählt, sagte er keuchend, eines Tages, es war ein Donnerstag kurz vor Weihnachten, verschluckte mein Hund ein Mandarinchen und erstickte daran. Mehr zu erzählen habe ich nicht, es war das Ende meines Hundes, und ich glaube nicht, dass ich jemals wieder einen Hund haben möchte. Ein Hund ist nicht zu ersetzen - vor allem nicht durch einen andern Hund.
Lorenz und ich blieben stehen. Er zündete sich eine Zigarette an, das Streichholz in seiner Hand flammte kurz auf, zischend. Auf den Rest der Mannschaft brauchten wir nicht lange zu warten. Bald schon kamen Knoll, Dürr, Möckli und Stücklisberger aus der Dunkelheit herangestapft. Mit verschwommenen Blicken und glimmenden Zigaretten blieben sie stehen, eine Weile sagte niemand auch nur ein Wort. Es wurde gehüstelt und geräuspert.
Und dann sagte Dürr etwas sehr Sonderbares. Aus Tangramsteinchen kann man eine Figur zusammensetzen, die wie ein Hund aussieht. Aber wenn man die Tangramfigur auflöst, bleibt nichts von diesem Hund übrig. Nichts! Es bleibt nur die Feststellung, dass es diesen Hund womöglich gar nie gegeben hat.
2008
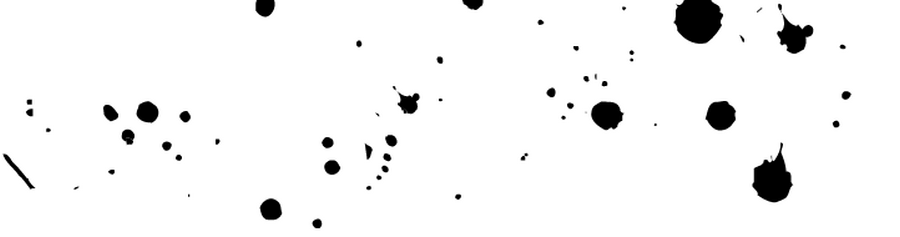 wörter
worte
wörter
worte