Zeugenvernehmung
Hans Wicki, 37 Jahre, Fahrlehrer:
Mit einem knappen Nicken kam er herein, den Mantel behielt er an, nicht nur sich selbst und den Mantel, auch Luft brachte er herein, einen Schwall aus Nässe und Kälte, und dann stand er lange wie in sich versunken im Lichtkegel des Lampenschirms, mehlweiss und teigig das gedunsene Gesicht, ein Mann aus der Fremde, und ich wusste: wenn einer hereinkommt, der sich nicht gleich hinsetzt, muss man auf alles gefasst sein. In seinem Auftritt war ein Zögern, das uns stutzig machte. Wir nickten ihm zu. Kollege Jöggi nahm seine Zigarette aus dem schiefgezogenen Maul. Er vergass die Asche abzuklopfen. Er war genau so baff wie ich. Der Fremde, ein Glatzkopf, hatte vermutlich nicht einmal einen Haarkranz hintenrum, aber so genau weiss das niemand mehr, der Mann war im Ganzen zu unauffällig, zu lautlos, zu grau, um irgendeinen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Von Beginn an hielt er sich aus allem heraus. Man sah gleich, dass er nicht der Typ war, der sich irgendwo anschloss. Und was war da sonst noch? Fragen Sie mich nicht, Herr Kommissär. Ich weiss nicht, was ich beschreiben soll, es gibt nichts zu beschreiben. Verzeihen Sie mir, wenn ich hier etwas zu Protokoll gebe, das Ihnen höchstwahrscheinlich unsinnig vorkommt, Herr Kommissär: aber jedes von Ihnen zusammengestückte Phantombild, das das Gesicht dieses Mannes auch nur annähernd richtig wiedergeben soll, ist zu genau.
“Jöggi” Nussbaumer, 44 Jahre, Isolierspengler:
Bei seinem Eintreten blieben wir verhältnismässig gefasst. Ich besah mir die Zimmerdecke, als hätte ich die noch nie gesehen, und streifte ihn dabei mit einem Blick, den man als neutral bezeichnen könnte. Ich murmelte ein Grüezi. Nun ja, wir sind hier in der Schweiz. Da wäscht man sein Gesicht mit Seife und sagt Grüezi. Das gehört sich. Auch Fremden gegenüber ist ein Grüezi durchaus am Platz. Weder mich noch sonst jemanden in dieser Gaststube verband auch nur die geringste Beziehung zu ihm, wir kannten ihn nicht, diesen Mann, noch nie gesehen, wir grüssten ihn aber nicht unfreundlich, nicht uninteressiert. Neutralität darf man nicht mit Gleichgültigkeit verwechseln. Neutralität ist eine Form, die alles ins Gleichgewicht bringt, in einen wohlabgemessenen Rahmen hineinstellt, und diese Form gilt es zu wahren. Schon immer hatten wir es so gepflogen: kommt einer rein, schaut man hin, grüsst. Der Freundliche ist dem Unfreundlichen gegenüber im Vorteil, nötigenfalls kann der Freundliche den Unfreundlichen mit einem Lächeln oder einem Witz zu Boden schmettern. An unserm Stammtisch gilt seit jeher die Unschuldsvermutung. Wohlwollend nahmen wir das Eintreten dieses Fremden zur Kenntnis, doch wollten wir die Gutmütigkeit auch nicht übetreiben. Man kommt ja viel zu selten dazu, freundlich gegenüber einem Fremden zu sein, es fehlt einem diesbezüglich an Übung, man kann sich da auch verrechnen, und das wiederum war an diesem Abend der ganzen Stammtischrunde klar: allzu grosse Freundlichkeit war vielleicht gar nicht angebracht. Wir wussten ja nicht, mit wem wir es da zu tun hatten, und waren dementsprechend vorsichtig. Wenn man freundlich ist und die Freundlichkeit nicht erwidert wird, hat das immer zur Folge, dass man blöd dasteht. Wir registrierten ihn daher beiläufig, wie das ja sowieso üblich ist, wenn man sein Bier vor sich hat. Ja, wir waren beim Bier, beim Stammtischgespräch, wir hatten es vorrangig mit uns selbst zu tun, mit dem, was wir dachten oder sagten, und deshalb gingen wir nicht über ein Grüezi und ein höfliches Kopfnicken hinaus. Letzteres wurde auch prompt erwidert. Kann man das schon als Freundlichkeit bezeichnen? Ich weiss nicht. Ist Auslegungssache. Und überhaupt, was ist Freundlichkeit? Freundlichkeit kann falsch sein. Freundlichkeit kann man vorschützen, wenn man eine vielleicht gar nicht so freundliche Absicht verfolgt. Da kann einer noch so höflich tun, sich aufplustern mit Hutlüften und Lächeln: wenn er fremd ist, hat seine Höflichkeit weiss Gott selten etwas Gutes zu bedeuten. Ein Fremder, der in eine Dorfbeiz hineingelatscht kommt, das kann nur jemand sein, der sich aufdrängt oder einschleicht mit einer kontrollierenden Absicht: zum Beispiel ein Hygieneinspektor, der die Tiefkühlfächer durchstöbert und mit Zellophan-Klebestreifen Baktierenproben nimmt. Oder ein Rauchgaskontrolleur, der im Ofen herumschnüffelt. Oder ein Hochbaukommissär, der die Wandritzen photographiert. Solches Gesindel haben wir hier schon gehabt! Behörden vom kantonalen Institut für Ich-weiss-nicht-was. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Dieser Fremde freilich war anders. Man hatte nicht das Gefühl, dass der etwas wollte oder suchte. Nein. Er gab sich bedeckt, unschlüssig, ein bisschen jenseitig. Unwillkürlich schauten wir ein wenig genauer hin, als wenn da jemand aufgetaucht wäre, den wir von irgendwoher kannten: wir schauten hin und nahm uns zurück. Die Neugier, das plötzlich aufzuckende Bedürfnis, das Gesicht dieses Mannes zu mustern, zu dechiffrieren, wurde in einer Aufwallung von Scham und Ängstlichkeit sofort erstickt. Ich, um nur mich selbst als Beispiel anzuführen, drehte am Bierglas, machte einen Spruch, lachte, imitierte mit den Fingern ein Pferdegetrappel. Nach der Begrüssung und Musterung des Fremden wollten wir so schnell wie möglich wieder zur Normalität zurückkehren. Zum Tagesgeschäft.
Andreas Wagmann, 33 Jahre, Lüftungszeichner:
In dieser Beiz, das muss ich klarstellen, sind Fremde jederzeit willkommen. Niemand macht ein Theater, wenn ein Fremder auftaucht, haben wir doch schon Leute aus aller Herren Länder bei uns gehabt: Tamilen, Tessiner, Türken, sogar Norweger. Es lag nicht an seinem Fremdsein, dass uns dieser Mann in Verlegenheit brachte, es lag an seinem stumpfen, ganz und gar nicht gelungenen Auftreten, seiner fremdartigen Gewöhnlichkeit, die uns irritierte wie ein haarloses Toupet, das eine Glatze vortäuscht. Ein Widerspruch in sich. Dieser Mann befremdete uns durch seinen vollkommenen Mangel an Exotischem. Er war sicher kein Ausländer, er wirkte sehr inländisch, er war grau und dick, aber nicht eigentlich fettleibig, sondern bloss etwas schwammig, etwas unförmig, er stand keuchend im Eingangsbereich, und seine Augen traten glasig hervor. Doch das bilde ich mir wohl nur ein. Ich schmücke eine leere Stelle aus. Ich bin nun auch so einer, der alles ausschmückt, fabulierfreudig im Trüben stochert... Ein unzuverlässiger Zeuge, jawohl, das bin ich, und ich stehe dazu. Sie wollen Informationen von uns, Herr Kommissär, sie appellieren an unser Erinnerungsvermögen, aber Sie bringen uns damit in arge Verlegenheit, denn die Eindrücke, auf die es hier ankommt, sind zu blass, zu fad, zu unbedeutend, man muss sie aufmöbeln, damit sie überhaupt etwas hergeben. Will sagen, an und für sich sind sie nichts. Allerdings sieht man im Rückblick auch manches schärfer. Das liegt womöglich daran, dass man im nachhinein ein grösserer Wissen hat über die zurückliegende Sache, weil man sie nicht mehr nur als etwas Vereinzeltes, sondern im Zusammenhang mit andern Sachen sieht. Wenn ich diesen Fremden jetzt, also im Rückblick, auseinandernehme, oder besser gesagt: wenn ich ihn jetzt, also im Rückblick, aus meinen Erinnerungsfetzen zusammenflicke, so suche ich automatisch nach den verdächtigen Anzeichen, die uns entgangen sind, denn ganz offensichtlich sind die uns ja entgangen. Was aber suche ich da? Suche ich das Gleiche wie Sie, Herr Kommissär? Verstehen Sie, was ich meine? Jetzt steht der Mann unter Verdacht, die Polizei hat ihn hochoffiziell als verdächtig deklariert, warum auch immer, und diese Verdächtigung ist wie eine eingefärbte Linse, durch die wir hindurchspähen. Sie trübt unsern Blick. Oder zeigt ihm die Wahrheit. Ich weiss nicht. Tatsache ist: niemand von uns hat auch nur den geringsten Verdacht geschöpft. Was die Erscheinung betrifft, das Äussere, die Kleidung vor allem, war dieser Mann nicht vom Schlage der Auffälligen. An ihm war nichts Besonderes. Er war wie ein Schluck Wasser. Ohne den Kopf zu drehen, schauten wir kurz hin, unterzogen den Neuankömmling einer flüchtigen Musterung, registrierten die Erscheinung, ohne auf die Details zu achten, und schauten wieder ins Bierglas. Wer hätte auch nur im geringsten ahnen können, dass dieser Mann... Wie soll ich sagen? Wäre er nicht aus der Unscheinbarkeit herausgekippt, wäre er nicht irgendwann und irgendwo auffällig geworden, so würden Sie uns wohl kaum in den Zeugenstand gerufen haben, Herr Kommissär.
Christoph Nebiker, 22 Jahre, Steuerberater:
Der Mann war grau verpackt, unmodisch seine Erscheinung, ohne Umrisse, ein Klumpen auf zwei Beinen und der Schädel haarlos wie ein Fussball. Er kam von der Strasse, die Luft um ihn herum war kalt oder nasskalt, gewiss wollte er sich hier nur mal aufwärmen, natürlich bei einer warme Mahlzeit. Er war keiner, der ziellos durch die Wirtshäuser zieht, das sah man ihm an, wahrscheinlich war's Hunger, was ihn über die Türschwelle geführt hatte. Seine Hände wuchsen zusammen, verklammerten sich ineinander. War ihm unwohl? Keiner von uns getraute sich, ihn mit weiteren Blicken zu belästigen. Wir sind anständige Leute. Wir respektierten ihn, liessen ihn sogar ausdrücklich in Ruhe, was natürlich die höchste Form des Respekts darstellt. Das Persönliche überliessen wir Oberlin, dem Wirt. Das Begrüssen mit persönlicher Ansprache fällt in seinen Zuständigkeitsbereich. Kommt ein Gast herein, begrüsst ihn Oberlin persönlich und fordert ihn mit einer unmissverständlichen Handbewegung zum Sitzen auf. Das ist wie beim Coiffeur: erst sitzend kommt man in den Genuss. Der Mann also setzte sich hin, nachdem ihm Oberlin den entscheidenden Anstoss dazu gegeben hatte. Alles weitere hat mich dann eigentlich nicht mehr so interessiert.
Klaus Zuberbühler, 47 Jahre, Metzgermeister und Kleintierzüchter:
Nachdem er das Schnitzel schwungvoll serviert hatte, legte Oberlin seine Servierhand, die, wie man weiss, in untätigem Zustand automatisch zu zittern beginnt, verkrampft an die Hosennaht. Ohne jede Despektierlichkeit sah er auf den Gast hinunter, wartete auf irgendein Zeichen, eine Reaktion. Recht so? fragte Oberlin trocken. Der Mann, der eine gute halbe Stunde zuvor ein “extragrosses Riesenrahmschnitzel” verlangt hatte, sagte nichts, machte nur eine müde Handbwegegung, worauf sich Oberlin mit grossen Schritten entfernte. Der Mann seufzte, während wir verstohlen zu ihm hinüberblickten. Es sah aus, als verrichte er ein Tischgebet. Wir beobachteten ihn, sein Verhalten war sonderbar, finde ich, es konnte nicht schaden, ihn im Auge zu behalten, einstweilen wenigstens. Wir wurden schon ein wenig unruhig, weil wir befürchteten, er würde das Schnitzel kalt werden lassen. Aber plötzlich griff er nach der Serviette, griff nach dem Besteck und fing an, mit spitz nach aussen gekehrten Ellbogen zu säbeln. Mit den Zacken seines Messers kämpfte er sich durch das Fleisch wie durch einen Granitblock. War das Riesenrahmschnitzel, das zweifelsohne aus dem Tiefkühler stammte, im Innersten von der Bratpfannenhitze unberührt geblieben? Wir hatten nicht den geringsten Zweifel, dass das Essen verpfuscht war. Oberlin, das ist allgemein bekannt, kocht miserabel: was aus seinen fettverschmierten Pfannen kommt, mag für uns Stammgäste genügen, wir sind genügsam wie Stubenfliegen. Doch ein wildfremder Gast, der hungrig in unsere Beiz stolpert und keine Ahnung hat, was da auf ihn zukommt, sollte sich keinesfalls mit dem letzten Frass begnügen müssen. Das Riesenrahmschnitzel war steinhart und einseitig angekohlt. So wie der Mann sich abmühte, war das Fleisch unmöglich essbar. Er hätte, wäre er sich dessen auch nur ansatzweise bewusst gewesen, aufgeben und das Schnitzel protestierend zurückweisen müssen. Aber nichts dergleichen geschah. Er säbelte und schnitt mit der grössten Selbstverständlichkeit. Die Anstrengung lief in Wellen über seinen Rücken. Die Schulterblätter arbeiteten wie Dampfräder. Er zerlegte das Schnitzel mundgerecht: er hatte Übung, das sah man, er wusste, wie man einem Riesenrahmschnitzel zu Leibe rückt. Systematisch wie ein Metzger ging er vor, so genau, kraftvoll und pointiert schneidet kein Feinschmecker, kein Rohköstler, kein Vegetarier. Einer wie dieser Fremde, der ganz offensichtlich nicht von Ernährungsfragen angekränkelt war, hatte uns natürlich auf seiner Seite. Wir schenkten ihm Sympathiepunkte. An unserm Stammtisch hätten wir ihm mit Freuden ein Plätzchen zugewiesen, es wäre uns leichtgefallen, ihn als unseresgleichen zu akzeptieren. Er ging aufs Ganze und hatte doch alles im Griff. Dass sich dieser Fremde so instinktsicher an die ortsüblichen Essregeln hielt, die er doch gar nicht kennen konnte, nahm uns völlig für ihn ein. Erlauben Sie mir, Herr Kommissär, dass ich, damit das auch noch ins Protokoll kommt, die ortsüblichen Essregeln hier kurz rekapituliere:
Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Was unter den Tisch kommt, schnappt sich der Hund.
Gesund ist, was sich schmerzlos verdauen lässt.
Das Essen kommt fad auf den Tisch. Versalzen muss man es selber.
Fehlt das Fleisch auf dem Teller, so fehlt wirklich etwas. Eine Beanstandung versteht sich in diesem Fall von selbst.
Hitler war Vegetarier, Churchill nicht. Es möge jeder seine eigenen Schlüsse daraus ziehen.
Allfällige Beanstandungen sind an Oberlin zu richten. In seiner Jugend ist er Preisboxer gewesen.
Ludwig Nanz, 50 Jahre, Bildhauer:
Seine Gesichtshaut glänzte wie Gummiharz. Obwohl er noch keinen einzigen Bissen zu sich genommen hatte, quoll ihm der Schweiss aus allen Poren. Es war kein sportliches, sondern eher ein träges und fettiges Schwitzen, ein Schmoren im eigenen Saft sozusagen, und dabei stand ihm das Schweisstreibendste noch bevor. Auf dem Weg zur Sättigung war das Schnitzelzerschneiden nur das Vorspiel gewesen. Das Kauen und Schlucken, das jetzt folgte, schien ungleich anstrengender zu sein. Es wurde von kräftigem Schmatzen begleitet. Hier erst lief er zu seiner Hochform auf, machte sich eine Fresslust geltend, die mit einem Servalatsalat Spezial oder einer Speckrösti nie zu stillen gewesen wäre. Der Mann hatte die richtige Wahl getroffen. Und er hatte sie blind getroffen, ohne Menükarte. Das Riesenrahmschnitzel fand Anklang bei ihm, er schüttelte sich wohlig auf seinem knarrenden Stuhl und sah manchmal kurz zu Oberlin hinüber mit einem Blick, der ein kennerhaftes Lob ausdrückte. Der Mann war zufrieden, ja glücklich, das konnte man sehen, er war nahe daran, sich in ein Baby zu verwandeln, das vor Wonne strampelt und gickst. Hauen Sie rein! hätte ich ihm gern zugerufen. So ein Schnitzel bekommen Sie sonst nirgends, nicht einmal in Wien! Kaum hatte er die Hälfte des Schnitzels zum Verschwinden gebracht, kam eine Ruhe über ihn, die ihn aufseufzen und durchatmen liess wie nach einer schweren Arbeit. Wir sahen gleich, dass das nicht einfach eine Pause war, der Mann hatte genug, er war satt, er trennte sich von seinem Teller nicht ungern, rein rechnerisch gesehen war die vertilgte Hälfte des Riesenrahmschnitzels die exakte Hälfte des Ganzen gewesen, und doch war es eine nicht geringe Hälfte gewesen: der Mann hatte eine Riesenhälfte verschlungen. Er hatte die Probe bestanden. Uns blieb nur noch, ihn heimlich zu beglückwünschen. Das störungsfreie und genussvolle Essen schien hiermit einen befriedigenden und ganz und gar passenden Abschluss gefunden zu haben. Der Mann legte Messer und Gabel auf den Teller. Ich bekenne, ich habe genug, schien er damit zu sagen. Als dies getan war, drückte er sich die zusammengeknüllte Serviette auf den Mund. Gut so, dachte ich, dieser Mann beschliesst sein Essen mit Anstand und Würde. Wo sieht man das noch heutzutage?
Lisa Zünd, 25 Jahre, Serviertochter:
Er sass da wie vom Schlag gerührt. Er machte mir Angst. Noch vor kurzem hatte er sich schmatzend und säbelnd über das Essen gebeugt, und jetzt diese Stille... War ihm schlecht? Oder lähmte ihn einfach die Sattheit? Kurzentschlossen ging ich zu ihm hin und erkundigte mich, ob es gemundet habe. Es hat, sagte er. Seine Augen waren rund und glasig. Fischaugen. Ich beugte mich nach vorn, um abzuräumen. Das geschah ganz automatisch: ich nahm den Teller auf und das Besteck. Als ich mich damit zur Küche umdrehte, packte er mich blitzschnell am Handgelenk. Danke, sagte er. Haben Sie vielen Dank. Ich erschrak. Er quetschte mir den Puls. Sie müssen, sagte er, den Teller gründlich auswaschen, damit der nächste Gast ihn sauber vorfindet... Ja, aber sicher, sagte ich, wollen Sie vielleicht ein Dessert, Kaffee? In meiner Konsternation spielte ich die beflissene Serviertochter. Unmöglich hätte ich mich entwinden können. Seine Hand war wie die Greifzange eines Roboters. Er schüttelte den Kopf, liess los. Sofort sank er wieder in sich zusammen. Ich huschte davon, den Teller hätte ich am liebsten in den Mistkübel geworfen. Grundgütiger, was war das für ein Mensch? Ich erinnere mich, dass er unter der linken Schläfe etwas hatte, eine kleine Ausstülpung, eine Art Knollengewächs oder Knorpel. Grusig! Menschen, die so etwas am Gesicht haben, sollten sich wenigstens anständig benehmen. Ich sah ein, dass ich das Abräumen Oberlin hätte überlassen müssen. Er hatte schliesslich auch die Bestellung aufgenommen, mit gutem Grund, wie ich jetzt sah. Dieser Fremde war unberechenbar. Was der sich mir gegenüber herausgenommen hatte, war nicht nur eine Unverschämtheit, es war eindeutig etwas, das in Richtung Geistesgestörtheit ging. Ich verzog mich schnurstracks und mit eingezogenen Schultern in die Küche, während am Stammtisch geschwatzt und gelacht wurde wie immer.
Rudolf Oberlin, 62 Jahre, Wirt:
Da staunen Sie, was? Die Pokale im Schaukasten sind nicht vom Schützenverein. Die sind von mir. Ich bin Preisboxer gewesen, und ich kann Ihnen sagen, Herr Kommissär, meine Schlagkraft ist ungebrochen. Ich kann dreinhauen, wenn es sein muss. Angst hat er mir keine gemacht, dieser Fremde, im Gegenteil. Ich habe mich um einen harmlosen Eindruck bemüht, damit er nicht etwa Angst bekommt vor mir. Auf Fremde wirke ich einschüchternd, ist auch kein Wunder bei meiner Grösse. Meine Frau würde sagen: du bist nicht gross, du bist nur dick. Aber das stimmt nicht. Ich bin ein Riese. Wie dieser Typ bei Charlie Chaplin, dieser Koloss mit den rollenden Augen. Sieben Polizisten stürzen sich auf ihn, und er, der sich das seelenruhig gefallen lässt, spürt ein Jucken hinter dem Ohr und hebt die Hand, um sich zu kratzen, und die sieben Polizisten purzeln in den Dreck. Oh, verzeihen Sie, Herr Kommissär, das gibt’s natürlich nur im Film. In der Realität sind wir Riesen eigentlich ganz gemütlich. Wer mich kennt, weiss ja, dass ich ein guter Mensch bin. Am Stammtisch machen sie manchmal Sprüche darüber, und ich lache mit. Sie nennen mich Petrus, weil ich in die Bibelstunde gehe. Das kratzt mich nicht. Ich stehe dazu. Petrus ist auch Boxer gewesen. Haben Sie das gewusst? Petrus, der Fels, zwei Fäuste für ein Halleluja. Die Tische in meiner Beiz sind aus Hartholz. Bei einer Prügelei sind sie das Letzte, was in die Brüche geht, sie überstehen alles, auch das letztjährige Turnfest haben sie ohne einen einzigen Kratzer überstanden. Biersaalschlachten sind hier nichts Ungewöhnliches. Das muss ich sagen, wir haben hier schon Leute gehabt, die es wirklich drauf angelegt haben, in hohem Bogen hinausspediert zu werden. Schlimme Leute. Der Fremde, nein, der war nicht schlimm, nicht im geringsten. Der war nur seltsam. Man wusste nicht so recht, was mit ihm los war, und es war doch eigentlich so, dass nichts mit ihm los war, und genau das war der Punkt, über den man zu rätseln begann. Mit diesem Menschen war einfach nichts los. Er war wie nicht da, wie nicht vorhanden, ein Garderobenständer mit Mantel, und irgendwo ein Gesicht, das als solches durchaus Erwartungen weckte. Er war als Mensch zu betrachten, dieser Mann, völlig logisch. Man scheute vor ihm zurück und konnte, zumindest in Gedanken, doch nicht von ihm ablassen. Denn dieser Garderobenständer konnte sich bewegen, einen Platz einnehmen, ein Schnitzel bestellen - und dieses Schnitzel mit Messer und Gabel bearbeiten. Das war faszinierend, glauben Sie mir. Doch über diese Faszination kam niemand hinaus. Sie band uns alle zurück. Die Hemmung war total. Niemandem wäre auch nur im Traum eingefallen, ein Gespräch mit ihm anzufangen. Man hatte von ihm gleich den Eindruck, er sei nicht ganz gesprächswürdig. Infolgedessen behandelte man ihn als Auslassung. Das war einer, den man ausliess, sich selbst überliess, instinktiv. Der kam für nichts in Frage, nicht einmal für ein kurzes Gespräch. Ganz offensichtlich war es dieser Mann nicht wert, dass man sich mit ihm abgab, und nicht etwa deshalb, weil er etwas Schlechtes an sich gehabt hätte, nein, es war einfach nichts an ihm dran, nicht einmal etwas Schlechtes. Was in ihm vorging, schien rein mechanisch zu sein, er war viel eher Gegenstand als Mensch. Etwas, das sich allzeit gleich bleibt, irritiert, wenn dieses Etwas ein Gesicht hat. Ein menschliches Gesicht! Für mich, als Gläubigen, ist das schrecklich. Einen Sünder kann ich wenigstens ins Gebet nehmen. Um den kann ich mich kümmern, da gibt es Veränderungspotential, eine Art Beeinflussbarkeit oder Ansprechbarkeit. Aber was soll ich mit einem Garderobenständer machen, der ein Schnitzel bestellt? Darüber steht in der Bibel nichts. Es gibt Merkwürdigkeiten, die wir nicht begreifen, es gibt Dinge, die es eigentlich gar nicht geben dürfte. In solchen Fällen bleibt man am besten aufgeschlossen und freundlich. Das zahlt sich aus: für beide Seiten. In aller Freundlichkeit und mit den lockersten Arm- und Beinbewegungen habe ich ihm sein Schnitzel serviert, den Körper leicht abgedreht, Handteller und Teller schwungvoll gehoben, das Riesenrahmschnitzel im freien Flug, und dann hinab auf den Tisch damit! “Voilà”. Und der Mann hat sich aufrichtig bedankt. Der Mann hat sich verhalten wie ein Gast, und ich habe mich verhalten wie ein Wirt. Er hat ein Schnitzel bestellt, und ich habe ihm sein Schnitzel gebracht, auf dem Luftweg sozusagen. Und das Schöne dabei: der Fremde hat sich in einen Menschen verwandelt. Für einen kurzen Augenblick ist das Menschliche in ihm durchgedrungen, hat sich bemerkbar gemacht. Ihn persönlich und aus dem ganzen Herzen heraus zu bedienen, hat sich also gelohnt! Das mache ich sonst selten. Das Bedienen ist eigentlich Lisas Job. Ich sträube mich dagegen, einen Fremden gleich zur Chefsache zu erklären, nur weil er fremd ist, aber diesmal war ich doch darum bemüht, dem Fremdsein dieses Fremden mit meiner ganzen christlichen Wärme entgegenzutreten. Ausserdem konnte ich Lisa, meine Serviertochter, mit diesem Extrazügli ein wenig entlasten. Heute Abend, Herr Kommissär, halten wir im Ochsen das monatliche Jassturnier ab. So ein Anlass gibt schon im voraus eine Menge zu tun, besonders für Lisa. Nur falls Sie mitmachen wollen, Herr Kommissär, wir praktizieren den berüchtigten Kampfjass, da wird geklopft und geschoben, dass es eine Freude ist. Zu gewinnen gibt es einen Fresskorb.
Werner Krähenbühl, 48 Jahre, Polizeikommissär:
Konrad Furler, 41 Jahre, wohnhaft in der Nachbargemeinde Schöfligen, Sekundarschullehrer und Präsident der Kantonalen Veganer-Gesellschaft, soll im Ochsen ein Schnitzel verzehrt haben. Etliche Zeugen haben dies einwandfrei bestätigt. Zur fraglichen Zeit, so etwa gegen elf Uhr nachts, residierte in der Beiz die übliche Stammtischrunde. Als Herr Furler sein Nachtessen beendet hatte, zückte er sein Portemonnaie und bezahlte. Soweit aus den Zeugenaussagen rekonstruierbar, verhielt er sich hier noch weitgehend korrekt. Als er bezahlt hatte, machte er sich auf den Heimweg, schlafend, wenn auch mit offenen Augen. Er hatte die ganze Zeit schon geschlafen, hatte schlafend sein Bett verlassen, hatte sich schlafend angekleidet und hatte schlafend den Ochsen besucht, um dort ein Schnitzel zu verzehren. Und als er wieder nach Hause ging, schlief er noch immer. Niemand identifizierte ihn als Schlafwandler. Erst recht nicht, als er mitten auf der Strasse nach Hause spazierte. Er trug ja keinen Pyjama. Man hielt ihn für alkoholisiert. Autos wichen ihm hupend aus. Wie durch ein Wunder kam niemand zu Schaden. Noch hängig ist die Frage, ob Herr Furler für sein grobfahrlässiges Verhalten gebüsst werden kann. Das mögen die Juristen entscheiden. Oder die Ärzte. Da Schlafwandler in der Regel Wiederholungstäter sind, habe ich Herrn Furler schon mal angeraten, vor dem nächsten Zubettgehen Fenster und Türen ausbruchsicher zu verschliessen.
2010
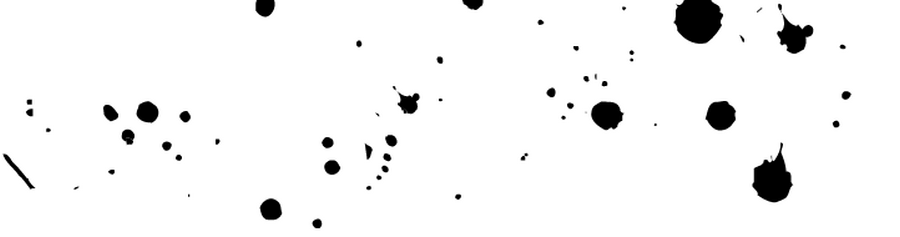 wörter
worte
wörter
worte