
Kulturland
Was ist Schweizerisch an der Schweizer Kunst?
Wenn ich hier über das Schweizerische in der Schweizer Kunst schreibe, so hat das mit der Frage, wie Schweizer Künstler die Schweiz thematisieren, nur am Rande zu tun. Auch die helvetische Kulturpolitik soll hier nicht im Vordergrund stehen. Das Schweizerische als eine Form der Selbst- oder Fremdzuschreibung, als Identifikationsmöglichkeit oder Kernpunkt politischer Reflexion ist Gegenstand zahlreicher Bücher und Abhandlungen, die aber zum überwiegenden Teil die Wechselwirkung zwischen dem Schweizerischen und seiner künstlerischen Manifestation ausser Acht lassen. Oft hat man es bei dieser Wechselwirkung mit Phänomenen zu tun, die das gängige Schema der Kunst- und Kulturreflexion unterlaufen. Folgt man diesem Schema, das hauptsächlich von Künstlern, Kunstkommentatoren und Kulturpolitikern getragen wird, so erhält man ein sehr einseitiges Bild. Das Schweizerische ist für sie das, was die Künstler in Bezug auf die Schweiz thematisieren. Was die Künstler bewusst aus ihrem Schweiz-Bezug herausfiltern. Und die Kunst, die daraus entsteht, hat dann eben etwas “Schweizerisches”. So einfach ist es natürlich nicht. Was die Künstler willentlich und vielleicht sogar mit offiziellem Mandat zum Thema “Schweiz” beitragen (Stichwort "Expo 2002"), ist für meine Betrachtung nicht relevant, weil zu eng gefasst. Um eine solche Engführung zu vermeiden, nehme ich mir die Freiheit heraus, die Künstler nicht als Subjekte, sondern als Objekte zu behandeln. Ihre Kunst interpretiere ich als etwas, das sich der Schweiz zuordnen lässt, weil es typisch ist für die Schweiz. Auch im ungewollten Sinn. Auch ohne Absicht - und oftmals sogar gegen die Absicht der Künstler - zeigen sich in der Schweizer Kunst Wesensmerkmale, die sich sehr direkt mit historischen, mentalen und kulturellen Besonderheiten der Schweiz in Verbindung bringen lassen. So wie ein Ethnologe den Federschmuck und die Kriegsbemalung einer Stammeskultur untersucht, möchte ich anhand der Kunst das Eigene und Unverwechselbare der Schweiz in den Blick bekommen. Kunst, so meine These, ist nicht voraussetzungslos. Sie entsteht nicht in der Isolationshaft des White Cube. Sie entsteht nicht als Produkt einer globalisierten Differenzlosigkeit. Sie beruht auf Differenz, auf Eigenheit und kultureller Begrenzung. Sie ist auf vielfache Weise bedingt, zum Beispiel auch durch das Land, in dem sie entsteht. Das Land wiederum - ich nehme hier die Schweiz, weil ich Schweizer bin und dieses Land einigermassen kenne - definiert sich in vielen seiner Belange über die Kunst und findet Eingang ins Kunstgeschehen, ohne dass damit eine explizite Absicht verbunden sein müsste. Eine solche Kunst braucht nicht Staatskunst zu sein - und auch nicht Auftragskunst für die Expo.
Wie lässt sich das Schweizerische fassen? Wie manifestiert es sich? Fassbar wird es in verschiedenen Narrativen, deren Themen und Motive sich wie Eisenspäne verhalten, die die Feldlinien eines Magneten nachzeichnen. Jedes Narrativ ist eingebettet in ein historisches, soziales und kulturelles Bezugssystem, von dem es unablässig geformt und in eine identifizierbare, aber auch wandelbare Ordnung gebracht wird. Vertieft man sich in die Schweizer Geschichte, so wird man sich an Erzählungen orientieren können, die scheinbar nie an ein Ende kommen und immer wieder neu erzählt werden. Ich meine damit nicht die urschweizerischen Mythen von Wilhelm Tell oder Winkelried. Ich meine auch nicht historische Anekdoten über “prägende Schweizer” wie Niklaus von Flüe oder Henry Dunant. Solche Figuren werden im allgemeinen überschätzt. Die grundlegenden Erzählungen des Schweizerischen sind viel umfassender. Es sind Meta-Erzählungen, die sich - epochenübergreifend - um einige wenige Begriffe ranken.
Der helvetische Mikrokosmos: Die Schweiz ist gross, weil sie klein ist.
Der performative Staatsakt: Die Schweiz schöpft aus ihrer performativen Staatskultur das kritische Potential, das die Mechanismen dieser Staatskultur hinterfragt.
Der alpine Irrationalismus: Die Schweiz verbindet sich mit der Welt, indem sie ihre weltabgewandte Binnenkultur offenhält für universale geistige Strömungen.
Schweizerberge: Das keineswegs naturnotwendige Staatsgebilde Schweiz, das seine Identität künstlich erschaffen muss, konstruiert das Phantasma einer Bergwelt, die die Würde einer naturnotwendigen Existenz und Identität vorspiegelt, resp. kulturell potenziert.
Der helvetische Mikrokosmos
Die Schweiz: ein behüteter Mikrokosmos im welthistorischen Abseits. Trotz beflissener Widerlegungsversuche hält sich dieses Klischee hartnäckig. Was ist dran an diesem Klischee? Tatsache ist, dass die Schweizer, eingezwängt zwischen Bergen und ohne Zugang zu den Küsten, die die Welt bedeuten, gelernt haben, miteinander auszukommen. Das im Bauernstand verankerte Statusdenken sowie das Fehlen einer kulturellen Metropole haben die Separation verstärkt. Das Zusammenleben unter solchen Bedingungen und Vorzeichen hat eine besondere Form der Höflichkeit, der Rücksichtnahme hervorgebracht. Man ist nett zueinander, man lebt im Konsens. Alles ist eng miteinander verflochten: was nicht nur geografisch, sondern auch politisch bedingt ist. Trotz seiner Kleinräumigkeit ist das Land föderalistisch zersplittert. Der “Kantönligeist” erzeugt und gefährdet den übergeordneten Konsens gleichermassen. Ein derart dezentrales Staatsgebilde muss ständig austariert werden. Es verlangt von allen Beteiligten Takt und Sinn für Ausgewogenheit. Die Schweiz ist eine Konkordanzdemokratie, keine Konkurrenzdemokratie. Entscheidungen werde unter Einbezug von möglichst vielen Interessen gefällt. Auch an sich unbedeutende Akteure dürfen mitreden und mitmachen. Basisdemokratie und Milizsystem stehen in enger Wechselwirkung. Das Volk regiert und verwaltet sich buchstäblich selbst. Dies setzt einen ganzen Katalog von Selbstregulierungstechniken voraus. Wer mitbestimmt, muss in der Lage sein, Verantwortung zu tragen. Wer Rechte hat, hat auch Pflichten. Im Wechselspiel von Engheit und Kleinteiligkeit, Konsensbildung und Föderalismus sind Ökonomie, Sicherheit und Überschaubarkeit die zentralen Werte des Zusammenlebens. Ein Ausscheren ist kaum möglich. Ein Verstoss gegen Alltagskonventionen wird mit strengen Sanktionen bestraft. Zwar haben sich gewisse Dinge seit den Achtziger Jahren etwas gelockert, die „freie Sicht aufs Mittelmeer” ist kommunikationstechnisch verwirklicht, der Mief ist verflogen: aber die Kleinräumigkeit bleibt. Und die politischen Strukturen der Schweiz zeigen sich erstaunlich stabil. Sie funktionieren wie ein Korsett, das man, weil es so gut anliegt, als Teil des Körpers empfindet. Der Zwang zur Verkleinerung, Anpassung und Mittelmässigkeit wird verinnerlicht und sublimiert. Die Schweizer sind ein Volk von Briefmarkensammlern und Modelleisenbähnlern. Nirgends stehen so viele Miniaturen und Modelle herum wie in der Schweiz, die sich ja selber gerne als Modell- oder Musterstaat präsentiert. Überall herrscht das geradezu zwanghafte Bedürfnis, Übersicht und Ordnung zu schaffen. Hat die Schweiz deshalb so viele Architekten, Ingenieure, Präzisionsmechaniker und Topographen hervorgebracht? Sind die Schweizer vernarrt in Massarbeit, Blaupausen und errechenbare Visualisierungen? Sind sie Modellfreaks? Als Beispiel könnte man den eidgenössisch diplomierten Ingenieur-Topographen Xaver Imfeld nennen, der an der Weltausstelllung von 1900 grosses Aufsehen mit einem supergenauen Jungfrau-Relief im Masstab 1:2500 erregte. Ins Kleine zu flüchten, um Grösse zu verwirklichen: dahin tendiert bis heute auch die Schweizer Literatur. Schon bei Salomon Gessner und Gottfried Keller kommt dieser Wesenszug zum Vorschein, radikaler dann bei Robert Walser, der das Kleine, Herzige und Niedliche sprachgewaltig beschwört. Dürrenmatt hingegen beschreibt den schweizerischen Mikrokosmos als ein pandämonisches Irrenhaus, in welchem sich das universelle Menschheitsdrama spiegelt. Der Hang zum Mikroskopischen drückt sich nicht nur inhaltlich aus, sondern auch formal. Schweizer Schriftsteller bevorzugen mehrheitlich die kleine Form, die Erzählung, die Skizze, den Aphorismus. In seinem berühmten Kellerloch schreibt Ludwig Hohl 20 Jahre lang an unzähligen Textfragmenten, die er an Wäscheleinen aufhängt, um sie zu systematisieren. Peter Bichsel macht aus der Kolumne eine eigenständige literarische Gattung. Klaus Merz, ein Meister der Verknappung, schreibt Romane, die gerade mal 30 Seiten umfassen. Natürlich ist dies eine unzulässige Vereinfachung. Man könnte auch sagen: eine Hypothese. Da die hiesigen Schriftsteller (mit Ausnahme der Rätoromanen) durch den Gebrauch der jeweiligen Hochsprache immer auch an einem überstaatlichen Kultur- und Sprachraum teilhaben, muss man der selbstgefälligen Annahme, es gebe eine typische Schweizer Literatur, mit Skepsis begegnen. Die oben skizzierten Besonderheiten verweisen auf ein Spannungsverhältnis, eine heikle Asymmetrie zwischen Hochkultur und helvetischer Randständigkeit, doch wäre es falsch, ja völlig verkehrt, die Schweizer Literatur in eine staatliche Zuschreibung hineinzuzwängen. Das Typische an der Schweizer Literatur ist eben nicht das Nationale, sondern das Regionale. In der immer noch provinziell zersplitterten Kultur dieses Landes gibt es eine intensive Beziehung zwischen Sprache, Mentalität und Ort, ein ausgeprägtes Lokalkolorit. Der helvetische Mikrokosmos ist für die Kultur, die er hervorbringt, auch die Schriftkultur, geradezu stilbildend. Die hochsprachlichen Werke, die in seinem Bannkreis entstehen, haben oft etwas Kleinteiliges und In-sich-Verkrümmtes, eine präzise, aber völlig isolierte, unverbundene, sich selbst absolut setzende Scharfeinstellung im Nahbereich, die eines immer wieder ins Bewusstsein bringt und als eine Art Urtopos des Schweizerischen mehr oder minder originell variiert: die Diskrepanz zwischen Kleinheit und Vergrösserung, zwischen dem sich ins unendlich Mikroskopisch verästelnden Winzigen, dem man sich zugehörig fühlt, und dem Grossen-Ganzen einer ersehnten Weltläufigkeit. Dies gilt besonders für die Deutschschweiz, da hier Mundart und Schriftsprache stärker differieren als in der lateinischen Schweiz. Die sprachliche und kulturelle Asymmetrie bricht sich in der deutschschweizer Literatur wie ein Lichtstrahl in einem Prisma. Daraus hat sich ein komplexes Verhältnis der Schreibenden zu ihrer Mutter- und Schriftsprache entwickelt. In der Mundart, der eigentlichen Muttersprache, geht es häufig um Kleines und Kleinstes, um Privates und Familiäres: für Weltpolitik, tragische Befindlichkeiten oder wissenschaftliche Ausführungen fehlen häufig die Wörter. Die grosse dichterische Anrufung kann nicht mit einem “Grüezi” beginnen, genausowenig wie eine Dissertation. Dem hochdeutsch schreibenden deutschschweizer Schriftsteller fehlen die grossen Wörter natürlich nicht. In der Regel schreibt er ein ebenso gutes Deutsch wie ein Deutscher. Trotzdem bleibt er auf die Mundart bezogen, unterschwellig baut er sie in sein Schreiben ein. Im Gegensatz zum bildenden Künstler, für den es keine Rolle spielt, ob er beim Malen auf Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch flucht, ist der Schriftsteller von seiner Muttersprache abhängig, nicht nur sprachlich, sondern auch mental. Schriftsprache transportiert immer auch Anklänge an Dialekt, Jargon und eine bestimmte emotionale Verwurzelung. In Texten ist der Anteil an Persönlichem grösser als in Bildern. In einem Text "outet" sich Biografisches, Eigenes, Unbewusstes fast zwangsläufig. Nicht nur graphologisch, d.h. durch die Handschrift. Sprachliche Codierung (egal ob handschriftlich oder mit dem Computer) dient sozusagen der Verlängerung der Stimme und der Gestik, ja des Körperlichen überhaupt, dient auch der Artikulation von Gähnen, Rülpsen, Weinen, Lachen, Zähneknirschen und Schwitzen. Tatsächlich charakterisieren viele Dichter und Schriftsteller in entsprechenden Selbstzeugnissen das Schreiben als eine zutiefst körperliche Angelegenheit, als etwas, das der Verdauung näher steht als dem Intellekt. Ganz anders verhält es sich mit dem Bild. Sogar in seinen körperlichsten Manifestationen - etwa als Ausdrucksmalerei - ist das Bild für seinen Schöpfer eine Art Maske, ein Schutzschirm. Die Maske schweigt, auch wenn sie noch so wild bemalt ist. Man kann sich dahinter verstecken. Texte dagegen (siehe Psychoanalyse) haben immer etwas sehr Persönliches, wenn nicht sogar Intimes - und vielleicht gerade dann, wenn der oder die Schreibende flunkert, sich bewusst verstellt. Der zweite Punkt, der hier zu nennen wäre, ist kulturhistorisch bedingt. Literatur ist das Medium, das den helvetischen „Diskurs in der Enge“ (Paul Nizon) angeworfen und über weite Strecken ausgetragen hat. Wenn ein deutschschweizer Schriftsteller ein gutes Hochdeutsch schreibt, schreibt er es bewusst in Abgrenzung zum “Stallgeruch” seiner Muttersprache. Diese Abgrenzung enthält eine ideologische Komponente, das Bemühen, aus dem mentalen Gefängnis der Schweiz herauszukommen. Daran kann sich ein hiesiger Schriftsteller abarbeiten. Er formt sich im Widerstand gegen die eigenen Voraussetzungen. Er redet nicht, wie er schreibt, und schreibt nicht, wie er redet. Diesen Zwiespalt trägt er in sein Schreiben hinein. Nicht selten läuft das auf eine gewisse Ambivalenz hinaus (etwa eine Hassliebe zur Schweiz) und führt zu einer gesteigerten sprachlichen Differenzierungsfähigkeit, die vielen deutschen Autoren abgeht. Darin liegt denn auch der Grund, weshalb die abseits stehende Schweiz - aufs Ganze gesehen - mehr bedeutende Literatur hervorgebracht hat als alle deutschen Metropolen zusammengenommen. (Literarisch überproportional vertreten sind auch die österreichische Provinz, das deutschsprachige Prag und andere Randzonen der deutschen Sprache. Wenn man so will, kann man auch Weimar dazuzählen: im 18. Jahrhundert ein belächeltes Provinznest). Der helvetische Mikrokosmos wirkt auch in die bildende Kunst hinein, wenn auch häufig verdeckt, diskret, nicht selten hinterhältig. Das Künstlerduo Fischli und Weiss fokussiert mit leisem Witz die Alltagswelt. Bestimmt geht es ihnen nicht um die Schweiz, aber ihre berühmt gewordene Mikrowelt aus Wurstscheiben und kindlichen Tonmännchen ist dennoch unverkennbar schweizerisch. An der Arbeit „Und plötzlich diese Übersicht“ (1981, 250 Tonskulpturen) ist der helvetische Hang zu Miniaturisierung und Modellhaftigkeit besonders gut ablesbar. Fischli und Weiss schaffen hier ein grossartiges Panoptikum der Nebensächlichkeiten, in welchem mit gnomisch-hintergründigem Humor gerade das Unbedeutende, Winzige, Unvermerkte, das Zwischen-den-Zeilen-Stehende herausgestellt und in einen absurden Gesamtzusammenhang gebracht wird. Die enzyklopädische Breite, die da vorgespiegelt wird, entsteht durch ein schulbubenhaftes Aufsummieren von Dingen, die auf vernünftige Weise niemals zusammengefunden hätten. Eine Besonderheit stellen bei Fischli und Weiss die Werktitel dar. („Marco Polo zeigt den Italienern zum ersten Mal die aus China mitgebrachten Spaghetti“). Die ironisch-narrativen Titel verhalten sich integrativ, sie sind also nicht aufgesetzt oder angehängt. Indem sie sich den benannten Objekten einschreiben, schalten sie von vornherein jede Bestrebung aus, das Werk mit einer intellektuell überhöhten, nicht von den Künstlern beabsichtigten Bedeutung aufzuladen. Zu dieser Ironisierung vermerkt Elizabeth Armstrong: „Tatsächlich haben die beiden Künstler ausdrücklich kundgetan, dass sie einer mit Bedeutung überfrachteten Kunst misstrauen, und hierfür in mehreren Gesprächen den Begriff Bedeutungskitsch verwendet.” Die helvetische Abneigung gegen das Grosse, Überhöhte und Extreme, eben den „Bedeutungskitsch“, wird bei Fischli und Weiss zu einer künstlerischen Haltung. Das Gleiche finden wir bei Robert Walser, der den literarischen Tendenzen seiner Zeit widerstand, indem er sich selbst und die Welt im Spiegel seiner Sprachartistik miniaturisierte. Aber anders als zu Robert Walsers Zeiten, als die Abneigung gegen Grosstuerei auch dem Willen entsprach, sich gegen die Grösseren und Stärkeren zur Wehr zu setzen, wird der helvetische Mikrokosmos heute kaum noch als Einschnürung erlebt. Das Schwanken zwischen Trotz und Duckmäusertum im Umgang mit der Kleinheit ist einer wohligen Nonchalance gewichen. Man könnte auch sagen: einer heiteren Resignation. Die Schweiz hat sich geöffnet, auch Kritik gegenüber, und trotzdem behält sie ihren Eigensinn. Nostalgie und Folklore haben Hochkonjunktur. Swissness auf allen Kanälen. Der Begrenztheit ihres Landes gewinnen die Künstler oftmals spielerische Reize ab. Im Rückblick wird die bünzlihafte Schweiz verklärt und rehabilitiert. Es ist eine Schweiz, die ausserhalb ihres Revivals längst nicht mehr existiert, vielleicht so, wie man sie sich heute vorstellt, gar nie existiert hat, weshalb sie, ähnlich wie die DDR, als subjektives Erinnerungsmoment Eingang in die Kunst findet. Hier wird die Schweiz zur “Schweiz unter der Glashaube”, sie wird zu einem virtuellen Spielplatz rückwärtsgewandter Phantasie. Ein gutes Beispiel für diesen Trend liefert das in Basel arbeitende Künstlerpaar Monica Studer und Christoph van den Berg. In ihrem Netzkunstprojekt „Vue des Alpes“ wird der Mikrokosmos Schweiz als Alpenferienwelt rekonstruiert – mittels einer Erinnerung, in der eigenes Erleben und mediale Vermittlung unentwirrbar ineinander verschlungen sind. Auffallend an dieser Welt ist die wehmütige Nostalgie, die evoziert wird durch die Menschenleere sowie die penibel gestaltete Gegenständlichkeit. Selbst die Natur wirkt hergerichtet: ein makelloses Designprodukt „made in Switzerland“. Eine mehr oder weniger reale Entsprechung zu der Welt von „Vue des Alpes“ findet meine Generation (die sogenannte "Generation Golf") in seltsam präparierten Kindheitserinnerungen. Eine klinisch heile Welt mit den immergleichen Figuren und Gegenständen, eine Schutzzone aus Geranien, Fototapeten und weissen Plastikstühlen. Im Fernsehen Mäni Weber, Kurt Felix und das unverwüstliche Trio Eugster. Damals, in den späten Siebzigern, war die Welt noch in Ordnung und die Schweiz noch das Land, über das Peter Bichsel schreiben konnte: „Die Schweiz ist mir bekannt. Das macht sie mir angenehm.“ Mit dieser Selbstverständlichkeit könnte das heute niemand mehr sagen.
Der performative Staatsakt
Was sich der Legende nach am 1. August 1291 auf der Rütliwiese abgespielt hat, würde man heute als Performance bezeichnen. Drei Männer treten zusammen, deklamieren ein Gelöbnis, formieren sich, ein Bein vorgestellt, um eine imaginäre Mitte, während jeder die drei Schwurfinger (Zeige-, Mittelfinger und Daumen) feierlich hochhält. Der Gründungsmythos der Schweiz definiert sich weniger durch ein abstraktes Gedankenmodell als durch einen verblüffend einfachen, für jedes Kind nachvollziehbaren performativen Akt. Den Rütlischwur kann man nachspielen, man kann ihn erneuern durch Wiederholung, (wie einen Zaubertrick oder ein chemisches Experiment), man kann ihn ständig aktuell halten. Dies ist der grosse Vorteil eines performativen Gründungsaktes. Papier zerfällt, Statuten veralten, Urkunden könnten gefälscht sein. Die Handlung einer Beschwörung jedoch braucht nur von neuem vollzogen zu werden – und schon steht man auf der Rütliwiese, mitten in den blühenden Alpenblumen, und es ist der 1. August 1291. Performance als Akt der Vergegenwärtigung. Natürlich wird sich niemand in der heutigen Schweiz direkt auf den Rütlischwur beziehen, nicht einmal ein Albisgüetli-Redner. Schillers „Seid einig, einig, einig“ klingt für heutige Ohren zu pathetisch. Man hat gelernt, Dichtung und Politik auseinanderzuhalten. Die Berufung auf diese Einigkeit kann sich höchstens Pipilotti Rist leisten, die anlässlich ihrer Ernennung zur Directeur artistique der Expo die Schwurhand hochhob und sicher sein konnte, dass die Ironie auch wirklich verstanden wurde. Doch ist die Symbolkraft dieser Beschwörung wirklich von gestern? Schauen wir uns die legendäre Neujahrsansprache des vormaligen Bundespräsidenten Adolf Ogi an, gehalten am 1. Januar 2000 vor dem Lötschbergportal. Neben Ogi ein mickriges, fast nacktes Weihnachtsbäumlein, Ogi dick eingehüllt in einen Wintermantel. Er redet mit treuherziger Emphase, beschwört die Zukunft, die Zuschauer, die Schweiz, das Identitätsgefühl. Indem er jedes Ästchen des Tännleins in die Hand nimmt und zum Sinnbild einer bestimmten Bevölkerungsgruppe erklärt, performt er eine Zukunftsverheissung, die greifbarer nicht sein könnte. Diese Rede, die mit ihrer hölzernen Rhetorik und dem ausgefallenen Setting wie eine Selbstparodie wirkt, hat sogar im Ausland Beachtung gefunden. Viele Deutsche und Österreicher wurden Ogi-Fans, es war der grösste Imagegewinn für die Schweiz seit Henry Dunant. Was sich hier in einer unfreiwillig genialen Performance manifestiert hat, hat kaum etwas mit Inhaltlichkeit zu tun, viel aber mit Inszenierung, mit Emphase, Aussprache, Gestik und Szenerie. Der Künstler Christoph Büchel hat sich Ogis Rede angeeignet, um sie als Video-Arbeit unverändert in den Kunstkontext zu stellen. („La Suisse existe“, 2000) Für Büchel ist dieses Video eine hochpolitische Manifestation des Schweizerischen. Ogi war nicht zuletzt deshalb ein so beliebter Politiker, weil er medienwirksam und ehrlich-unbeholfen (und damit auch sympathisch) den Gründungsakt der Schweiz am Laufmeter wiederholte – mit Variationen, aber gleichwohl echt schweizerisch. Die Legende vom Rütlischwur hat nicht nur eine staatstragende Ikonographie hervorgebracht, sondern sie initiiert und trägt auch eine Politkultur, die ganz wesentlich von performativen Elementen lebt – auch dort noch, wo diese ins Lächerliche abgleiten. Wenn Sibylle Omlin in ihrem Vorwort zum Buch „Performativ! Performance-Künste in der Schweiz“ darauf hinweist, dass das Performative hierzulande auf fruchtbaren Boden gefallen sei, so hat sie doch Mühe, die Ursachen hierfür zu benennen. Omlin: „Es hat wenig Sinn, eine Urszene des Performativen für eine nationale Kunstszene auszumachen oder diese wandelbarste aller Künste in einem fixen zeitlichen Moment zu begründen. Was aber auffällt, ist, dass in der Schweiz dank ihrer Transitlage Elemente von performativer Kultur teilweise auf einen fruchtbaren Boden gefallen sind.“ Natürlich sind die Dadaisten vor allem deswegen nach Zürich gekommen, weil sie sich hier inmitten des Kriegs quasi transitorisch miteinander verbinden konnten, aber das allein erklärt noch nicht, warum ausgerechnet die verklemmte und konservative Schweiz immer wieder mit stark körperbetonten Ausdrucksformen assoziiert wird. Die Transitlage genügt als Erklärung nicht. Muss man nicht annehmen, dass der fruchtbare Boden schon vor den Dadaisten dagewesen ist? Wenn man sich mit der Schweizer Geschichte des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts befasst, so wird man mit einem Übermass an phantastisch auswuchernden helvetischen Bräuchen konfrontiert: mit dem Festspiel, der feierlichen Deklamation, dem Jodeln, der Viehschau, dem Turn- und Schützenfest, dem Sektionsschiessen, dem Umzug, dem historischen Tableau. Was die Dadaisten im Cabaret Voltaire veranstalteten, war keineswegs neu. Neu war nur die antibürgerliche Geste, das Ausbrechen aus rituellen Codes. Nicht neu, sondern für schweizerische Verhältnisse geradezu alltäglich, war das öffentliche Spektakel, das theatralische Sich-Produzieren und Sich-Aufführen, das kultische Gemeinschaftserlebnis, der feierliche Krawall. Besonders die vaterländische Schaustellung erfreute sich damals regen Zulaufs. So auch am Eidgenössischen Schützenfest von 1892 in Glarus. Weibliche Allegorien, angeführt von der personifizierten „Freiheit“ (mit Schweizerbanner), gruppierten sich im Hintergrund der Bühne um eine Stimmurne mit der Aufschrift „Vox populi“. Vorne postierten sich die Träger des „nationalen Gedankens“. 22 Knaben stellten die Kantone dar. Alphornbläser und Schützen, Sänger, Turner und Arbeiter würdigten das Vereinswesen. Die Kulisse war ein Bergpanorama, und als musikalische Untermalung diente „O mein Heimatland“. Dass die biederen Eidgenossen vom dadaistischen Getöse berührt wurden, dass sie mitmachten, wenn auch protestierend, darauf konnten die Dadaisten zählen: sie trugen Eulen nach Athen. Jede Gemeindeversammlung und Landsgemeinde landauf, landab war ja schon eine Performance, jede Vereinssitzung, jede Gant, jedes noch so kleine gesellschaftliche Ereignis wurde zelebriert mit Schauspiel, Verkleidung, Musik und allerlei Ansprachen. Zahlreiche militärische Organisationen, die Studentenverbindungen, die Orden und Logen, die Chöre, die Turn-, Wirtschafts- und Schützenvereine, sie alle performten, machten Happenings und warfen sich theatralisch in Szene. Performance ist ja nicht nur eine spontane, unberechenbare Störaktion, sondern auch deren Gegenteil: die Synchronisierung einer kollektiven Bewegung. (Dirigieren, Tanzen, Bierhumpen-Kippen, Jodeln, Marschieren, Fahnenschwingen etc.) Das ritualisierte Mitgehen in Takt und Rhythmus dient seit jeher dazu, den Einzelnen in ein gesellschaftliches Konzept einzupassen. Das sieht man am deutlichsten, wenn man eine Militärparade mit der Street Parade vergleicht: die Unterschiede sind geringfügig. Hier wie dort geht es um Gleichschaltung durch Rhythmisierung und Modellierung des Körpers. Hier wie dort geht es darum, einen Gesamtkörper zu formen. Besonders in der Schweiz des 19. Jahrhunderts, als sich eine neue nationale Identität konsolidieren musste, erlebte die kollektive Performance eine Hochblüte. Performative Anlässe verfestigten sich zu Ritualen. Die ritualisierte Bändigung des Kollektivs zielte darauf ab, gesamtschweizerische Gegensätze zu überbrücken. Dies geschah unter nationalistischen Vorzeichen; es diente der Abgrenzung gegen Andersdenkende, Anderslebende. Und genau das war die Stelle, wo der Dadaismus seinen Sprengsatz anbringen konnte. Die Dadaisten besetzten die Schnittstelle zwischen Kunst und Volkskultur. Eine ähnliche Überschneidung findet man, etliche Jahrzehnte später, in der stark an das Cabaret und den Zirkus angelehnten Konzertperformance der Gruppe Les Reines Prochaines. Auch hier gibt es eine eigenartige, typisch helvetische Korrelation zwischen Volkstümlichkeit, Kunstanspruch und gesellschaftlicher Kritik. Das Beispiel der Schweiz zeigt eben sehr deutlich, dass Performance keine genuin künstlerische Angelegenheit ist. Die Erweiterung des performativen Raums hin zum Spektakel der Massenkultur war eigentlich immer schon vorhanden, nur hat es eine Weile gedauert, bis die Künstler das begriffen haben. Omlin deutet es immerhin an: „Es ist sinnvoll, das Performative in der Schweiz nicht nur über die Elemente der Hochkultur zu befragen, sondern Phänomene der Alltags- und Laienkultur im Blick zu haben...“
Der alpine Irrationalismus
Im Frühsommer 1816 trafen sich in der Nähe von Genf zwei grosse englische Dichter: Percy B. Shelley und Lord Byron. Byron hatte am Genfersee eine luxuriöse Villa gemietet. Shelley und dessen 19jährige Frau Mary waren aus politischen Gründen aus England geflohen. In Byrons Villa fanden sie Unterschlupf. Der Sommer 1816 war verregnet und kalt, das kleine Grüppchen der englischen Exilanten sass tagelang am Kaminfeuer, trank opiumhaltigen Wein und führte endlose Gespräche. Eines Abends, nach einer ausgedehnten Diskussion über Geister, Übersinnliches und die Natur des Lebens, schlug Byron den Shelleys vor, jeder solle eine Schauergeschichte schreiben. Weder Shelley noch Byron selbst nahmen den Vorschlag ernst. Nur Mary Shelley vollendete ihre Erzählung, die zwei Jahre später unter dem Titel „Frankenstein“ veröffentlicht wurde. Aber drehen wir das Zeitrad noch weiter zurück: Mary Shelleys Mutter, Mary Wollstonecraft, eine erfolgreiche Schriftstellerin und mässig erfolgreiche Frauenrechtlerin, lernte in ihrer Jugend einen Schweizer Maler kennen, der in der Royal Academy ein Gemälde mit dem Titel „The Nightmare“ ausstellte. Der Maler hiess Johann Heinrich Füssli. Aus politischen, amourösen und sonstigen Gründen hatte er die Schweiz Hals über Kopf verlassen. Wegen seiner Exaltiertheit nannten ihn die Engländer „The Wild Swiss“. In London wurde Füssli als Maler wie auch als Literat in die intellektuellen Zirkel der englischen Frühromantik aufgenommen. Sein Gemälde „The Nightmare“, das Mary Shelleys „Frankenstein“ wesentlich inspiriert hat, wurde auf Anhieb ein Emblem des damaligen Zeitgeistes. Das Bild, von dem mehrere Versionen existieren, zeigt eine schlafende, durchsichtig bekleidete Dame, deren Kopf und Arme über den Bettrand herabhängen. Auf ihrem Bauch kauert ein Alp, halb Gnom, halb Affe. Ein Geisterpferd schiebt seinen Kopf mit glühenden Augen von hinten durch die Bettvorhänge. Bei Füssli ist das Wort „Alp“ durchaus geografisch zu verstehen: es hat auch etwas mit den Alpen zu tun. Die irrational-unheimliche Sagenwelt der alpinen Schweiz verbindet sich hier wie selbstverständlich mit der englischen Schauerromantik („gothic romance“). Das wilde „Toggeli“ aus der Innerschweiz, das die Sennen im Schlaf heimsucht, wird in der englischen Sage als „Nightmare“ identifiziert. Tatsächlich gründen die vielfältigen Wechselbeziehungen zwischen den beiden Ländern in einer Verwandtschaft. Die Feen, Kobolde und Geister in Füsslis Werk entstammen ebenso der englischen wie der schweizerischen Volksmythologie. Meret Fehlmann, Assistentin an der Abteilung für europäische Volksliteratur an der Universität Zürich, hat kürzlich im Zusammenhang mit einer Reportage über den heutigen, noch durchaus vitalen Aberglauben in der Schweiz die Feststellung geäussert, dass für die Vielfalt und Zählebigkeit der schweizerischen Sagen die geografische Abgeschlossenheit des Alpenraums verantwortlich sei. Mit England – einer Insel – verhalte es sich ähnlich. Der einzige Unterschied, so Fehlmann, bestehe darin, dass die englische Tourismusindustrie geschickt Kapital aus den traditionellen Gruselgeschichten schlage, während dieses Potential hierzulande kaum genutzt werde. Der Publizist Hans Michel hat noch in den Siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts mündlich überlieferte Lauterbrunner Sagen gesammelt. Er schreibt dazu: „Zum Teil bis in die heidnische Vorzeit zurückreichend, sind im Lauterbrunner-Sagenkreis die meisten mythologischen Entstehungsmotive enthalten, so die der Geisterbannung und anderer magischer Künste, der Seelenwanderung, der unheildrohenden Vorzeichen, der Schlangen, Erdmännlein und Riesen. Die Leitmotive anderer sind die durch Sünde verlorene Blümelisalp, Schreckgespenster, Poltergeister, Wetterzeichen, Drachen, verborgene Schätze, Hexen- und Teufelswerke.“ Die Vielzahl der Motive ist beträchtlich. Es gibt annähernd 100 Lauterbrunner Sagen: die mündliche Überlieferung einer einzigen Berggemeinde! Man darf davon ausgehen, dass diese überquellende Sagenwelt im Bewusstsein der Schweizer (auch der Städter) vor 200 Jahren noch weitaus präsenter gewesen ist als heute. Durch Füssli und die romantische Zeitströmung drang der alpine Irrationalismus in die bildungsbürgerliche Kultur ein. Dort war für „echte“ Volkskunst kein Platz. Füssli hatte seine Motive geschickt in literarische Gewänder gekleidet; er hatte seine Figuren modisch ausstaffiert und in das nervöse Magnesiumlicht der damaligen Theaterwelt gerückt. Diese manieristische Künstlichkeit im Umgang mit Märchen, Mythen und Sagen zog sich durch das ganze 19. Jahrhundert und gipfelte in den überfeinerten Phantasiewelten von Richard Wagner, der Symbolisten und der Präraffaeliten. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts änderte sich die Kunstlandschaft grundlegend. Als Folge der Auseinandersetzung mit aussereuropäischen und prähistorischen Kulturen verwischten viele Künstler gezielt die Grenzlinie zwischen Volkskultur und Hochkultur. Einer dieser Künstler war Paul Klee. Inge Herold kommentiert die dunkle, volkstümlich-naive Seite seines Werkes folgendermassen: „Dämonen, Götzen, Teufel, Hexen und andere phantastische Spukwesen bevölkern Klees Bildwelt schon von Anfang an.... (Hexen-Schmiede, 1936; Götzin, 1939; Götzen-Park, 1939, Dämon, 1940) Sie verkörpern irrationale, bedrohliche Schicksalsmächte und strahlen eine geheimnisvolle Magie aus, in der sich jedoch häufig Witz und Schrecken paaren.“ Meret Oppenheim, Annemarie von Matt und Niki de Saint-Phalle schöpfen ebenfalls aus dem heimischen Sagenschatz. Aus dem für Klee noch angstbesetzten Irrationalismus destillieren sie eine matriarchale Substanz heraus, die sie ins Feministische wenden. Trotzdem, am Ende des 20. Jahrhunderts sind es, wie schon bei Füssli, ausschliesslich männliche Phantasien, welche den alpinen Irrationalismus über die Landesgrenze hinaustragen. Im Jahr 1980 wird ein Schweizer Künstler nach Hollywood berufen, um das Filmmonster „Alien“ zu kreieren. „Alien“ ist unbestritten das alptraumhafteste Wesen, das jemals auf Kinobesucher losgelassen wurde, eine zugleich archaische und futuristische Ausgeburt der Hölle. „Aliens“ Erfinder, der Bündner Hansruedi Giger, der „Hieronymus Bosch der Schweiz“, Schöpfer biomechanischer Ungeheuer und morbid-sexueller Phantasmagorien, hat für das raffinierte Design des "Alien"-Films einen Oscar bekommen. Giger, ebenso vertraut mit Sagen und Mythen wie mit Science Fiction, Rockmusik und Fantasy, hat den alpinen Irrationalismus mit technizistischen Gewaltphantasien und wissenschaftskritischen Angstvisionen angereichert. (Bekannt sind auch seine Bilder von verkrüppelten Klon-Babys). Damit sind wir wieder am Genfersee angelangt: bei Mary Shelley und ihrem „Frankenstein“. Der Kreis schliesst sich.
Er schliesst sich nicht ganz. Es bedarf hier noch einer Ergänzung. Der alpine Irrationalismus ist eingefasst in eine Mentalität, die, in den Worten Harald Szeemanns, auf der „Entwicklung einer eigenen Innenwelt“ beruht. In seiner Ausstellung „Visionäre Schweiz“ (Kunsthaus Zürich, 1991) hat Szeemann genau diesen Grundzug des schweizerischen Kunstschaffens thematisiert. Szeemann weiter: „Die Strahlkraft der Alpen, die magnetischen Anomalien, der Hang zum Sektentum im Voralpengebiet, die Dialekte, die Vielsprachigkeit, die abrupten Wechsel von Katholizismus zu Protestantismus, die Dezentralisierung haben in der Kunst dieses Gebietes, dieser Barriere zwischen Nord-Süd mit der relativen Offenheit gegen Norden, Osten und Westen, Konditionierungen geschaffen, die das Einzelgängertum begünstigen.“ Was Szeemann hier anspricht, betrifft auch jene geistigen Strömungen, die auf dem Monte Verità oder im Dornacher Goetheanum initiiert wurden: spirituelle Sonderwege zwischen Häresie und Utopie. Seit jeher gilt die Schweiz als Hochburg der Sekten, Geistheiler, Gurus und zwielichtigen Propheten. Um Belege für diese utopisch-alternative Spiritualität zu finden, braucht man nicht unbedingt auf Niklaus von Flüe, Paracelsus und Lavater zurückzugreifen. 1994 gründeten Anhänger von LaVey (dem Hohepriester der amerikanischen „Church of Satan“) in der Innerschweiz den „Black Order of the Trapezoid“. Diese gut organisierte Sekte, deren Ziel es ist, den Satanismus von der Basis her zu demokratisieren, hat in allen grösseren Schweizer Städten Sektionen gegründet und zählt heute etliche hundert Mitglieder. Wie das Sekten-Handbuch von Georg Schmid belegt, ist die schweizerische Sektenlandschaft ausserordentlich vielfältig: nebst den alten, christlich orientierten Sekten wie den Amischen Mennoniten, den evangelischen Täufern und den Urchristen („Bewegung Plus“), gibt es, vor allem im Alpenvorland, viele neuheidnische Sekten, magische Zirkel und pseudo-psychologische oder scientistisch-esoterische Gruppierungen. Die Vielzahl der alternativen Weltanschauungen, die hier auf engstem Raum versammelt sind, ist kaum zu überblicken. Schillernde Figuren wie Erich von Däniken oder der Ufo-Botschafter Billy Meyer, "Künder und Prophet der Neuzeit", stehen für ein Denken, das seine eigenen Wege geht, ohne sich abzukapseln. Alle diese Beispiele, so verschiedenartig sie auch sind, zeigen, dass der alpine Irrationalismus immer wieder aus der inzestuösen Rückständigkeit der Bauern- und Hirtenkultur heraustritt. Er pflanzt sich fort, indem er sich, wie schon bei Füssli, mit internationalen Bewegungen und Strömungen verbindet.
Schweizerberge
Die Schweizer hatten für ihre Berge zunächst gar nicht so viel übrig. Erst im 18. Jahrhundert, mit den Alpengedichten des schöngeistigen Naturforschers Albrecht von Haller, begann sich so etwas wie eine „staunende Ehrfurcht“ vor dem Landschaftselement Berg durchzusetzen. Zerklüftete Felshaufen, die völlig unnütz in der Landschaft herumstanden, wurden auf einmal zu etwas, das man als erhaben empfand. Über das man sogar Gedichte schrieb. Die Gründe für diesen Umschwung sind vielschichtig. Sie haben mit Zeitströmungen zu tun, in denen sich die Sachlichkeit des aufklärerischen Rationalismus mit pietistischer Empfindsamkeit vermischte. Die Subjektivität, die daraus resultierte, versuchte sich mit der Totalität der Natur in Beziehung zu setzen und wurde bestimmend für eine Weltsicht, die man als Panorama-Optik beschreiben könnte. Mit dieser Optik entstand der Tourismus. Die panoptische Fläche (Natur und Landschaft), auf die das Ich-Gefühl projiziert wurde, musste erschlossen werden mittels Bergbahnen, Pfaden, Übernachtungshütten, Hotels, Fernrohren und Landkarten. Ratio und Empfindung, Planung und Sehnsucht, Technik und Naturgefühl gingen Hand in Hand. Das eine war im andern begründet. Ein amüsantes Beispiel für das Miteinander von strikter Organisation und abstruser Naturschwärmerei liefert Mark Twain in seinem Reisebericht „Bummel durch Europa“. Twain beschreibt dort, wie er – natürlich in Bergschuhen - von Basel aus die Schweiz durchwandert. Er verbringt eine Nacht im Hotel Rigikulm. Nach einem erholsamen Schlaf geht er hinaus, um den Sonnenaufgang zu betrachten. Twain betritt gähnend die Aussichtsplattform. Ringsum glühen die Alpengipfel. Die Sonne aber – sie geht unter! Twain realisiert, dass er vergessen hat, den Wecker zu stellen. Er hat den berühmten Sonnenaufgang verschlafen, eine touristische Todsünde. An diesem Beispiel sieht man, wie durchorganisiert das Erleben der schönen Bergwelt damals schon war. Wenn man den Zeitplan nicht einhielt, lief man Gefahr, das Naturschauspiel, für das man ja bezahlt hatte, zu verpassen. Tatsächlich wurde das Phantasma der „freien Natur“ wie eine Oper inszeniert. Timing, Perspektive, Beleuchtung: alles musste stimmen. Die Berge standen im Mittelpunkt dieser Inszenierung. Sie liessen ungefilterte religiöse Empfindungen zu, die man in der säkularisierten Zivilisation kaum noch ausleben konnte. In vielen Religionen sind Berge Orte, wo der Himmel in einem „mysterium tremendum“ die Erde berührt. Nach christlich-jüdischem Verständnis sind Berge Offenbarungsstätten (Horeb, Sinai, Zion, Bergpredigt). Umso erstaunlicher, dass einer der ersten Alpenmaler, Caspar Wolf, mit einem nüchternen wissenschaftlichen Vorsatz an die Berge heranging. Er sah die Berge als geologische Gebilde, die im Entstehen und Vergehen eine sichtbare Entwicklung durchlaufen: sein Hauptaugenmerk lag auf Gesteinsschichten und Gletschern. Sich selbst – den Menschen – setzte er oft ins Bild hinein, um die Erkenntnisfähigkeit, aber auch die Relativität des menschlichen Subjekts in Bezug auf diese tellurischen Vorgänge anschaulich zu machen. Wolfs Zugang zur Bergwelt, seine Mischung aus Wissenschaftlichkeit und Ich-Reflexion, ist so unerhört modern, dass man seine Alpenbilder erst seit kurzem so betrachten kann, wie sie es eigentlich verdienen. Der Berg als Realität und der Berg als Bild – das sind ja grundsätzlich zweierlei Sachen. Obwohl wir wissen, dass Berge, am Masstab von Jahrmillionen gemessen, so vergänglich sind wie Sanddünen, gibt es kaum etwas, das geeigneter wäre, Ewigkeit zu suggerieren, als Felsen und Firne. Man muss schon sehr genau hinsehen und beobachten, um das Vergängliche dieser Gesteinsmassen erkennen zu können. Fast so realistisch wie Wolf hat um 1800 Conrad Escher die Alpen gemalt, allerdings mit deutlichem Einschlag ins Idyllische. Escher hat das erste ganzheitliche Bild der Alpen in über 1000 Ansichten, Panoramen und Karten geschaffen: eine gründliche Bestandesaufnahme. Seine Nachfolger begannen zu abstrahieren. Sie fielen in eine biblische Sichtweise zurück. Anstatt die Realität der Berge zu malen, dachten sie sich Idealberge aus. Sie hoben das Statische, das Kolossale, das Ideale hervor. Im 19. Jahrhundert, als sich der junge Nationalstaat eine „Corporate Identity“ zulegen musste, um sich nach aussen und innen darstellen zu können, setzte fast schlagartig eine Ikonisierung von Natur und Landschaft ein. Die religiöse Symbolik der Berge wurde vaterländisch instrumentalisiert. Es begann die Suche nach dem idealtypischen Schweizerberg. Etliche Kandidaten standen zur Auswahl: das Matterhorn, die Jungfrau, der Pilatus, der Niesen, der Mythen. Die Gestalt musste markant sein, reduzierbar auf ein paar wenige Grundlinien, sie musste grafisch darstellbar sein, postkartentauglich, und trotzdem mächtig genug, um die Funktion eines Wahrzeichens erfüllen zu können. Während das Matterhorn und die Jungfrau bald schon von der Tourismusindustrie entdeckt und damit auch entwertet wurden, rückte vor allem der Niesen in das Blickfeld der vaterländischen Repräsentation. Die pyramidale Form hatte seit jeher die lokale Bevölkerung beeindruckt und Künstler seit dem Mittelalter angeregt. Der Niesen war bereits durch seine Form Sinnbild des Berges schlechthin – vergleichbar mit dem Fujiyama in Japan – aber erst Ferdinand Hodler begann die markante Form so zu isolieren, dass sie zur Ikone wurde. Damit sind wir bei jenem Maler angelangt, um den man nicht herumkommt, wenn es um das Selbstverständnis der Schweiz und die Ikonographie ihrer Landschaften geht. Hodler ist der helvetische Übervater, der allseits verfügbare Nationalmaler. Er inspiriert die Konservativen wie auch die Linken, er bedient das Pathos wie auch den kritischen Geist. Er ist Mystiker und Demokrat, er ist archaisch und modern, eigensinnig und zugänglich, urwüchsig und progressiv. Er wird von allen irgendwie verstanden, aber von niemandem ganz. Man könnte sagen: Hodler verkörpert die Schweiz, wie sie ist, mit ihren Gegensätzen, Spannungen und Ungereimtheiten. Das ist es, was ihn zu einem nationalen Aushängeschild macht. Und das ist es, was den Blick auf ihn allzuoft verstellt: seine Konsumierbarkeit ist enorm. Er ist der Schlüssel, der in jedes Schloss passt. Hodler entwirft eine utopische Einheit, bei der es keine Rolle spielt, ob man sie politisch oder metaphysisch auffasst, denn es liegt in ihrem Wesen, dass sie alles umgreift, alles in sich aufnimmt und vereinigt. Hodlers Malerei weist über kleinliche Parteiungen und Zuordnungen hinaus. Sie weist auch über sich selbst hinaus. Sie verlässt die Tafelmalerei, geht zum Fresko über, nähert sich der Ornamentik, der Architektur, dem von Luft, Licht und freudiger Wallung erfüllten Sakralbau. Würde Hodler heute leben, so würde er aller Wahrscheinlichkeit nach aufs Malen verzichten. Er würde Kinofilme im Breitwandformat machen, mit Landschaftsaufnahmen von epischen Ausmassen, er würde den Tanz seiner Figuren und Wolken als wirkliche Bewegung inszenieren. Hodler rhythmisiert seine Bilder, er dynamisiert sie zu einem Tanz, der das Zeitliche feiert und transzendiert. Das geschieht auch bei Landschaften, selbst bei so statischen Gebilden wie Bergen. Hodler hat die eigentliche Symbolfigur der Schweiz, den Berg – und den Niesen als Berg schlechthin - in eine überzeitliche Dimension erhoben, in der das Nationale aufgeht, in der es aber auch verschwindet. Man braucht kein Patriot zu sein, um Gefallen an Hodler zu finden. Andererseits finden Patrioten Hodler gerade deshalb so unwiderstehlich, weil er dem Nationalismus die jungen, aufstrebenden, progressiven Kräfte zuweist. Er ist ein Moderner, also einer von uns, und redet von Bergen, Helden und Schlachten. Er malt nicht etwa eine verklärte oder geschönte Schweiz, sondern eine Schweiz, die die nächste Legislaturperiode überdauert, eine Schweiz aus Granit, Eis und Wolken, eine Schweiz, die aus ihrer Beschränktheit ausbricht in eine visionäre All-Einigkeit. Hodlers Darstellung des Niesen kann man als Huldigung an ein vaterländisches Symbol lesen, aber auch als Verneinung menschlicher Einrichtungen und vergänglicher Politik. Hodler malt das, was sich gegen politische Parteilichkeit sperrt: das Ewige, das Absolute. Deshalb kann Hodler nicht für irgendeine politische Richtung oder Ideologie vereinnahmt werden. Wenn man es dennoch versucht, führt das so gradlinig zum Totalitarismus, dass der Unsinn eines „politischen Hodlers“ schnell ersichtlich wird. Hodler ist immer nur teilweise besetzbar, als Ganzes entzieht er sich. Seine Berge ragen über den Patriotismus hinaus. Es sind utopische Berge, Menschheitsberge, nicht Schweizerberge. Auf diese Weise hat Hodler die Seelenlandschaften des Expressionismus vorweggenommen: Kirchners Berge etwa, die mit viel Farbe und Gestik eine individuelle und überindividuelle Daseinsproblematik zum Ausdruck bringen. Doch von Hodler zu Kirchner ist es ein riesiger Sprung. Was Hodler noch gelang, nämlich die individuelle Seelenlandschaft mit einer kollektiven Identität zu verknüpfen, sollte Kirchner verwehrt bleiben. Er blieb in seiner Davoser Malhütte isoliert. Die Schweiz war für ihn ein Asyl, ein Traumland vielleicht, ähnlich wie Tahiti für Gaugin, doch letztlich haben Kirchner und Gaugin das paradiesische Aufgehobensein vergeblich gesucht. Ihre Kunst blieb heimatlos. Während Hodler dank der geistigen Landesverteidigung zum Nationalheiligen wurde, blieb Kirchner im Abseits. Das änderte sich erst nach dem Krieg, als man die expressionistische Heimatlosigkeit als ein Signum der Moderne zu verstehen begann. Hodler – auf der anderen Seite - erwies sich als robust, seine Bilder blieben intakt, die Schweiz brauchte auch im kalten Krieg einen Nationalheiligen. Nur die Alpen hatten Risse abbekommen. Alpenmalerei im Zeitalter des Holocaust – das wurde schwierig. Schiesslich hatte auch Hitler die Alpen geliebt, er hatte sie sogar gemalt. Die Ikonographie der Schweizerberge war nur noch historisch zu rechtfertigen: als ein Zeugnis des Widerstands gegen den Faschismus. Die Gotthard-Festung (Réduit) wurde in der Nachkriegszeit zum zentralen Begriff helvetischer Selbsterklärung. Die unbegreifliche Tatsache, dass die Schweiz im Zweiten Weltkrieg verschont geblieben war, bildete die Grundlage für den Mythos der Unbesiegbarkeit und der absoluten Neutralität. Die Bedeutung des Gotthardmassivs für den Transitverkehr und die Energiewirtschaft, vermischt mit Anti-Kommunismus, Armee-Folklore und Landi-Geist, führte zu einer reaktionären Verklärung des Gebirges. Diesem rückwärtsgewandten geistigen Klima stand die Kunst ohnmächtig gegenüber. Sie setzte sich ab, suchte Anschluss an die internationale Avantgarde. Dies war umso nötiger, als die offizielle Schweizer Kunstszene an hoffnungslos rückständigen Formeln festhielt. Die GSMBA (Gesellschaft Schweizerischer Maler, Bildhauer und Architekten) förderte eine figurativ-gegenständliche Kunst, die sich an den Darstellungsformen der Vorkriegszeit orientierte. Auf der anderen Seite war die damals international führende Kunstrichtung, der abstrakte Expressionismus, nicht in der Lage, auf gesellschaftspolitische Konflikte einzugehen. Es entstand ein Vakuum. Das Thema „Schweiz“ blieb der Literatur überlassen. Von Dürrenmatts „Winterkrieg in Tibet“ bis zur „Künstlichen Mutter“ von Hermann Burger griffen Schweizer Schriftsteller das Motiv der „Alpenfestung“ immer wieder auf und spielten es satirisch durch. Die Nachkriegszeit in der Schweiz war geprägt von einer intellektuellen Debatte, bei der die eine Partei redete und die andere Partei nicht zuhörte. Peter von Matt: „Auf der einen Seite die etablierte Macht im Land, die Politiker, die alle sehr deutlich noch von der Kriegszeit geprägt waren, das konservative Bürgertum insgesamt, und auf der andern Seite die streitlustige Intelligenz.“ Bei dieser einseitigen, für die Schweizer Kultur jedoch zukunftsweisenden Debatte ging es um Wahrheit, Moral, Identität, Geschichtsfälschung und den Konflikt zwischen den Generationen und Ideologien. Erst in den letzten zwei Jahrzehnten begann das Selbstbild der wehrhaft-tapferen Schweiz zu bröckeln. Historische Fakten setzten sich gegen Mythen durch, politische Skandale (Fichenaffäre) und aufgedeckte Verfehlungen (Raubgold) trugen dazu bei, dass die Gotthardfestung in den Köpfen geschleift wurde. Sie verschwand auch von der militärischen Landkarte. Die meisten Stollen wurden geräumt, die Zugänge versiegelt. Das Réduit hatte endgültig ausgedient. Mit der Jugendbewegung der Achtziger Jahre kehrte die Kunst in den gesellschaftspolitischen Diskurs zurück. Angesagt waren Regionalismus, Autonomie und Emanzipation. Es war die Zeit der grossen Vereinfachungen. Der Agitprop-Slogan „Nieder mit den Alpen, freie Sicht aufs Mittelmeer“ wurde in den Neunzigern zum Leitspruch einer jungen, vitalen, zukunftsorientierten Schweizer Kunst, die keine Widerstände mehr zu befürchten hatte. Die Rebellion, wenn es denn eine war, fiel allen ein bisschen zu leicht. Mit Figuren wie Silvie Fleury und Pipilotti Rist wurde die Schweizer Kunst auf einmal zum Jetset-Phänomen. Alle jagten dem jeweiligen Dernier Cri der Kunstwelt hinterher. Es ist deshalb kaum zu verwundern, dass sich der eine oder andere Künstler in die Alpen zurückzog, in die Einsamkeit der Berge, und nach dem Wesentlichen und Unverfälschten fragte. Zu diesen Künstlern gehört Jean Odermatt. „Seit über 20 Jahren,“ so entnimmt man der Web-Side „www.claustra“, „arbeitet der Künstler Jean Odermatt an seinem Gotthardprojekt. Zeitweise lebte er sommers unterhalb des Canariscio auf 2500 Meter ü.M., winters auf dem Hospiz. Entstanden sind dabei nicht nur unzählige Kunstwerke und Inszenierungen, sondern auch das Kommunikations- und Forschungszentrum LA CLAUSTRA.“ Jean Odermatt hat den Gotthard (sowohl den Berg als auch die militärische Anlage) seit 1983 kontinuierlich erforscht und seine Erkundungen in einem vielschichtigen Projekt gebündelt und sichtbar gemacht. Die wohl bekannteste Arbeit Odermatts ist eine Fotoserie, die den Wandel des Wetters in Tausenden von Einzelbildern minutiös festhält. In dem Teilprojekt „La prima Linea“ schafft Odermatt eine geomantische Verbindung zwischen dem Gotthard-Hospiz und dem Dom von Milano, indem er Platten mit Texten und Bildern in der Erde vergräbt. In seiner „Scenografia“ realisiert er in Zusammenarbeit mit Musikern und Performern mythische Bilder, die auf den Landschaftsraum eingehen. Die vorläufige Krönung des Projektes bildet die „Claustra“. Mit finanzieller Unterstützung des VBS und der Volkart Stiftung Winterthur hat Odermatt das ehemalige Artilleriefort der unterirdischen Anlage zu einem skulpturalen Ort umgebaut. „La Claustra“, seit 2004 in Betrieb, ist eine Mischung aus Kloster, Seminarhotel, Akademie, Forschungslabor und Tempel. Im Zusammenspiel mit den natürlichen Elementen (Fels, Wasser, Licht, Feuer) soll das 4000m2 umfassende Gelände eine Verbindung zur mythischen Welt des Gotthard herstellen. Odermatt benutzt den gigantischen, mit elementaren Naturkräften in Verbindung stehenden Geschichts- und Kulturspeicher als Plattform für eine geistige Aufbauarbeit, die, je nach vorliegenden Bedürfnissen, die Gestalt einer Schule, einer Begegnungsstätte oder eines meditativen Ortes annehmen kann. Die Offenheit des Projektes ist gewährleistet; was daraus wird, hängt nicht allein von Odermatt ab, sondern auch von den Leuten, die sich daran beteiligen. Die neue Gotthardfestung „La Claustra“ könnte sich zu einem wichtigen kulturellen Zentrum entwickeln, sie könnte aber auch absinken zu einem kommerziellen Hotelbetrieb. Oder noch schlimmer: sie könnte in die Hände von geschäftstüchtigen Mainstream-Kulturveranstaltern fallen. Das wäre schade, denn Odermatt gehört zu den wenigen Schweizer Künstlern, die von ihrem intellektuellen Format her befähigt sind, eine Kunst zu vertreten, die den üblichen Bezugsrahmen sprengt. Was da im Stillen herangereift ist auf und in einem Berg, den alle schon abgeschrieben haben, öffnet eine Tür in die Zukunft. Die Schweiz besteht ja nicht nur aus Vergangenheit und Gegenwart. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass das Beste noch kommt.
Literaturverzeichnis:
David Fischli, Peter Weiss: Plötzlich diese Übersicht, Edition Stähli, 2001, Zürich
Peter Fischli & David Weiss, Elizabeth Armstrong: Everyday Sublime, Cantz Verlag,, Ostfildern, 2000
Geschichte der Schweiz und der Schweizer, Schwabe Verlag, Basel, 2004
Howald, Stefan: Insular Denken - Grossbritannien und die Schweiz, Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 2004
Die Erfindung der Schweiz 1848-1998, Bildentwürfe einer Nation (Erschienen zur Sonderausstellung im Schw. Landesmuseum in Zürich, 26. Juni - 4. Oktober, 1998), Chronos Verlag, Zürich, 1998
Odermatt, Jean: Himmelsland, Piz Buch und Berg, Zürich, 1997
Hermann Burger: Die Künstliche Mutter, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1982
Robert Walser: Jakob von Gunten, Suhrkamp Verlag, Zürich, 1985, Originalausgabe 1909, Verlag Bruno Cassirer, Berlin
Peter von Matt: Die tintenblauen Eidgenossen – Über die literarische und politische Schweiz/ Carl Hanser Verlag München Wien/2001
Freie Sicht aufs Mittelmeer/Junge Schweizer Kunst“ Kunsthaus Zürich, Schirn Kunsthalle Frankfurt, Scalo Verlag, Zürich, 1998
Hans Ulrich Jost: Widerspruch/ Beiträge zur sozialistischen Politik Nr. 13, Identität und nationale Geschichte
Ferdinand Hodler: Landschaften, Scheidegger & Spiess, Zürich, 2003
Die ersten Panoramen der Alpen – Hans Conrad Escher von der Linth 1780-1822, Hrsg. Linth-Escher-Stiftung, Verlag Baerschlin, Glarus, 2002
Mark Twain: Bummel durch Europa, Diogenes, Zürich, 1990
Kirchen, Sekten, Religionen/Hrsg. Georg Schmid und Georg Otto Schmid, Theologischer Verlag Zürich, 2003
Visionäre Schweiz, Hrsg. Harald Szeemann, Verlag Sauerländer, Aarau, 1991
H.R. Giger ARh +, Benedikt Taschen Verlag, Berlin 1991
Paul Klee – Die Zeit der Reife, Werke aus der Sammlung der Familie Klee, Hrsg. Manfred Fath, Prestel Verlag , München, 1996
Ein Kratten voll Lauterbrunner Sagen/Hrsg. Hans Michel, Otto Schlaefli, Interlaken, 1977
J. H. Füssli, The Wild Swiss, Christoph Becker, Christian Klemm, Franziska Lentzsch und Bernhard von Waldkirch, Verlag Scheidegger und Spiess, Zürich, 2005
Hans Peter Treichler: Abenteuer Schweiz – Geschichte in Jahrhundertschritten, Migros Presse, Limmatdruck AG, Spreitenbach, 1991
Performativ! Performance-Künste in der Schweiz, Reader, eingerichtet von S. Omlin, Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung, Zürich, 2004
Georg Kreis: Mythos Rütli, Geschichte eines Erinnerungsortes, Orell Füssli Verlag AG, Zürich, 2004
Peter Bichsel: Des Schweizers Schweiz, Aufsätze, Arche Verlag AG, Raabe u. Vitali, Zürich, 1984
Paul Nizon: Diskurs in der Enge. Verweigerers Steckbrief, Suhrkamp, Frankfurt/M. 1990/Originalausgabe 1970
Bilder im Spiegel der Zeit, Band 1, 1900-1902, Hrsg. Max S. Metz, S. Metz Verlag AG, Zürich, 1968
Herbert Lüthy: Die Schweiz als Antithese, Verlag Die Arche, Zürich, 1969
Regula Stämpfli: Vom Stummbürger zum Stimmbürger, Orell Füssli Verlag AG, Zürich, 2003
Weiss auf Rot: Das Schweizer Kreuz zwischen nationaler Identität und Corporate Identity” NZZ Verlag, Zürich, 2005
Letztes Lexikon, Werner Bartes, Martin Halter, Rudolf Walther/Die andere Bibliothek, Eichborn Verlag, Frankfurt am Main, 2002
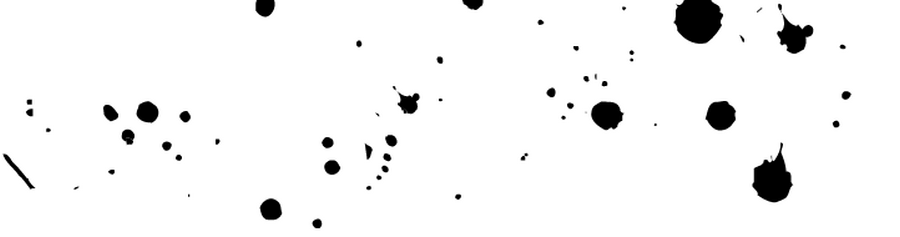 wörter
worte
wörter
worte