Dead and Breakfast
Reception
„Haben Sie eine angenehme Reise gehabt?“ Die junge Receptionistin begrüsst uns lächelnd. Wir unterschreiben irgendein Formular, das Gepäck trägt uns der dickliche Portier schon mal aufs Zimmer hinauf. In der Lobby stehen Polstermöbel, Kübelpalmen, aus versteckten Lautsprecherboxen rieselt klassische Musik. Hotels umwerben uns mit paradiesischen Versprechungen. Sieht man sich Bilder und Texte an, die ins Netz gespeist werden, um Hotelgäste anzulocken, kommt man ins Träumen. Die Grundzutaten: Komfort, ein schönes Ambience, gute Küche, als Beigaben Landschaft und Kultur. Und immer wieder das Gütesiegel des Althergebrachten und Altbewährten: die "Tradition des Hauses". Dass das keine Phrasen sind, davon kann man sich leicht überzeugen. Freilich ist es auch eine Preisfrage. Im Tourismusmarketing spricht man diesbezüglich von „Preis-Genuss-Verhältnis“. Ein ungeniessbarer Ausdruck, der etwas Einfaches auf den Begriff bringt. Hotels bieten Exklusivität. Darin unterscheiden sie sich von Herbergen und Massenlagern. Dabei braucht ein Hotelbesuch nicht unbedingt teuer zu sein, er braucht nur anders zu sein. Hotels erfüllen mehr als nur den Zweck, eine Unterkunft zu bieten. Sie haben Charme, Stil, Charakter, Individualität. Sie erzählen Geschichten. Sie erfüllen Sehnsüchte. Mit all diesen Eigenschaften setzen sie sich ab vom Courant normal. Als Dreh- und Angelpunkte einer total freizeitmobilisierten Gesellschaft geben sie sich den Anschein, ausserhalb dieser Gesellschaft zu stehen. Als Oasen der Ruhe preisen sie sich an, als gediegene Nischen. Ein Widerspruch? Hotels verstellen sich, um nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, sie hätten etwas mit Massentourismus zu tun. Gewiss, da schwingt auch Idealismus mit. Der schleichenden Selbstentwertung jeglicher Mobilität setzen sie den Wert eines Orts entgegen, den Wert einer Bleibe. In einem Hotel kann man sich niederlassen. Man kann jahrelang in einem Hotel leben, vorausgesetzt, man verfügt über das nötige Kleingeld. Vladimir Nabokov im Palace Hotel Montreux: der König in seinem Palast. Nicht umsonst zitiert Hotelarchitektur die vertrauten feudalistischen Vorgaben: Burgen, Paläste und Schlösser. Der Gast ist nicht bloss Gast: er ist König. Er residiert. Soweit das Ideal. Aber wie ist es in Wirklichkeit? Die angepriesene Idealität erweist sich allzuoft als schal. Nicht dass das Behauptete unwahr wäre – die allermeisten Hotels sind wirklich schön, wirklich gastlich und werden ihrem Anspruch vollauf gerecht – es ist nur nicht die ganze Wahrheit. Irgendwo klafft eine Lücke. Das Fehlende ist uns vage bekannt aus Filmen und Erzählungen, auch aus Phantasien, die sich uns schattenhaft aufs Gemüt legen, wenn wir in einem Hotelzimmer sitzen und das Nachttischlämpchen anstarren. Etwas Unheimliches beschleicht uns. Eine Leere tut sich auf. Ein harmloses Geräusch hinter der Wand lässt uns zusammenzucken. Ist das Schöne gar nicht so schön? Ist das Schöne nur des Schrecklichen Anfang? Schleicht sich hier, nur knapp über der Bewusstseinsschwelle, eine Phantasie ein, über die aus Marketinggründen wohlweislich geschwiegen wird? Ziehen Hotels nicht nur Wunschträume an, sondern auch Angstträume? Die eine Phantasie ist marketinggesteuert, sie steht für ein Setting abgesicherter Kultur. Mit ihren Vorstellungsmustern appelliert sie an zivilisatorische Bedürfnisse, die zur Grundausstattung des „guten Lebens“ gehören. Schlafen und Essen, Schutz und Obdach, Ruhe und Geborgenheit, Eintracht und Gemütlichkeit, Reinlichkeit und Service, Luxus und Exklusivität. Die andere Phantasie verhält sich gegenläufig, sie kehrt das Mustergültige um, macht es unkenntlich, zieht es ins Groteske. Aus Schutz wird Gefahr, aus Obdach Ausgesetztheit, aus Ruhe Störung, aus Geborgenheit Übergriff, aus Eintracht Streit, aus Gemütlichkeit Unbehagen, aus Reinlichkeit Schmutz, aus Service Vernachlässigung, aus Luxus Ärmlichkeit, aus Exklusivität Gefangenschaft. Immer wird dabei das Undenkbare gestreift, das Inakzeptable vor das Akzeptable geschoben: in der Imagination vollzieht sich eine Art Sonnenfinsternis. Alpträume schleichen sich ein, Ängste betreiben ihre „schmutzige“ Agitation. Diese Umkehrung spielt sich nicht nur in individuellen Phantasien ab. Sie wird öffentlich zelebriert. Das Hotel als ein Ort der Anomalien und Unheimlichkeiten hat sich zum Topos verfestigt. Stanley Kubricks „Shining“ ist nur das bekannteste Beispiel. Das ideale Hotel der Werbeprospekte und das befremdliche oder schreckliche Hotel, wie es in „Shining“ inszeniert wird, bilden zusammen einen Spannungsbogen äusserer und innerer Erfahrungen, deren Ambivalenz auf eine virulente Spaltung schliessen lässt. Ambivalenz heisst: es gibt eine Falz- oder Knickstelle, eine Störung, die die gegensätzlichen Phantasien in Gang hält. Wo ist diese Stelle? Wo genau und aus welchem Grund kommt es zu diesem Knick? Eine Frage, die uns umtreibt. In den dunklen Räumen dieses Hotels finden wir vielleicht eine Antwort.
Zimmer No 1: Fremdsein
Nun, hier sind wir. Ausländische Touristen, fremd in der Stadt, fremd im Hotel, fremd in einem Zimmer, das wir zum ersten Mal in unserm Leben betreten haben, und jetzt sollen wir uns wie zu Hause fühlen. Niemand wird bestreiten, dass ein Hotel kein richtiges Zuhause ist. Wer in einem Hotel strandet, nicht als Stammgast, sondern als Aspirant des Fremdseins, ist zuerst einmal namenlos und nackt wie ein Schiffbrüchiger, der das rettende Ufer einer Insel erreicht. Aber auch wenn man sich nach bestem Vermögen einrichtet: das Hotel bleibt ein Notbehelf. Wir haben Angst vor dem Hotel, weil es uns fremd ist. Trotz aller Banalität – ein Geheimnis sucht man hier vergebens – hat dieses Hotelgefühl als Chiffre für Fremdheit und Selbstentfremdung in Filmen und Romanen eine grosse Karriere gemacht. Was die Gegenwart betrifft, ist wahrscheinlich Sofia Coppolas „Lost in Translation“ das bekannteste Beispiel. Der alternde Schauspieler Bob, gespielt von Bill Murray, wirkt in der ihm aufgezwungenen Hotelumgebung wie John Wayne in einer Ballettschule. Bob ist buchstäblich im falschen Film. Was in ihm vorgeht, können wir gut verstehen. Fremdheit, Befremdung und Selbstentfremdung sind wahrscheinlich die häufigsten negativen Hotelerfahrungen.
Zimmer No 2: Mängel und Gefahren
Das nächste Zimmer stellt uns sanitarisch und hygienisch vor vollendete Tatsachen: und das ist noch höflich ausgedrückt. Wir lassen uns diesbezüglich gerne beschwichtigen, und die Beschwichtigung dient letztlich auch dem Hotel. Das Misstrauen des Gastes lässt sich besänftigen, jedoch nie ganz ausschalten. Wer „auswärts“ übernachtet, belegt den neuen Schlafplatz selten übereilt – und schon gar nicht kopflos. Vor dem Auspacken der Koffer, dem Sortieren der Kleider, dem Sich-Einrichten in der neuen Umgebung ist zuerst einmal Zimmerkontrolle angesagt. Man aktiviert den inneren Suchdetektor. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ein tief eingewurzelter Instinkt sagt uns, dass der Schlafplatz sicher sein muss. Im Schlaf sind wir wehrlos wie kleine Kinder. Umzingelt von potentiellen Gefahren. Die Wahrscheinlichkeit eines unliebsamen Erwachens (falls es dann noch ein Erwachen gibt) ist gering, aber trotzdem bedenkenswert, weil im Bereich des Möglichen. Seit Urzeiten rumort dieses Unbehagen in unserm Hypothalamus. Wahrscheinlichkeitsrechnungen zählen hier nicht. Es ist nicht unsere zivilisatorische Vernunft, was uns immer wieder dazu bringt, den neu bezogenen Schlafplatz auf Unreinlichkeiten, Schimmelflecken, Ungeziefer und, was die Gefährdung durch andere Menschen betrifft, verborgene Ein- und Ausgänge abzusuchen. Das Wichtigste: den Türschlüssel umdrehen. Hotels sind wie geschaffen für Paranoiker. In seinem Hotelzimmer kann man sich verbarrikadieren. Aber was, wenn das Übel schon im Zimmer ist?
Zimmer No 3: Mord und Totschlag
Fast unmerklich haben wir den Bereich der Bagatellfälle verlassen. An der Zimmertür, zu der wir nun vorgedrungen sind, könnte ein Schildchen hängen mit der Aufschrift: Der Mensch ist des Menschen Wolf. Und weiter könnte da stehen: Bitte nichts berühren. Tatort. Als der deutsche Politiker Uwe Barschel am 11. Oktober 1987 von zwei Stern-Reportern im Genfer Nobelhotel Beau-Rivage tot, aber vollständig angekleidet in seiner Badewanne aufgefunden wurde, begann ein Rätselraten, das bis heute nicht verstummt ist. Mord oder Selbstmord? Barschels Zimmer entpuppte sich als kriminalistische Denkfalle. Weder auf Mord noch auf Selbstmord liess sich eine schlüssige Beweisführung aufbauen. Nun ist es ja so, dass die Realität noch nie besonders einfallsreich gewesen ist. Sie ahmt immer nur die Phantasie nach. Seit jeher imaginieren Kriminal- und Thrillerautoren das Hotelzimmer als perfekten Tatort. Hier fallen die Leichen buchstäblich aus dem Wandschrank. Agatha Christies „Bertram’s Hotel“, Eric Amblers „The dark frontier“ oder Ulrich Knellwolfs „Tod in Sils Maria“, (wo gleich 17 Hotelleichen produziert werden), das sind Bücher, die ein Hotelgast keinesfalls lesen sollte, wenn er unter Schlaflosigkeit leidet. Oder erst recht? Der Befund lässt keinen Zweifel zu. Hotels wecken die Mordlust. Woran liegt das? Kann es sein, dass die mondänen Umgangsformen, die in vielen Hotel gepflegt werden, zu einem Aggressionsstau führen? Oder sind die kriminalistischen Phantasien eher das Ergebnis kultureller und mentaler Differenzen, die in einem kosmopolitischen Umfeld kaum zu vermeiden sind? In den Hotelhallen trifft sich die Welt – und auch die Halbwelt. In der prinzipiellen Offenheit des Hotels, wo nur eine dünne Wand den Priester vom Callgirl, den Bundesrat vom Mafiaboss trennt, ist das einzelne Zimmer ein fragiler Rückzugsort. Nirgendwo ist das Alleinsein spürbarer. Kein Wunder, sind in Luxushotels die meisten Zimmer mit Doppeltüren ausgestattet. Komplizierte Anklopf-Rituale sind gang und gäbe: dreimaliges Klopfen bedeutet Zimmerservice. Klopft es zweimal, ist es womöglich ein Auftragskiller.
Zimmer No 4: Labyrinth
Dieses Zimmer müssen wir suchen, denn die Wege, die zu ihm hinführen, sind lang und verwinkelt. Die Faszination, die das Hotel in Verbindung mit fiktiven oder realen Verbrechen auf uns ausübt, dürfte auch mit jenem Teil des Hotels zu tun haben, den die Gebäudeversicherung als „Bausubstanz“ bezeichnet. Mit seinen endlosen Fluren, den numerierten Türen, den Liftschächten, Treppen, Nischen, Ablagen und Kammern, dieser ganzen kafkaesken Topografie, gilt das Hotel spätestens seit dem Film noir als hervorragendes cineastisches Setting für Suspense und Mord. Die verwinkelten und oft auch weitläufigen Innen- und Aussenperspektiven verweisen auf ein seelisches Eigenleben. Jedes Hotel hat seinen eigenen Charakter, wird umgetrieben von Launen, Stimmungen und Neurosen... Wahnsinn und Architektur. So sehr diese Kombination in Horrorfilmen zur Stimmigkeit des Genres beiträgt: in der Realität ist sie natürlich alles andere als erstrebenswert. Der Hotelarchitektur fällt die undankbare Aufgabe zu, ein Gebäude wohnlich und anziehend erscheinen zu lassen, das im Grunde genommen ähnlich funktioniert wie ein Gefängnis, ein Irrenhaus oder ein Spital. In der Reception laufen die Fäden zusammen. Es gibt eine Eingangskontrolle. Es gibt Gänge und numerierte Schläge. Die Menschen werden registriert, in Verwahrsam genommen und verteilt, und irgendwo in diesem Labyrinth bekommen sie ihren Platz. Wie aber soll man sich in einem Labyrinth wohl fühlen? In der Undurchschaubarkeit des Labyrinths treffen zwei gegensätzliche Ängste aufeinander: die Angst vor der räumlichen Beklemmung (Klaustrophobie) und die Angst vor der räumlichen Entgrenzung (Agoraphobie). In den seriell angelegten Irrgängen eines Hotels - gleiche Türen, gleiche Etagen – passiert es einem schnell, dass man das falsche Zimmer erwischt. Das an sich ist vielleicht peinlich, aber noch keineswegs beunruhigend. Die Beunruhigung entsteht erst beim Weitergehen, Weitersuchen, die Beunruhigung entsteht, wenn die Flure einfach nicht mehr aufhören und uns, wie zum Hohn, immer das gleiche Gesicht zeigen. Hier vermengen sich Klaustrophobie und Agoraphobie derart, dass sie ununterscheidbar werden. Wenn uns Stanley Kubrick in „Shining“ durch das riesige Overlook-Hotel hetzt, wird in extremis nachvollziehbar, wie das Labyrinth als archaisches Spielfeld diese gegensätzlichen Ängste in Gang zu setzen vermag. Endlose Kamerafahrten jagen uns durch Irrgänge, involvieren uns in ein makaberes Versteckspiel. Der Minotaurus in diesem Labyrinth, prototypisch verkörpert von Jack Nicholson, ist, wie auch das mythologische Vorbild, Täter und Opfer in einer Person. Der Wahnsinn, der ihn dazu treibt, seine Familie auszulöschen, kann ihm nur bedingt angelastet werden. Das Labyrinth verlangt Menschenopfer. Weniger archaisch ausgedrückt: auf dem Hotel liegt ein Fluch. Torrance ist denn auch kein Amokläufer. Seine Untat ist psychologisch nicht zu ergründen. Eher könnte man von Besessenheit reden: wahnsinnig ist das Hotel, nicht Torrance.
Zimmer No 5: Geister der Vergangenheit
Dieses Zimmer betreten wir mit gebührendem Respekt. Fürstinnen haben hier genächtigt, Schauspielerinnen, Schriftsteller, Philosophen, Verrückte, Mörder, Politiker und Manager. Alles in allem: wir sind nicht die Ersten. Wir reihen uns ein. Was in „Shining“ als Fluch dramatisiert wird, ist abseits der Fiktion zunächst einfach mal eine Tatsache. Jedes Hotel, das auf sich hält, konserviert seine Geschichte. Es tradiert sich selbst. Es hat eine rege Vergangenheit, die es in sich speichert und auf seine Gäste überträgt. Man muss sich nur einmal vergegenwärtigen, wie hoch die durchschnittliche Belegungszahl sein muss, damit ein Hotel einigermassen rentiert. In einem seit hundert Jahren bestehenden Hotel sind das, um einen statistischen Mittelwert zu nehmen, pro Bett etwa 5000 Personen. Vor den gesellschaftlichen Verflechtungen, individuellen Besonderheiten, familiären Hintergründen und privaten Tragödien dieser Menschenmasse kapituliert unsere Vorstellungskraft. Nicht aber vor der simplen Tatsache, dass alle diese Menschen dagewesen sind. Ihre Anwesenheit hat über Jahre hinweg zum unverwechselbaren Genius loci beigetragen. Die Menschen, die sich dieser zeitenthobenen Strahlung aussetzen, erliegen einer geheimnisvollen Mutation. Im Hotel Waldhaus in Sils-Maria zum Beispiel mutiert jeder Gast zum subtilen Schöngeist: anstatt wie Jack Nicholson axtschwingend durch die Hotelflure zu irren, sitzt man friedlich im Lesesalon der Belle-Epoque und raunt Nietzsche-Zitate vor sich hin. Andere Hotels wiederum besitzen, wie das fiktive Overlook-Hotel, eine Aura des Mysteriösen und Unheilvollen. Ein solches Hotel ist das Beau-Rivage in Genf. Uwe Barschel ist nicht der einzige Todesfall, durch den das Hotel unrühmlich in die Schlagzeilen geraten ist. Am 10. September 1898 wurde die Kaiserin Sissi direkt vor dem Hotel von einem italienischen Anarchisten niedergestochen.
Zimmer No 6: Phantomhaftigkeit
Ein Telefonanruf genügt, und der Mann vom Roomservice eilt herbei, um ein Handtuch auszuwechseln oder eine Flasche Sekt zu bringen. Doch welcher Art ist eigentlich unsere Beziehung zu diesem Mann? Mehr als allen andern Häusern eignet dem Hotel etwas Phantomhaftes. Ein Hotel hat sich bereitzuhalten, es ist eine Einrichtung, die den Menschen dient, ihnen Einlass gewährt, sie beherbergt, verköstigt, ihnen Schutz bietet. Doch der Hotelaufenthalt ist nicht auf Dauer angelegt. Wer sich einlogiert, reist im Normalfall bald wieder ab. Das Hotel zählt nicht, es ist nur eine Passage, eine Station, die gebucht wird und die man nach einer bestimmten Zeit wieder verlässt. Trotz aller Wertschätzung, die dem Gast entgegengebracht wird, degradiert ihn das Transitorische zu einer flüchtigen Erscheinung. Jacques Derrida würde den Hotelgast spielend leicht dekonstruieren können. Der Hotelgast ist weder da noch ist er nicht da, er ist weder anwesend noch abwesend. Er kommt, um zu gehen. Nur ein Dekonstruktivist würde in einem Hotel bleiben. Für jeden andern Touristen liegt der Zweck des Hotelaufenthalts ausserhalb des Hotels: man befindet sich auf Durchreise, besieht sich Land und Leute, besucht eine Fachmesse etc. Das Hotel hält sich im Hintergrund wie ein Oberkellner, der, eingeschlossen in seiner professionellen Distinktion, alles regelt, alles überwacht, aber nie direkt in Erscheinung tritt. Nicht nur der Gast wird zum Phantom, sondern auch das Hotel. Die moralische und funktionale Ausrichtung des Hotels – nämlich Schutz und Unterkunft zu bieten – verkehrt sich ins Dämonische. Die Idealität von Gastlichkeit und Komfort, die unser Vertrauen gewinnen möchte durch Vertraulichkeit, erzeugt eine unterschwellige Inversion, auf die wir mit Angstreflexen reagieren.
Zimmer No 7: Dr. Freud
Die Couch in diesem Zimmer ist zum Glück nur Dekoration. Dennoch wollen wir uns kurz hinlegen und nachdenken. Ist Dr. Freud der wahre Schlüsselverwalter in diesem Hotel? Wir werden sehen. Das Unheimliche, so Freud in seinem gleichnamigen Aufsatz von 1919, sei „jene Art des Schreckhaften, welche auf das Altbekannte, Längstvertraute zurückgeht.“ Freud leitet diese Überlegung direkt aus dem Wort „unheimlich“ ab. Er lässt das Wort selbst sprechen, lässt es in seinem ganzen Bedeutungsspielraum funkeln. Etwas Heimliches, in dem wir eigentlich heimisch sind, entheimlicht sich und erscheint uns unheimlich, weil es uns heimlich anheimelt. Das „Un“ markiert die Dissoziation im Vertrauten. So gesehen sind die unheimlichen Phantasien, die sich um das Wesen und Unwesen von Hotels ranken, Ausdruck einer ursprünglichen Vertrautheit. Beim Durchblättern von Hotelprospekten fällt uns ja auf, dass dieses „Längstvertraute“ die gewohnte Kulisse unserer Bedürfnisse abgibt. Hier wird eine Wunschwelt inszeniert, ein Setting massgeschneiderter Kultur. Kultur ist nach Freud nicht unbedingt ein Übel. Ihre positive Funktion liegt auf der Hand: sie verringert das Leiden, das die Natur uns auferlegt. Kultur, obwohl auf Triebverzicht aufgebaut, macht das Leben erträglicher. Sie ist eine Zwangsjacke, die uns schützt. Hier zeigt sich ein Dilemma, dem sich sowohl der Einzelne wie auch die Gesellschaft unmöglich entwinden kann. Die Zwiespältigkeit, die Freud in der Kultur diagnostiziert, ist im Innern des Menschen angelegt, in seinen widerstreitenden Trieben. Eros und Todestrieb liegen im Clinch. Die Kultur muss diesen Konflikt regulieren, um das Schlimmste zu verhindern: Krieg, Anarchie, Barbarei, den Zusammenbruch jeglicher Moral. Aus Erfahrung wissen wir – und das wusste schon Freud – dass die Kultur die von ihr geforderte Leistung nicht immer zu erbringen vermag. Sie ist störanfällig. Sie kann zusammenbrechen. Kein Wunder, ist uns angesichts unserer kulturellen Errungenschaften immer ein bisschen mulmig zumute. Im Dilemma zwischen Zwang und Zusammenbruch sitzen wir fest. Wir können das verdrängen und unsere Kultiviertheit mit einer sicheren Zuflucht verwechseln. Ein lebenslänglich Gefangener fühlt sich in seiner Zelle sicher, und er schmückt sie liebevoll aus. Unsere Alltagswelt wird durch eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen derart ästhetisiert, dass es uns schwerfällt, das Ungestaltete, Missgestaltete, Willkürliche, Zufällige und Unberechenbare zu akzeptieren. Gerade deshalb ist es omnipräsent in Erzählungen und Filmen, die wir geniessen, weil sie uns vom Druck der Verdrängung befreien. Sie machen das Unakzeptable akzeptabel. Wenn in einem Spielfilm gemordet wird, ist das eben Kultur und nicht Mord. In öffentlich zelebrierten Angstphantasien verwandelt sich das potentiell Barbarische in Kultur. Was der Kultur feindlich gegenübersteht, verleibt sie sich selbstregulierend ein. Den Preis, den wir dafür bezahlen, ist hoch. Das von Freud diagnostizierte Dilemma sitzt uns beständig im Nacken. Unsere Kultiviertheit hat eine Schlagseite. In dieser Hinsicht sind Hotels Orte einer tiefgreifenden Ambivalenz. Hotels kultivieren die Kultiviertheit. Dadurch fordern sie die negativen Phantasien geradezu heraus. In seiner Ambivalenz spiegelt das Hotelphantasma nicht nur den Kampf zwischen Eros und Todestrieb, sondern auch das Unbehagen am Dilemma zwischen Kulturzwang und Kulturversagen.
Abreise
Bevor wir dieses Hotel mit seinen Schreckenskammern, doppelten Böden und endlosen Fluren verlassen, gehen wir noch einmal zur Reception, deponieren unsere Koffer und setzen uns in die Lobby. Aus versteckten Lautsprechern trällern die Eagles ihr „Hotel California“. „You can checkout anytime you like, but you can never leave.“ Nun, das wollen wir mal nicht hoffen. Die Zimmerschlüssel haben wir abgegeben, und die Koffer stehen bereit. Wir warten bloss noch auf ein Taxi, oder nein: wir bleiben ganz bewusst noch ein wenig sitzen und greifen nach den Prospekten, die gut sortiert vor uns auf einem Tischchen liegen. Niemand drängt uns zu gehen. Die junge Receptionistin, die gerade ein Telefon abnimmt, lächelt wie eine Muskatblüte, und der pausbäckige Portier mustert gelangweilt seine Manschettenknöpfe. Eigentlich ist das Hotel gar nicht so schlimm. Die Alpträume sind verflogen, die Schimären haben sich aufgelöst. Fast schämen wir uns, weil wir immer alles so schwarz sehen. Doch dann... Aus einem der Prospekte, die wir zur Hand genommen haben, grinsen uns blutig rote Buchstaben an:
„Blutsuppe“: der ultimative Krimi-Event für Firmen- und Gruppenanlässe! „Blutsuppe“ ist die spassige Mischung aus Erlebnisgastronomie und interaktivem Theater... Das köstliche Essen und der freundliche Service runden den Anlass ab und machen „Blutsuppe“ zu einer Veranstaltung der Spitzenklasse. Individuelle Wünsche wie Produktpräsentationen oder Promotionen können in die Story eingebaut werden!
Fliehe, wer kann!
2009
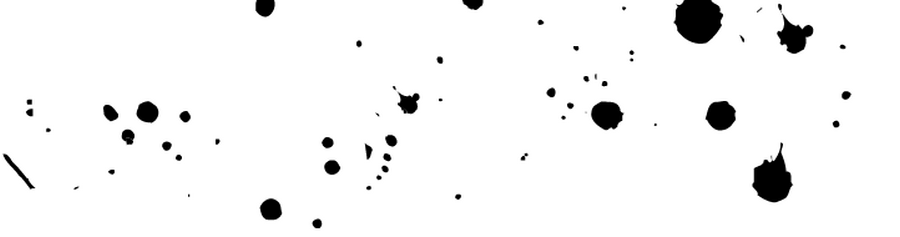 wörter
worte
wörter
worte