Überland
Inhalt des Projektes “Überland”
Während eines ganzen Jahres durchstreifte ich auf zahlreichen Wanderungen das Gempengebiet. Was ich von dort mitnahm (Erlebtes, Gesehenes, Gefundenes), verwendete ich in sukzessiver Sichtung und Bearbeitung als Rohmaterial für eine vertiefte Auseinandersetzung mit Wahrnehmung, Realität und Transformation von Realität. Auf der Grundlage von gesammelten, photographierten, gefilmten, gemalten und skizzierten Materialien entstand in summa so etwas wie eine “Miniaturwelt”, eine “imaginäre Baustelle”, die ihre reale Vorlage nicht einfach spiegelte oder abbildete, sondern in der künstlerischen Aneignung gleichsam transformierte. Auf diese Weise wurde es mir möglich, eine scheinbar vertraute Landschaft neu zu entdecken, aus meiner subjektiven Wahrnehmung heraus zu rekonstruieren, zu verfremden und zu fiktionalisieren.
Die installative Ausstellung im Jundthuus Gelterkinden
Ausgehend von meinen Erlebnissen sowie von Skizzen, Photographien, Ölbildern, Video-Aufnahmen und gesammelten Objekten versuchte ich, die Imaginationsräume, die durch mein Unterwegssein entstanden waren, auf mehrschichtige Weise erfahrbar, mitteilbar, begehbar zu machen. Im Jundthuus in Gelterkinden (19. - 31. August, 2005) legte ich auf zwei Etagen einen bebilderten Wanderweg an, der einerseits die Fülle veranschaulichte, die ich unterwegs angetroffen hatte, andererseits die Besucher durch eine Vielzahl von Exponaten und Medien überforderte und zu einer selektiven Betrachtungsweise zwang. Sich in der Fülle verlieren, auf Irrwege geraten, nach Orientierung suchen: auf diese Weise konnte man im Jundthuus selber auf Entdeckungsreise gehen, meine Entdeckungsreise teilen.
Das Journal
Das Journal ist ein Konglomerat aus Texten, in denen ich meine Erlebnisse beschrieben und reflektiert habe. Beim Schreiben zielte ich nicht auf eine geschlossene und abgerundete Form ab, sondern versuchte, analog zu meiner bildnerischen Arbeit, verschiedene, teils auch widersprüchliche Erzähl- und Reflexionsebenen einzuschalten. Selbstverständlich habe ich diese Texte in ihrem rohen und fragmentarischen Zustand belassen, sie erheben keinen literarischen Anspruch. Im Ausstellungsraum lag das Journal als “Begleitlektüre” auf, daneben habe ich Zettelchen mit Textauszügen unter die Exponate gemischt, um ein Verweissystem aus Objekten, Photographien und Textpassagen herzustellen.
J o u r n a l
Anreise - Ich habe nur das Nötigste eingepackt, auf dieser Reise ist schon das Nötigste ein Luxus. Ich besteige die Trambahn. Es ist neblig, dem Anschein nach bin ich zwar wach, aber mein Körper schläft noch, während ich durch die weiss verhüllte Landschaft geschaukelt werde. Ich lehne mich gegen die Scheibe, die Landschaft zieht langsam vorüber. Aus der Entfernung sind Dörfer zu sehen, graue Scherenschnitte vor einem weissen Hintergrund. Dorfkirchen ragen wie Feudalschlösser aus dem Brei, der sie zäh umfliesst, die Bäume einpuppt, durch sie hindurchstreicht, über die Gärten hinwegsteicht und auf den Wiesen gemächlich in die Breite geht. Bei der kleinsten Luftbewegung werden Wälder sichtbar, Anhöhen mit Baumgruppen und Senken und da und dort ein neumodisches Wohnhaus auf einer blassen, öden Wiese, die wie eine phosphoreszierende Woge sogleich wieder im Nebel versinkt. Ich könnte ohne weiteres einschlafen, die Fahrt ist langweilig genug. Mein Kopf fängt an zu nicken. Ich reisse ihn schnell wieder hoch und halte ihn gerade. Es ist Sonntag, und über der Nebeldecke, soviel ist gewiss, flammt der Himmel, flammt die Sonne wie ein Kronreifen. Man spürt es durch den Nebel hindurch. Bis nach E. bin ich der einzige Fahrgast. Dort steigt eine alte Frau zu. Sie hat eine karierte Stofftasche bei sich, mit der sie sich flüsternd unterhält. Als ich mich schläfrig, beduselt fast, zu ihr umdrehe, verwundert über dieses heimliche Gewisper, das den Tonfall eines geleierten Altweibergebetes hat, wirft sie mir einen tadelnden Blick zu und presst die Tasche enger an ihren winterlich verpackten Leib. Es ist, als müsste sie die Tasche vor mir beschützen. Nach zwei Stationen steigt sie aus, stampfend und wispernd. Draussen bleibt sie stehen und wartet, bis das Tram abgefahren ist, dann tapst sie mit kleinen Schrittchen über die Schienen und verschwindet im Nebel. Ich lehne mich zurück. Ich bin wieder alleine, eine Kurve kommt, der Wagen neigt sich zur Seite, das Fahrgestell ächzt wie ein Schiffsrumpf, fast rutsche ich aus dem Sitz. Drei Stationen, undeutliche Dörfer mit Fabriken und Lagerhäusern, dann die Endstation. Vorläufige Endstation. Ich steige aufs Postauto um. Zwei Stationen später, in einem kleinen Bauerndorf, steige ich wieder aus. Schmutzige Häuser, eine schmale Strasse, ein Brunnen, in den in ruckartig springenden Bögen das Wasser sprüht. Kein Trinkwasser, steht auf einem Emailschild. Misthaufen, Wiesen und Wälder. Hier beginnt mein Weg. Ich kann losmarschieren - der Sonne entgegen.
Das Wandern als zielgerichteter Akt, als praktizierte Teleologie, ist mir noch etwas ungewohnt. Normalerweise wandere ich eben nur, um für einmal kein Ziel und keine Absicht haben zu müssen. Ich wandere ins Blaue hinein, um des Wanderns willen, und nicht weil ich irgendwo ankommen oder etwas erreichen möchte. Ich bemitleide die verkrampft-entspannten Gehsportler, die Power-Walker, oder wie man sie nennt, die sich das Gehen als Pflichtübung auferlegen. Wandern, um den Körper zu trimmen. Wandern, um irgendwohin zu kommen. Beides ist mir fremd. Das Wanderprojekt, das ich zugegebenermassen am Schreibtisch entworfen habe, scheint meine Vorliebe für die zweckfreie Wanderlust auszuschliessen. Dieses Projekt ist widersprüchlich. Da frönt einer der zweckfreien Wanderlust, und gleichzeitig verfolgt er damit den Zweck, die projektierte Zweckfreiheit zu beschreiben und in ein System zu bringen. Wie kann ich diesen Widerspruch rechtfertigen? Am besten wohl durch den Hinweis auf die eingebaute Inkonsequenz.
Die Sprache – überhaupt das Akustische – ist das Primäre. Der Mensch vermittelt und ordnet die Welt mit sprachlichen Lauten. Wäre für ihn die Welt nichts weiter als ein Sammelsurium von Bildern, so hätte er sich nie aus der kauernden Haltung erhoben. Beschreiben ist wichtiger als Sehen, Denken wichtiger als Wahrnehmen. Man sollte die Dinge beschreiben, bevor man sie gesehen hat, und sie dann so sehen, wie man sie beschrieben hat.
Auf der heutigen Wanderung fällt mir auf, dass das Gras vielerorts grün ist. Eine bemerkenswerte Tatsache. Ich notiere ohne jede Ironie (denn was wahr ist, ist wahr): das Gras ist grün.
Quantität, Qualität, Relation, Ort und Zeit: das sind die Faktoren, die in ihrem Zusammenspiel die Aufmerksamkeit mobilisieren.
Erzeugen diese Faktoren ein Missverhältnis, so wird die Aufmerksamkeit augenblicklich alarmiert. Beispiele: ein Zebra auf der Kuhweide. Ein Riesenpilz (Parasol). Eine ausgelichtete Stelle im Wald.
Dass das Gras grün ist, ist mir eigentlich nur aufgefallen, weil ich Künstler bin.
Die Natur lässt keine Distanz zu. Sie beschenkt uns generös. Es gibt Beeren und Pilze, wo man hinschaut, Blüten, die sich ballen vor Energie und wippen unter dem Gewicht von Hummeln und Bienen. Im Frühherbst drängt sich noch einmal eine ungeheure Fülle hervor. Es ist ein Rennen gegen die Zeit. Die Natur ist kein Phantom, sie ist das Reale schlechthin, das absolute Gegenüber. Die Wolken, der Wind, das Wuchern ringsum. Das Phantom ist der Mensch. Seine Garten- und Landschaftspflege ist ein Schwimmen gegen den Strom.
Die Feuerwanzen: kleine Schildträger.
Die wächsernen Kolben des Schopftintlings säumen die Wegränder. Pilze, die ich der Einfachheit halber Rübis & Stübis nenne, saugen sich fest an totem Holz. Teile des Wegs sind mit einem Flor winziger Fingerhüte und Pusteln bedeckt. An den Baumstümpfen haften dicke flunderförmige Porlinge. Der ganze Wald riecht nach Pilz.
Wahrnehmung (etwas für wahr nehmen) ist eigentlich selten identisch mit dem, was uns die Sinnesorgane zugänglich machen. Was steht der Wahrnehmung überhaupt zur Wahl? Die Wahl ist klein. Es gibt unendliche Räume, die sich der Wahrnehmung entziehen. Die ganze Mikrowelt. Die Rückseite des Mondes. Mein Rücken. Das Leben unter dem Boden, hinter der Baumrinde, in meinem Körper. Was ich sehen kann, wird mitgeformt durch Dinge, die ich weiss. Ich weiss, dass der Weg da vorn hinter der Biegung weitergeht, obwohl ich die Fortsetzung der Biegung nicht sehen kann. Mein Wissen ist also eher ein Vermuten, ein voraustastendes Nicht-wirklich-wissen-können. Dennoch halte ich mein Vermuten für ein Wissen: ich sehe die Biegung und schliesse aus ihr, dass der Weg dort nicht aufhört, sondern lediglich seine Richtung ändert. Ich habe Kenntnis darüber, ich habe ein Weltwissen, das diese Kenntnis in sich einschliesst. Ich bin es gewöhnt, dass die allermeisten Wege irgendwohin führen. Ich weiss auch, dass die Welt hinter dem Bergsattel weitergeht. Sehen kann ich das nicht. Was ich dort sehen kann, müsste mich erschrecken: die Welt hört auf. Sie hat einen Rand! Doch warum ist mir das gleichgültig? Warum erschreckt es mich nicht? Dass uns die Sinnesorgane täuschen, ist eine Selbstverständlichkeit. Das haben wir tief verinnerlicht. Was sie uns zuspielen, muss ständig ergänzt und umgebaut werden. Ich stelle mir den Mond als Kugel vor, obwohl ich ihn ja nur als Scheibe sehe. Ich sehe also Dinge, die ich nicht sehen kann, ich beziehe den schmalen, sichtbaren Ausschnitt der Realität auf das Grosse, das ihn umgreift, das ich aber nur denken und nicht sehen kann. Ich habe eine Ordnung im Kopf und richte nach ihr meine Wahrnehmung aus. Ich stelle mir vor, dass... Ich weiss, dass... Das Sichtbare ist eine winzige Insel im Unsichtbaren. Auf dieser Insel bin ich ein Robinson und muss mir irgendwie zu helfen wissen.
Wie sich diese schwebende Suppe allein durch ihre Entfernung vom Betrachter in eine modellierte, kompakte Wolke verwandelt: das ist Zauberei.
Schafe rühren mich unwiderstehlich an. Frühstücksflocken auf vier Beinen.
Etwa jede Stunde bleibe ich kurz stehen und überlege mir, was ich auf der soeben zurückgelegten, einstündigen Wegstrecke erlebt habe. Was kann ich auf die Schnelle rekapitulieren? Was ist hängengeblieben? Dieser einfache Gedächtnistest (eine Art Stichprobe) zeigt mir, was der Aufmerksamkeit in die Netze geht – und in welcher Reihenfolge. Dies geschieht ganz zwanglos, und manchmal vergesse ich es auch. Ich bin weit davon entfernt, eine statistische Datenbank einzurichten. Wollte ich greifbare Ergebnisse erzielen, so müsste ich die Aufmerksamkeitsfaktoren auflisten. Ich müsste sie einer bestimmten Logik unterwerfen, systematisieren, nach Häufigkeit ordnen. Das widerstrebt mir. Ich möchte so lax und normal wie möglich bleiben. Wenn nämlich bei einer solchen Tabelle herauskäme, dass in dreissig von hundert Rückblenden Äpfel vorkommen, so könnte ich mich in der Folge auf Äpfel einschwören und nur noch Äpfel wahrnehmen, weil „die ja erwiesenermassen meine Favoriten sind“. Auf diese Weise würde ich wahrscheinlich ein entstelltes, sicher aber ungenügendes Bild meiner Wahrnehmung wie auch der Wirklichkeit gewinnen. Denn eines ist klar: die Wahrnehmung wird im wesentlichen vom Zufall bestimmt. Man kann den Zufall gar nie ausschalten. Die Gefahr einer Statistik liegt auf der Hand: Zufälligkeiten werden zu einem System umgemodelt. Und aus diesem System ergeben sich dann Imperative, die die Auffassung darüber, was ist oder sein soll, eingrenzen und zuspitzen, d.h. man geht irgendwann dazu über, das System, das man sich ausgedacht hat, zu verinnerlichen und eine dazu passende Wirklichkeit herzustellen. Solche Rückkopplungseffekte trifft man häufig in der Psychologie an. Dort finden die Forscher und Analytiker meistens genau das, wonach sie suchen. Den Schatz, den sie ausgraben, haben sie selber vergraben. Sobald ich die Wirklichkeit untersuche, ist sie eben keine Wirklichkeit mehr, sondern eine auf die Untersuchung zugeschnittene Pseudo-Wirklichkeit, ein Präparat. Dem sezierten Frosch fehlt es gewissermassen ein bisschen an Lebendigkeit. Eine Wahrnehmungsstudie kann nur gelingen, wenn man sich selbst (den Versuchsfrosch) so lässt, wie man ist. Das heisst: ich vergesse den ganzen Theoriekrempel und begebe mich in die Landschaft hinaus, wie ich es schon hundertmal getan habe. Mit meinen stinknormalen fünf Sinnen und einem Verstand, der zwar wach ist, aber im grossen und ganzen auch etwas unstet und faul.
Wenn ich dran denke, dass die Fluh dort oben, die gelbweisse Felsformation am Abbruch des Tafelbergs, vor über zweitausend Jahren wahrscheinlich nicht viel anders ausgesehen hat als heute... Die damals hier ansässigen Kelten, jagd- und zauberkundige Leute in karierten Bügelfalten-Hosen, haben genau dieses Felsgebilde gesehen. Ob und inwiefern sie meinen Blick geteilt haben? Zumindest haben sie die Felsfluh mit den gleichen menschlichen Augen gesehen wie ich. Schon etwas seltsam. Diese weiträumige Landschaft erscheint mir als eine Bühne, auf der sich alles, was ich in der Erinnerung oder in der Phantasie abrufen kann, miteinander vermischt. Unablässig verquirle ich die verschiedensten Zeiten, mische sie zusammen, lasse etwas Diffus-Zeitloses daraus entstehen. Urwelt, Keltentum, Mittelalter, Biedermeier, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Kindheit der Eltern, eigene Kindheit, Jugendzeit, vorgestern, gestern, heute. Man lebt ja nicht nur die eigene Lebensspanne, sondern trägt darüber hinaus auch noch die ganze Biographie der Menschheit mit sich herum. Man lebt aus der kollektiven Erinnerung, spielt die alten Platten ab, sieht sich die schon tausendmal gesehenen Bilder an. Vergangenheiten (Plural!) überlagern sich, Gleichzeitigkeit und Zeitwidrigkeit, wohin man blickt. Die Gegenwartsbestimmung wird zum Problem. Ich teile meinen Blick mit Menschen, die es nicht mehr gibt, ich schaue, während ich Gegenwärtiges anschaue, immer auch in die Vergangenheit, die wesenlos ist, weil sie eine Abstraktion darstellt, eine Gedächtnis- oder Imaginationsleistung, und ich denke über Dinge nach, die keine direkte Erfahrung zulassen. Und das alles fliesst in meine direkte Erfahrung ein.
Das Eichhörnchen mit seinem buschigen Fragezeichen.
Was immer man auch beobachtet, schreibt und denkt: es ist alles ganz anders.
Eine Welt erforschen, die es nicht gibt.
Der Zunderporling (ich glaube, das ist sein Name) ist ein Pilz von der Grösse eines Schuhschranks. Er ist dick und wulstig, dabei aber seltsam gequetscht, als hätte ihn jemand von sehr weit oben herabgeschleudert. Auf Mundart sagt man: „E Pflöm“. Seine Erscheinung ist derart massiv, dass man bei seinem Anblick erschrickt.
Die Realität ist ein Trampolin. Ich bin Realist, weil ich mich von der Realität abstosse.
Zur Verteidigung der digitalen Photographie könnte man sagen, dass sie ein Trial-and-Error-Verfahren erlaubt. Man knipst drauflos, spielt mit dem Sujet herum, agiert mit dem Handgelenk, reagiert auf Zufallseinflüsse. Das ist möglich, weil digitales Photographieren kostengünstig und technisch leicht kontrollierbar ist. Man muss nicht auf Anhieb das Richtige treffen. Man kann gleichzeitig verschwenderisch und gezielt vorgehen. Bei der analogen Photographie ist das Vorgehen ein anderes: da schwingt immer dieses „Jetzt-oder-nie-Gefühl“ mit. Was man abknipst, ist materiell verewigt. Der mit analoger Technik arbeitende Photograph überlässt dem Zufall so wenig wie möglich, es sei denn, er macht das Zufällige zum Inhalt, was aber auch wieder gewollt und keineswegs zufällig ist. Beim digitalen Verfahren dagegen wird der Zufall zum Gehilfen im Bildfindungsprozess, ebenso das Reagieren auf den Zufall. Hier kann man das Unwägbare miteinbeziehen, unabhängig davon, ob man es zum Inhalt macht oder nicht. Man steht immer auf der sicheren Seite. Man “versaut” nichts. Man arbeitet mit Überschuss und Ausschuss, Versuch und Irrtum, rascher Fixierung und Korrektur, die Bildfindung verläuft evolutionär. Darwin hätte seine Freude daran gehabt.
Beim Wandern ist der Einzelgänger der Gruppe gegenüber im Vorteil: er kann ausweichen, abtauchen, sich verstecken. Er kann sich seine Begegnungen aussuchen. Werktags kann man sich diese Mühe sparen, die Wanderwege, ob markiert oder nicht, sind nahezu menschenleer. Sie ähneln den zugigen Korridoren eines verlassenen Hauses. Wäre es doch nur immer so! Sonntags bei schönem Wetter erlebt man dann wieder einmal sein blaues Wunder. Wenn alles unterwegs ist, was Beine und Räder hat, lenkt man sich notgedrungen auf Abwege, wird zum Indianer, zum blättergetarnten Guerilla. (Gorilla, hätte ich fast geschrieben: geht auch). Es empfiehlt sich, den Werktag zu nutzen. Das heisst: dann auf Wanderschaft zu gehen, wenn sonst niemand unterwegs ist. Der Werktag, das wissen eigentlich nur die wenigsten, ist ein grosses, verschwiegenes Wunder. Wo man auch hinkommt, es herrscht überall eine zauberhafte Ruhe. Ein paar Schritte in einen Wald hinein, auf eine Ebene hinauf, und schon sind die Geräusche der Zivilisation verklungen. Ein Fuchs steht blinzelnd im Gras, irgendwo trappelt ein Reh. An einem nebligen, langsam sich lichtenden Morgen unterwegs zu sein, fernab von Automotoren und Bulldozern, oder auch mitten am Tag, in einem lichtgrünen Wald, wenn der Regen auf die Blätter trommelt, an einem schwülen Sommerabend, wenn die Grillen sirren, an Kühen vorbei... Solche Streifzüge lassen sich auch ohne Fahrplan, Wanderkarte und Regenschirm ausführen, sie bergen viel Ungewisses, und das ist ja gerade das Spannende daran: die Ungewissheit. Wenn man eine Wanderung unternimmt, sollte man Zeit und Umstände vergessen, dreimal tief Luft holen und in die Landschaft eintauchen, ins Innerste der Landschaft.
Die hiesigen Wege sind staubig und voller Löcher. Im Unterschied zu den Steinstiegen und Ziegenpfaden, die ich benutzt habe, um vom Tal auf die Hochebene zu klettern, verlaufen sie schnurgerade. Ich empfinde das als angenehm. Nicht umsonst hat Napoleon seine Strassen so exakt gradlinig anlegen lassen. Eine gerade Strecke fährt in die Beine wie Trommelschlag. Sie rhythmisiert den Schritt, gibt ein Tempo vor, dem man sich überlassen kann. Plötzlich sausen die Wolken nur so vorüber, und die Erde dreht sich schneller. In einer flachen und offenen Landschaft spürt man diese Beschleunigung noch stärker. Die erste halbe Stunde marschiere ich denn auch wie ein Grenadierjäger. Ich lasse die Arme schwingen, die Pfefferminzbonbondose in meinem Rucksack klappert, das Wasser in meiner Feldflasche schwappt. Entlang des Wegs, zwischen den Ackerfurchen, fliegen schnarrend ein paar Krähen auf. Ich überquere eine Strasse, bleibe stehen, betupfe mit einem Hemdzipfel die Stirn, die Augenbrauen, schnüre mir die Schuhe neu. Ich höre ein feines Pfeifen, das sich zu einem mächtigen Brummen steigert, einem Orgelgetöse. Ein Postauto schwankt auf mich zu, riesig. Hinter der ausgebuchteten Vorderscheibe sitzt der dicke Chauffeur auf seinem federnden Hydrauliksitz. Meine Haare werden nach oben gesogen, eine schwarze, beissende Dieselwolke wirbelt um mich herum. Ich mache einen Schritt zur Seite. Das Postauto durchwuchtet die Luft. Schon ist es vorüber. Ich betupfe abermals mein Gesicht: es ist ganz schwarz. Bald höre ich wieder das feine Pfeifen, mit dem sich das Postauto angekündet hat, ein zischendes Säuseln, das sich bald in der Ferne unter vielen anderen Geräuschen verliert. Ich stehe noch immer an der Strasse, komme mir vor wie Ezechiel, nachdem ihm das himmlische Monstervehikel erschienen ist. Die Bienen sind verscheucht, die Hummeln erstickt im Abgas. Nun ist die Strasse wieder leer, eine Geisterstrasse, man könnte sich gefahrlos auf den Asphalt legen, die Hände hinter dem Genick verschränken und langsam, ganz langsam auf Tausend zählen. Ich gehe weiter auf einem Feldweg, Rollsplitt, zerriebenes Korn, getrocknete Dungpfützen. Hauchend fährt der Wind über die Rispen. Gräserstaub vermischt sich mit Wegstaub. Apfel- und Kirschbäume mit wehenden Blättergirlanden. Aus dem gelben, fettigen Löwenzahn tropfen geflügelte Insekten. Das blühende Rapsfeld daneben summt wie ein Stromgenerator, die Luft vibriert vor Betriebsamkeit. Man spürt die Schwingung am ganzen Körper, an den Haarspitzen, an den Fingernägeln. Der Bauchnabel ist ein Loch, durch das sich Millionen von Bienen hinein- und hinauszwängen. Wie Gewehrkugeln schiessen sie durch die Luft, hinein und hinaus.
In meinem Bauch und Brustkorb herrscht ein brutwarmes Gedränge, da werden Larven mit winzigen Nektarportionen gefüttert, werden Waben gebaut, Häuschen, Kammern, Silos, Millionen Bienen klettern, kriechen und fleuchen aufeinander herum, schubsen sich, suchen einen Weg durchs Gewühl. Ich strecke zögernd meine Hand aus. Sie summt. Ich strecke die andere Hand aus. Sie summt ebenfalls. Ich greife an den Bauch. Er summt. Ich öffne den Mund, und das Summen in meinem Bauch schwillt an, füllt den Kopf, flimmert in den Augenhöhlen, zischt aus dem Mund, eine Armee von geflügelten Dartpfeilen stürzt sich brüllend auf die Felder, die nickenden Blüten. Eine graue Wolke aus hin und her schiessenden Pünktchen, schräg gegen den Wind gerichtet wie Rauch, lässt sich auseinanderblasen, treibt davon. Ja, es windet. Auf den Feldern des Tafeljuras herrscht der Wind fast uneingeschränkt. Für die stetige Luftströmung gibt es kaum Hindernisse. Hie und da eine malerische Baumgruppe, ein abgezirkeltes Rund voll Schatten und Gewisper in irgendeiner vernachlässigten Feldecke. Dort hört man den Wind nur gedämpft, die Bäume fangen ihn ein, drosseln sein Ungestüm. Aber sonst kann der Wind drauflospreschen, wie er will. Es schadet ja nicht, wenn man einmal etwas härter angefasst wird. Wir Talbewohner sind klimatisch verwöhnt. Wenn das Wetter bei uns ankommt, hat es sich schon gemässigt. Wir sind geschützt und geborgen in den lieblichen Falten einer milden, wohltätigen Landschaft. Die einzige Zugluft, die wir kennen, ist diejenige, die ein vorbeirauschender InterCity erzeugt. Das bisschen Wind, Regen Schnee und Hagel, das es bei uns absetzt, lassen wir uns anstandslos gefallen. Wir bezahlen weniger als die halbe Miete. Nie ist das Wetter so schlimm, als dass es uns auch nur für eine Nacht den Schlaf rauben könnte. Wenn der Sturm vorüber ist, stellen wir fest, dass der stramme Gartenzwerg mit der Sturmlaterne wieder einmal in Ohnmacht gefallen ist. Von grösseren Schäden bleiben wir glücklicherweise verschont. Unsere Hügel schlucken den Regen, brechen den Wind, wie wenn sie eigens dazu da wären. Auf der Hochebene hingegen, wo alles so flach ist wie in Holland, nur etwas höher gelegen und ohne Deiche, bekommt man jede Wetterlaune schmerzhaft zu spüren. Es mangelt nicht an Spuren, die das bezeugen: Schäden, Windbrüche, Verwüstungen, Kahlrasuren, wohin man blickt. Ganze Quadratkilometer soliden Waldes zu Boden gemäht, kreuz und quer liegen die geknickten und entwurzelten Stämme, die wegzuräumen so viel Zeit beansprucht, dass die Waldarbeiter zufrieden sein können, wenn sie bis zum nächsten Sturm damit fertig werden. Dann beginnt alles wieder von vorn: falls bis dann überhaupt noch ein Baum steht. Doch meistens bleiben genügend Bäume übrig. Es ist dafür gesorgt, dass der nächste Sturm nicht zu kurz kommt. Die Waldarbeiter haben sich darauf einzustellen. Ich beneide sie nicht. Ich denke oft, dass sie den Fatalismus von Totengräbern haben müssen, denen die Arbeit ja auch nie ausgeht. Es wäre schon etwas seltsam, wenn man sagen würde: der Totengräber hat seine Arbeit zu einem glücklichen Ende gebracht. Was die Waldarbeiter auszeichnet, das ist ihr heroischer Verzicht auf Perspektiven, die Vergeblichkeit ihres Tuns, ihre Tapferkeit und unbedingte Bereitschaft, sich für eine Arbeit herzugeben, die enorm aufwendig ist und kaum Gewinn abwirft. Das Fällen und Abschleppen von Holz, das in grosser Menge nachwächst und das niemand kaufen will, weil es im Übermass vorhanden ist, kreist in sich selbst. Vielleicht hat diese Arbeit anderswo einen Sinn. Ich meine ausserhalb des Holzhandels. Vielleicht geht es um die Borkenkäfer. Der Fachmann könnte mich sehr leicht davon überzeugen, dass diese Arbeit sinnvoll und nötig ist. Ich weiss es nicht. Mein Kopf glaubt ihm, mein Gefühl glaubt ihm nicht. Als Forstwirtschaftslaie sage ich unumwunden, dass ich umgestürzte Bäume schön finde - genauso schön wie stehende. Man muss ja nicht gleich jeden Wald in einen Stadtpark verwandeln. Ich habe von einem Förster gehört, der die Bäume in seinem Waldbezirk wäscht, sie richtig poliert, mit Seifenlauge abschrubbt, und zwar jedes Frühjahr beim ersten Kuckucksruf. Ich weiss nicht, bestimmt gibt es auch dafür ein Argument, das ich als Laie unmöglich hinterfragen kann, ich möchte ja den Förstern nicht dreinreden. Ich sage nur, dass mir der sichtbare Verfall genauso gefällt wie das erste zarte Grün. Beides gehört dazu. Nichts sollte ausgesondert werden. Was gibt es Schöneres als ein Waldstück, das buchstäblich vermodert, sich nach und nach in eine Spukhöhle verwandelt, einen Grimmschen Märchenwald? Schlüpfrige Wege über moosige Baumriesen hinweg, Bartflechten und Fliegenpilze, grüne Tümpellöcher, Sümpfe und Schlick, würgendes Geblubber, schniefendes Stöhnen, galliges Krächzen, röhrendes Schnauben, ein Waldboden mit Schluckauf, urzeitliche Farnwedel, und das alles in eine Spinnwebhaut eingesponnen, verhext und verzaubert in einem Wald aus dünnästigem Gestrüpp. Warum sollte es nicht auch solche Wälder geben? Ich plädiere für die Vielfalt, und natürlich würde mir jeder Förster sofort zustimmen. Auch der Förster will die Vielfalt. Er fördert sie, indem er totes Holz wegschafft. Alten Bäumen bricht er das Genick. Er räumt auf. So wächst neues Holz nach, das Unterholz wird reich an neuen Arten. Die Vegetation wird aufgefrischt. Dank des ungehinderten Lichteinfalls entsteht ein kräftiger Jungwald. In den sonnenbeschienenen Lichtungen brutzeln Erdbeeren, krabbeln seltsame Insekten herum. Alles lebt. Aber wo bleibt da mein Märchenwald? Der Wald ist offenbar etwas, das man unentwegt in Ordnung bringen muss. Der Urwald - und nichts anderes ist ja ein Märchenwald - passt nicht in dieses Konzept. Es sei denn, man macht ihn zum Reservat mit klaren Grenzen und einem speziell geschulten Forstamt, das darüber wacht, dass niemand an diesem Wald etwas ändert. Man hätte dann die absurde Situation, dass die Nicht-Pflege des Waldes kostspieliger ist als seine Pflege. In was für einer Welt leben wir eigentlich? Ich mache den Förstern keinen Vorwurf. Von mir aus können die Wälder zahm bleiben. Mir ist es vielleicht sogar lieber so. Ich möchte kein Trekking veranstalten, wenn ich wandern gehe. Ich möchte meinen Wanderweg nicht mit dem Buschmesser freihauen müssen. Und es hat durchaus seinen Reiz, wenn die Märchenbilder das bleiben, was sie seit jeher gewesen sind: Pforten zu einer inneren Welt.
Nach einer zweiwöchigen Zwangspause nehme ich meine Streifzüge wieder auf.
Die letzten zwei Wochen, die scheinbar so mühelos, scheinbar mit nichts verflossen sind, haben ein wüstes Durcheinander zurückgelassen. Der Wald ist nicht mehr der gleiche wie vorher, er sieht mitgenommen aus. Alles ist vertauscht, umgestellt, verhudelt und zerrupft. Ich habe etwas verpasst und bin mir nun Rechenschaft schuldig. Ich habe die Tage wohl mitgezählt, kalendarisch zumindest, aber ich habe sie nicht mit dem Mass gemessen, das den realen Auswirkungen der verstrichenen Zeit gerecht würde. Jahre und Jahrzehnte können sich im Zeitraum weniger Tage zusammenstauen, sich ausschütten wie eine riesige Gewitterwolke. Zeit ist relativ.
Der Wald ist blattlos und blass. Die Wege liegen begraben unter organischem Abfall.
Die Blätter sind klebrig und heften sich fest.
Die Geräusche des sich aufweichenden Frostes, des von der Kälte zusammengepressten Holzes: als würde jemand Flöhe knacken.
Der Wald hat sich nach allen Richtungen erweitert und geöffnet. Durch die kahlen Äste scheint die Morgensonne. Das Licht ist gelblich und staubig, das typische Winterlicht.
Grauweisse Haarbüschel, Pelzfetzen. Da haben sich zwei Tiere artgerecht verprügelt.
In die frostige Luft könnte man Nägel einschlagen.
Auf der Wiese steht ein Pferd. Es furzt.
Raum & Licht. Das Einzelne wird kenntlicher, da die Blätter weg sind. Unter dem Zustrom von Sonnenlicht entwickelt sich eine neue Raumqualität. Ein Lichtkörper schiebt sich in den Waldkörper.
Lichtbögen und Luftbögen auf braunem Fundament.
Wenn man die Natur erleben will, muss man den Verdauungsspaziergang vor dem Essen machen.
Ein Lichtstrahl zielt durch die Baumäste und fällt auf den Boden. Am Ende des Lichtstrahls leuchtet ein Schmutzfleck.
Die jungen embryonalen Pilze klopfen von unten an den Boden. Sie wollen heraus.
Die Sonne blendet, sie stört die Sicht. Wenn man ihr aber den Rücken zudreht, sieht man alles in eine tiefblaue Nacht getaucht.
Das Laub ist eine einzige zerstückelte Substanz. Man schlurft darin umher wie in einem Goldhaufen, man schöpft es mit beiden Händen und staunt.
Der Boden ist so hart, dass es einem beim Gehen die Gelenke staucht.
Ich kenne das Gempengebiet relativ gut. Mit Betonung auf relativ. Ich habe es oft durchwandert, und ich muss dazu sagen, dass ich nirgendwo, weder in der Schweiz noch im Ausland, je eine Landschaft angetroffen habe, die auf so kleinem Raum so viele verschiedenartige Landschaftstypen in sich versammelt. Man hat hier alles, ausser Hochgebirge und Wüste. Natürlich fasse ich den Begriff „Gempengebiet“ nicht allzu eng. Laufen, zum Beispiel, gehört noch knapp dazu, Liestal auch. Wo es im Süden aufhört, muss ich noch herausfinden. Der Süden verläuft sich in der Jurakette, und was dahinter ist, das interessiert mich nicht. Die Welt könnte dort aufhören. Dass ich durch mein Projekt plötzlich auf Wege und in Gegenden komme, die ich noch nie betreten habe, ist mehr als nur ein willkommener Nebeneffekt meines Wanderns. Es ist die Quintessenz meines Wanderns. In den Winkeln und Falten dieser Landschaft, die ich immer nur wie in einer perspektivischen Verkürzung wahrgenommen habe, entdecke ich auf einmal eine ungeahnte Weiträumigkeit. Ich sehe, wie verwinkelt und verhügelt das alles ist und wie schnell es geschehen kann, dass man neben den Hauptrouten die Orientierung verliert und die Zeit falsch einschätzt. Plötzlich wird es Abend - und man steht noch irgendwo im Kraut. Mehr als einmal bin ich mit der Sonne um die Wette gerannt. Die Häufigkeit, mit der ich des Projektes wegen unterwegs bin, verändert diese Landschaft, vergrössert sie. Manchmal habe ich das Gefühl, sie sei unendlich in sich verschachtelt oder in der Art eines sich ständig verändernden Labyrinths angelegt, so dass man gar nie durchkommt. Ständig entdecke ich neue Abzweigungen und gehe in die Irre, komme von einer bekannten Route ab und finde dafür eine neue, die mich noch tiefer in die Irre führt. Das Gempengebiet ist zwar ein beliebtes Ausflugsziel, aber erst wenn man die Mühe auf sich nimmt, es wochenlang und bei jedem Wetter zu durchwandern, und auch vor den hintersten Tälern und Krachen und den steinigsten Trampelpfaden nicht haltmacht, wird es eine Erlebniswelt.
Mit leichten Brechungen und zitteriger Lautstärke weht der kleine Lärm der Dörfer und Höfe zu mir herüber. Ich muss gehen, voranschreiten, damit ich nicht Wurzeln schlage. Die Entfernungen wachsen, und der Abend kommt früh.
Der Wald zeigt sich bruchstückhaft. Was ihm fehlt, um etwas Einheitliches zu sein, ist das Dach. Ohne Dach bleibt das Gebäude auf den Grundriss reduziert.
Die weissfarbenen Baumspitzen im Porzellanladen des Waldes. Die vorwurfsvoll knirschenden Scherben unter den Schuhsohlen.
Als sich der Spätsommer seinem Ende zuneigte und das viele Grün der Wiesen und Wälder zu gilben anfing, da dachte ich: nicht schlecht. Mit dem Einheitsgrün hat es nun ein Ende. Der Herbst durchlöchert die Landschaft, zerstückelt sie. Er sorgt für Anschauungsmaterial. Die Farben treten auseinander, sie differenzieren sich aus. Endlich ergab sich die Gelegenheit, das Werden und Vergehen verschiedener Warmtöne zu studieren, ihre vielfältige Nuancierung und Durchmischung in natura erleben zu können. Ich sah den ganzen Herbst vor mir wie ein Sammelsurium aus Malkastenfarben. Ich hatte mir vorgenommen, Blätter zu sammeln, einen Katalog mit Farbmustern anzulegen, Tonwerte und Farbabstufungen festzuhalten in exakten Beschreibungen, Spezimina, Zuordnungen und Skalen. Aber daraus wurde nichts. Bald wurde mir klar, dass mich diese ganze Farbenfülle überhaupt nicht interessierte. Die farbigen Blätter langweilten mich. Über meinen Kopf hinweg und jenseits meiner Interessen summierten sie sich zu etwas, das ich müssig hinnahm. Es gab da jedoch ein Phänomen, das sich dieser Fülle widersetzte und sich ihr gleichzeitig mit grosser Subtilität anschmiegte. Dieses Phänomen begann mich zu interessieren. Indem ich mich daran machte, einzelne Blätter unter die Lupe zu nehmen, entdeckte ich hie und da eine kleine Verunreinigung, eine graufleckige Struktur, eine Substanz wie Mehlstaub oder Asche, manchmal mit einem auffallenden Glimmer. Viele Blätter waren von einem merkwürdigen fleckigen Ausschlag befallen. So ein Fleckmuster setzte sich aus unzähligen kleineren und grösseren Ringen oder Punkten zusammen. Das sah aus wie eine Luft- oder Satellitenaufnahme mit Ballungszentren und lockeren Streuungen. Von einem Muster zu reden, ist vielleicht falsch, die Streuung der Punkte suggerierte ein Muster, ohne jedoch eine klare Regelmässigkeit aufzuweisen. Bald achtete ich überhaupt nicht mehr auf die Färbung der Blätter, sie schien unter dem fleckigen Befall zu verschwinden. Stattdessen studierte ich immer wieder diese feinen, silberfarbenen Ziselierungen, die allerdings auch etwas Skabiöses, Parasitäres hatten. Natürlich war die Mehrzahl der Blätter verschont geblieben, aber schon die Minderzahl genügte, um den Eindruck zu erwecken, als seien überall an den Bäumen kleine, unheilkündende Symbole angebracht worden. Der Wald war gezeichnet. Der Tod, oder was sonst es war, das sich hier ankündigte, setzte sich diskret, aber allgegenwärtig in Szene.
Pilze, die so wohlgebaut sind wie wohlriechend, wandern für gewöhnlich in den Kochtopf. Aber bei genauer Untersuchung des Waldes stellt man fest, dass die meisten Pilze unter teuflischem Schutz stehen. Weder sind sie wohlgebaut noch verfügen sie über die Duftnote, die ein Pilzesammler als Empfehlung oder Verlockung auffassen würde. Ob ein Pilz geniessbar ist oder nicht, lässt sich leicht abschätzen. Es ist lediglich eine Frage der Kenntnis und des richtigen Instinkts: die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Das richtige Bestimmen und Sortieren versteht sich für den kundigen Pilzesammler von selbst. Mit Sympathie oder Antipathie, Abscheu oder Faszination hat das nichts zu tun. Aber gerade darum geht es, wenn man das Königreich der Pilze nicht mit dem Bestimmungsbüchlein und dem Körbchen durchstreift. Abscheu und Faszination sind hier Wegzeichen, Unbehagen und Staunen halten sich die Waage. Man trifft oft schreckliche Pilze an im Wald, namenlose Gebilde, die sich wie Geschwüre irgendwo festklammern, mit faserigen Streifen und klebrigen Näpfen die Wetterseite von Bäumen hochkriechen oder sich bucklig ins Laub ducken. Manchmal scheinen sie unbeweglich in der Dunkelheit zu schweben, in einer Dünstung aus Leuchtgas, schimmernd in einem Licht, dessen Quelle unsichtbar bleibt, und erst wenn man die Pilze von nahem anschaut, merkt man, dass sie etagenweise an der Rinde eines Strunkes kleben und ihn mit ihren dicken, gelatinösen Körpern zudecken und vielleicht schon so gut wie aufgefressen haben. Aus dem netten, nachbarschaftlichen Zusammenstehen einiger Pilze wird im Handumdrehen ein parasitäres Wuchern und Schlingen. Feine Gase steigen auf. Die braunfleckige Haut, die eigentlich gar nicht so übel aussieht, weil sie da und dort etwas Filziges und Weiches erkennen lässt, eine feinsamtige Aufstülpung, die an das Fell eines Kätzchens erinnert, ist bestäubt mit allem, was in der Luft herumfliegt. Sie ist Staubfänger und Mückenfänger. Doch wenn ihre Zeit um ist, wird sie brüchig und schilfert ab. Der Pilz häutet sich, und aus den Rillen seiner wilden und klüftigen Gewächse quillt schwarzer Sirup, etwas wie Wagenschmiere. Das alles riecht pestialisch. Das mürbe Fleisch zieht Würmer an, die wie betäubt darin herumkriechen und in die Höhlungen und Mulden zwischen den grindigen Schuppen, Bechern, Wülsten und Hauben ganze Eierbüschel ablegen. So geht es zu bei diesen Pilzen, und so bekommt man einen Begriff vom Leben im Nahsichtbereich. Dass dieses Leben den Beweis dafür erbringt, dass sich das Kleine in ein immer noch Kleineres aufspalten lässt, ist eine Erkenntnis, die klein anfängt, weil sie beim Kleinen anfängt. Und dort, beim Allerkleinsten, wuchert der Tod schon in seiner vollen Grösse. Das klingt dramatischer, als es ist. In Wahrheit ist der Tod ein rein mechanischer Vorgang, ein Trick der Natur, ähnlich dem Einsatz einer Versenkbühne, die die Schauspieler im Boden verschwinden lässt. Die Versenkbühne des Todes sorgt dafür, dass das Theaterstück weitergeht. Der Tod durchdringt alles mit seinen chemischen Prozessen. Er ist dafür verantwortlich, dass sich der lebendige Organismus von Beginn weg zersetzt und seine Prosperität Stück für Stück abgibt, bis er sich selber verschlungen, verdaut und mitsamt seinem mechanischen Schlucken und Käuen aus der Welt geschafft hat. Alles verschwindet früher oder später im Boden. Stellt man die Augen auf Nahsicht ein, sieht man das ganze Ausmass des Verfalls. Die Formenfülle der Pilze beruht auf Defekten, auf Rückbildung und Auflösung. Soll man das wirklich untersuchen? Wie wäre das auszuhalten? Was Pilze uns zeigen, kann unserm Alltag nicht gegenübergestellt werden. Es ist etwas völlig anderes. Man kann den Pilzen ihre Geschmackswidrigkeit nicht zum Vorwurf machen. Insofern ist der Umgang mit ihnen gefahrlos. Sie sind etwas, für das man den Geschmack gar nie verlieren kann, weil es nicht Geschmackssache ist. Es lässt sich nicht aussondern wie ein Serienprodukt, das zufällig einen Fabrikationsfehler aufweist. Hat man das einmal begriffen, kommt man gut damit zurecht. Der Ekel ist schnell überwunden, das Unbehagen legt sich. Man gewöhnt sich an alles, sofern es nur interessant genug ist. Dass diese unschuldigen Pilze, die durch rötliches oder schwärzliches Anlaufen in Fäulnis übergehen, etwas Schlimmes oder Ekliges wären, das Gefühl habe ich schon lange nicht mehr. Zuweilen erscheinen sie mir einfach nur kurios. Eine innere Instanz, die mir das Recht aberkennt, etwas schön oder hässlich zu finden, leitet mich dazu an, objektiv zu sein. Unter der Aufsicht meines Verstandes sammle ich Fakten, Fakten und nochmals Fakten. Sobald ich in das Herrschaftsgebiet eines Pilzes eindringe, versuche ich die verworrenen Eindrücke zu ordnen, was natürlich nie ganz gelingt: immer bleibt ein Rest von Wirrnis und Lächerlichkeit. Und am Ende ist das vielleicht das Einzige, was bleibt, während die Merkmale, die man objektiv feststellen und festhalten kann, immer wieder verdrängt werden von Gegenbeispielen lebhaft wuchernder Deformation.
Das Land ist vermessen und aufgeteilt, in ein System gebracht, das Trennungen und Zusammenschlüsse ermöglicht. Doch man kann sich in diesem System nicht nach freiem Willen bewegen: man wird bewegt. Das Land schaltet und waltet nach eigenen Regeln. Es zeigt einem, wohin man zu gehen hat. Einhegungen, Strassen, Wege, Häuser, Äcker und Bäche zerschneiden es in alle Richtungen. Entweder läuft man gegen ein Hindernis oder man wird umgelenkt. Und das geschieht eigentlich dauernd. Wenn die Vögel und der Himmel nicht wären, käme man sich etwas beengt vor.
Im Dezember, wenn die Sonne kaum noch die untersten Drähte der Strommasten erreicht, wird die Welt am hellichten Tag etwas unheimlich. Pfosten, Häuser und Bäume werfen Schatten, die sich endlos lang und spindeldünn über die Landschaft legen. Schwarze Fäden, Gerüste und Gerippe, schwankende Abbilder der Realität, Schemen. Doch der eigene Schatten ist der schlimmste. Er drängt sich überall vor. Man kann ihn nicht beiseite schieben. Wo man auch hingeht, er kommt heraus wie der Geist aus dem Ofenloch und läuft einem hinterher, wenn nicht sogar voraus. Beim Überqueren einer Dorfstrasse sehe ich mich von einer riesenhaften Gestalt verfolgt. Schräg und schwarz ragt sie auf den sonnenbeglänzten Asphalt hinaus, und mit einem wilden Hin- und Herschwanken ihres winzigen Köpfchens, das zu einer fernen Signalkelle wird, krümmt sie sich über die ganze Strassenbreite.
Ich hocke mich nieder, schaue zurück. Der Weg hat sich einen steilen, stoppligen Hang hinaufgewunden. Irgendwo da unten klappert ein Kuhgatter, das nicht richtig schliesst. Die Kühe scheuern sich an den Eisenstangen den Rücken. Auf der anderen Seite, vor mir, steht der Wald. Die Stämme sind schwarz. Im Unterholz schimmert das Tageslicht: eine Motte, die mit ihren mehligen Flügeln zuckt.
Im Gehen vereinigen sich Zeit und Raum zu einer Synthese. Das ist es, was Einstein gemeint hat. (Er hat es etwas komplizierter ausgedrückt).
Gehen ist eine kultivierte Flucht. Ich verlasse mein Haus, weil es über mir zusammenstürzt. Jede Wanderung beginnt mit einem Hauseinsturz. Komme ich abends wieder zurück, hat man bereits ein neues Haus für mich gebaut.
An den Wochenenden ist dieses Gebiet überlaufen mit Wanderern und Ausflüglern. Ansonsten sind Begegnungen selten, beschränken sich auf den Sichtkontakt mit den paar einheimischen Bauern, die irgendwo in ihren Feldern herumwerken. Kommt einem ein Wanderer entgegen, grüsst man laut, oft gestikulierend. In dieser gottverlorenen Landschaft sind Grussrituale wichtig: man wedelt schon von weitem mit der Flagge.
In meinen Augen brennt eine Luft, die feucht und salzig ist und womöglich etwas mit dem Herbst zu tun hat. Es ist völlig windstill. Das Wehen, das ich auf meinem Gesicht spüre, kommt nur von der Schnelligkeit, mit der ich gehe. Die Baumstämme am Wegrand sind braunschwarz gesprenkelt, und manchmal fällt eine Nuss herab und klappert über den Asphalt. Die Böschungen sind mit Laub überstreut. Immer wieder treffe ich auf einen kleinen, mit Erdknollen durchmischten Laubhaufen, an dem gerade ein paar Krähen rupfen. Komme ich näher, so hüpfen sie widerwillig ins Feld hinein und schwingen sich fort. Ich lese ein paar Nüsse auf, die mürben und beschädigten lasse ich wieder fallen, die andern stopfe ich in die Hosentaschen. Auf den verschlammten Feldern liegen Gerümpelteile herum, mit Schmutz, Rost und Pilzflechten überzogene Räder, Gewinde, Dreschtrommeln, Walzen, Zylinder und Kartoffelkörbe. Aus der Ferne hört man Stimmen und Hammerschläge. Eine Motorsäge heult auf. Und dann ist da der Wald: eine abweisende, schwarze Wand. Kaum habe ich diese Wand durchschritten, ist alles hinter mir wie ausgelöscht. Meine Schuhe machen ein weiches Geräusch. Nach wenigen Schritten bleibe ich stehen. Irgendetwas zwingt mich anzuhalten. Der Wald ist düster und mindestens so gemütlich wie eine Turnhalle. Er besteht aus strengen, hochästigen Tannen, die miteinander verbunden sind in einem endlosen Gewirr von gestrickten und gehäkelten Ästchen. Mir ist zumute, als erlebte ich einen wichtigen, mich vollständig ausfüllenden Moment. Aber dieses Gefühl verblasst so plötzlich, wie es gekommen ist. Ich sehe mich in eine Umgebung versetzt, die eigentlich nichts ist, sehe es auf einmal so glasklar, dass ich lachen muss. Ich durchschaue das Nichts. Was ich da um mich herum habe, ist nichts als Wald, und was ich fühle, ist nur die Wirkung, die dieser Wald auf mich ausübt, und weiter ist es nichts. Ich erlebe hier also eigentlich nichts, ausser dass ich im Anblick der sich weithin ausdehnenden Waldhalle nicht einfach schnurstracks weitergehen kann, sondern, wie unter Zwang, einen kurzen Augenblick lang stehenbleibe, überrumpelt von der Höhe der Tannen, der Ordnung und Grösse, die mich umgibt, und was ich da sehe, erscheint mir ziemlich sinnlos. Es ist wie in einem Klartraum, in dem einem schlagartig bewusst wird, dass er nichts zu bedeuten hat: weil er doch nur ein Traum ist. Als ich weitergehe, höre ich wieder das Heulen der Motorsäge, das Stottern, wenn sie gegen eine Verhärtung im Holz ankämpt, das langgezogene Auslaufen des Motors, das Puffen, Knattern und Rattern, wenn er abgewürgt wird. Der Forstarbeiter im orangen Overall arbeitet unermüdlich, fast verbissen. Sobald die Säge einmal aussetzt, heult sie gleich wieder auf und frisst sich von neuem in das sägemehlspeiende Holz hinein. Und plötzlich ist sie durch den Stamm hindurch. Die Tanne wackelt. Der Forstarbeiter tritt einige Schritte zurück und streicht sich mit einem Lappen über den Mund, während er wie gebannt nach oben blickt. Noch steht die Tanne aufrecht. Das endgültige und tonnenschwere Kippen, das er mit Spannung erwartet, kommt nicht sofort. Die Tanne braucht ewig, um überhaupt aus der Senkrechten zu kommen. Scharf krachend neigt sie sich hierhin und dorthin. Dem Ziehen und Zerren der Schwerkraft überlässt sie sich nur widerwillig, noch stemmt sie sich dagegen, knirscht trotzig mit den Zähnen. Der Forstarbeiter sieht mich, grüsste mit der Hand, vielleicht macht er auch ein Warnzeichen, fast sofort blickt er wieder am Stamm hoch. Und auf einmal.... Auf einmal, aber sozusagen im Schritttempo, trennt sich der Stamm vom Strunk. Die Tanne fliegt um. Nach einem Schwanken, das die Richtung des Umfallens schon ziemlich deutlich angezeigt hat, stürzt sie schräg durch die dämmerige Halle und macht dabei ein Geräusch wie ein Balken, der zu schwer belastet wird. Ein Riss oder Spalt bringt sie zu Fall. Über mehr als hundert Meter hinweg, so scheint es, kippt sie in die graue Stille hinein, verdunkelt den Himmel mit ihrem tiefschwarzen Nadelkleid, das sich aufplustert in einer Art, wie ich das noch nie gesehen habe, mit hochpeitschenden und aufwärts segelnden Ästen. Doch währenddessen rauscht das alles in die Tiefe, wird heruntergerissen mit grosser Wucht, und was oben zurückbleibt, ist nichts als eine hässliche Lücke. Das nächste, was ich wahrnehme, ist der Aufprall. Hart wie eine flache Hand schlägt der Stamm auf den Waldboden. Das Nadelkleid rauscht hinterher. Unter meinen Füssen spüre ich einen Ruck, dann ist es vorbei. Prima, sage ich und hebe den Daumen. Der Forstarbeiter nickt mir zu. Er ist zufrieden. Er stapft zur nächsten Tanne, nimmt sie in Augenschein. Sein dickes, harzgeflecktes Gesicht drückt eine grenzenlose Gelassenheit aus. Er klappt das Visier an seinem Schutzhelm herunter, um sich von neuem an die Arbeit zu machen. Als er die Motorsäge wieder anlässt, bin ich schon ein gutes Stück weiter. Es ist dunkel hier und muffig wie in einem fensterlosen Verschlag, Die Bäume lassen kaum noch Licht durch, die Luft riecht säuerlich, irgendwie abgestanden. Der mit Hächseln und Spänen gepolsterte Weg ist dunkel umschattet, nur in der Mitte ein Streifen Licht, der sich weit ins Dunkle hinein fortsetzt, eine schimmernde Spur, auf der man gehen kann. Doch dieser dichte, verfilzte, wie von Wandschirmen umschlossene Wald verwandelt sich nach und nach in einen Mischwald und öffnet sich auf allen Seiten, sodass man hier und dort einen verheissungsvollen Blick auf ein Stück offene Fläche erhaschen kann. Die aus Äckern und Wiesen bestehenden Aussenbereiche sind plötzlich wieder nah, und wie aus der Versenkung steigt ein freundliches Gelb, ein freundliches Grün aus dem Unterholz herauf und entfaltet sich an der frischen und freien Luft.
Und wieder mache ich eine kleine Wanderung. Die Luft ist frisch und klar. Die Sonne scheint. Ich eile den Hang hinter meinem Haus hinauf, um die Aussicht zu erkunden. Sie hat sich kaum verändert. Sie ist hübsch beleuchtet. Der Rhein ist alles andere als rein, er ist grün, mit einem öligen Schimmer, der Schwarzwald aber ist schwarz und der Blauen blau. Aus Millionen von Schornsteinen und Fabrikschloten schlängelt sich Rauch. Nordwestwind pappt die Wolken zusammen, formt sie zu einem knolligen Gebirge. Das Wetter ist durchzogen, launisch, der Wind fröstelt mich, während mich die Sonne zum Schwitzen bringt. Ich öffne den Reissverschluss meiner doppelt gefütterten Jacke bis zum Bauchnabel hinab. Die zusammengebündelten Wolken treiben nach Osten, Schatten huschen wie im Zeitraffer über Wälder und Wiesen hinweg. Alles ist in Bewegung. Ich bin hellwach, überwach.
Was ich einmal studieren möchte, ist die Gangart der Leute, das Gehen in all seinen Ausprägungen und Abwandlungen, und zwar das Gehen im Auto-Pilot, das Gehen an sich, wie es auf Wanderungen vollzogen wird.
Man kann dazu ein grobes Schema aufstellen, eine Grundtypologie:
Gehen kann
musikalisch (Frauen)
deklamatorisch (Männer)
oder mimisch sein. (Kinder, Hunde, alte Leute)
Da man morgens aufsteht und abends wieder zu Bett geht, geht man eigentlich immer im Kreis. Wir sind Manegenpferde.
Was man links und rechts zu sehen bekommt, ist ein Diorama mit wechselnden Effekten und putzig herumtanzenden Kasperlifiguren.
Ich denke manchmal, dass alle Richtungen illusorisch sind. Vielleicht fügt sich ja alles zu einem Kreis.
Kürzlich bin ich an zwei Schiessständen vorbeigekommen, und da ist mir aufgefallen, dass der innerste Kreis auf allen Scheiben schwarz ist. Der Haupttreffer geht also ins Schwarze. Klar, von daher kommt die Redewendung "Ins Schwarze treffen". Wenn jemand ins Schwarze trifft, sagt er das Richtige. Aber wieso ist die Mitte nicht weiss? Weiss, könnte man denken, wäre doch besser zu sehen. Oder ist es wegen der Kontrastwirkung umgekehrt? Triumphiert in der kontrastlichen Gegenüberstellung das Schwarz über das Weiss? Ist es das Dunkle, was den Blick anzieht und bündelt, während ihn das Helle eher abstösst, umlenkt und streut? Verhält sich das Auge wie das Licht? Wäre ein Thema für eine Doktorarbeit.
Wieder kommt die Sonne hervor. Dächer blitzen auf, massenhaft Bauernhöfe, einer hinter dem andern. Es gibt Bauernhäuser mit Anbau, solche ohne Anbau, moderne und altertümliche, verwahrloste und gepflegte, hässliche und schmucke, es gibt sie in allen Formen und Farben, in allen Stadien des Zerfalls und des wirtschaftlichen Wohlergehens. Über die ganze Landschaft sind sie verstreut, kaum ein Tal wird ausgelassen, auf keinem Fleck dieser zerstückelten Landschaft ist nicht irgendwo ein Bäuerchen tätig, das seinen Anrainern das Wasser abgräbt. So unterschiedlich die Bauernhöfe auch aussehen, den gemeinsamen Geruch können sie nicht auswischen. Hof bleibt Hof. Misthaufen bleibt Misthaufen, selbst wenn man ihn parfümiert. Das Hundegebell ist so ziemlich überall dasselbe, und fast überall gibt es Melchmaschinen, Gärten mit Traubenholunder, Mähdrescher unter Abdeckplanen, Futterbretter für Vögel, Schweinekoben, Schafhürden, Schuhgestelle mit Skiern und Stelleisen, winterschlafendes Vieh, Hühner, die glucksend im Dreck scharren. Aus Stuben und Nischen, Kellerstiegen und Tennen glotzen mich Tiere an.
Ich gehe in eine Wirtschaft, um mich aufzuwärmen. Kaum habe ich einen freien Platz gefunden, komme ich mit einem Handwerker ins Gespräch, der rauchend und Rivella trinkend seine Zehnuhrpause geniesst. Gespräch ist eigentlich der falsche Ausdruck, denn mein Anteil daran ist gering. Der Handwerker redet wie ein Wasserfall auf mich ein. Der Unterschied zwischen Zwetschgen und Pflaumen, sagt er, ist mir ein Rätsel. Kennst du ihn? Ich schüttle den Kopf. Der Handwerker beugt sich über den Tisch, sodass seine Nasenspitze fast mein Glas berührt. Er flüstert: ist es vielleicht so, dass der Unterschied gar nicht ins Gewicht fällt? Kann man ihn vernachlässigen? Ist es vielleicht so, dass der Unterschied zwischen Zwetschgen und Pflaumen nur ganz geringfügig ist? So geringfügig, dass man ihn aufheben könnte? Aber warum sagt man dann: ich esse eine Pflaume, wenn man eine Pflaume isst, von der man gar nicht sicher sein kann, ob sie eine Pflaume ist, und warum sagt man nicht: ich esse eine Pflaume, die vielleicht eine Zwetschge ist? Der Handwerker glotzt mich an. Er erwartet, dass ich sein Rätsel löse. Ich trinke hastig mein Glas leer. Ich weiss nicht, sage ich, ich habe keinen Hochschulabschluss. Ich bezahle und stehe auf. Meine Zehnuhrpause ist vorüber. Ich gehe hinaus an die frische Luft. Durch die Bäume zeigt sich eine Verfinsterung. Der Himmel ist grün und schwarz, seltsam gemischt. Ich spaziere ein Stückweit am Dorfbach entlang. Weiter unten im Tobel, wo der Bach breiter und ruhiger wird, finde ich eine andere Gastwirtschaft. Obwohl es mir ein wenig gegen den Strich geht, meine Wanderung weiter aufzuschieben, betrete ich den Schankraum und bestelle erneut ein Bier. Nachdem die Servierfrau das Bier vor mich hingestellt hat, schaltet sie hinter der Theke das Radio ein. Die Leute in der Gaststube horchen wie gebannt auf den Wetterbericht. Bei allem, was mit dem Wetter zu tun hat, macht sich auch unter Menschen, die ansonsten nicht viele gemeinsame Interessen haben, eine andachtsvolle Zusammengehörigkeit bemerkbar. Sie rücken näher zusammen, sie haben etwas, das sie vereint: die mit der Wetterentwicklung einhergehende Ungewissheit, die Mutmassung über das, was vom Himmel kommt. Wenn im Radio über das Wetter gesprochen wird, wird es still im Land. Alle hören hin. Alle haben die Hand am Frequenzknopf, halten den Atem an. Auch ich halte nun den Atem an, der Schwerpunkt in mir verschiebt sich von den Augen zum Gehör. Ich höre die Fliegen surren, das Gläserklirren im Spültrog wirkt auf einmal störend. Und da erfahren wir nun, dass die Schneegrenze sinkt. Ob das ein gutes Zeichen ist? Die Servierfrau streicht Butter auf ein Stück Brot, dann verschwindet sie. Wuselt irgendwo im Hintergrund. Öffnet eine Tür, kommt zurück mit einer dampfenden Teekanne. Ja, Tee wäre nicht schlecht. Ich springe ja bald wieder in die Kälte hinaus. Man muss sich vorwärmen in diesen Tagen, die Schneegrenze sinkt, Schneewolken staffeln sich in Reih und Glied, rücken unaufhaltsam näher, ein gedämpftes Licht flackert über die dunklen Wälder hinweg, und auf den Wiesen tobt der Wind wie ein verrückter Greis, der seine fettigen grauen Strähnen schüttelt. Die Tiere spüren es. Sie sind die ersten, die auf den Wetterwechsel reagieren. In einem Stall neben der Gaststube schnauben und scharren Pferde. Manchmal knallen Hufe gegen die Wand, wie eben jetzt wieder: es klingt, als würde jemand Holz spalten oder eine Pistole abfeuern. Nicht erschrecken! ruft die Servierfrau. Das sind bloss die Pferde! Das gibt sich wieder! Sind wetterfühlig, die armen Tiere... Die Pferde, mit Sicherheit die besseren „Wetterschmöcker““ als die Metereologen vom Radio, spüren also den Schnee. In einem jähen Ausbruch von Wetterfühligkeit malträtieren sie den Stall, aber schon haben sie sich wieder beruhigt und kehren zu ihrem gewohnten Stampfen, Schnaufen und Trappeln zurück. Solange das Radio läuft, sitzen wir, auf der anderen Seite dieser Wand, schweigend da, sieben Leute, wenn ich richtig gezählt habe. Nur einer von diesen sieben sieht so aus, als ob er von hier wäre, ein knorriger Bauer. Er sitzt verkehrtherum auf seinem Stuhl, raucht bedächtig einen Rössli-Stumpen. Über ihm, eine Handbreit unterhalb der Decke, sammelt sich der ganze Rauch wie in einer Luftblase. Hin und wieder nimmt er ein Fitzelchen Tabak aus dem Mund und zerreibt es zwischen seinen schwarzen Fingerkuppen. Er brummelt vor sich hin, starrt auf das Tischtuch. Wenn aber die Servierfrau für einen Moment in der Küche verschwindet und die Tür hinter sich angelehnt lässt, beugt er sich überraschend schnell nach vorn und späht über die Theke, um zu sehen, was dort vor sich geht. Die Küche interessiert ihn, er würde sich am liebsten durch den Türspalt zwängen und seine Nase in all die Töpfe und Pfannen stecken, in denen das Mittagessen brutzelt. Seine Nase trieft, aber das stört mich nicht. Schon eher stört mich das beharrliche Schweigen der Wandersleute, ihr stumpfsinniges Dasitzen und Abwarten. Dass es Wandersleute sind, sieht man an ihrer Aufmachung, den Pumphosen, den Knieschnallen, den Dächlimützen und den roten Socken, die natürlich nicht rot sind, aber ich stelle mir das so vor. Wenn ich einen Wanderer sehe, sehe ich ihn automatisch mit roten Socken, ich kann gar nicht anders. Freilich sind diese Leute ganz harmlos, und ich weiss eigentlich nicht, warum ich sie nicht mag. Sie stützen sich gähnend auf ihre Wanderstöcke, schauen in die Gläser, blicken verstohlen nach draussen. Vielleicht sind sie ja nur deswegen hier, weil sie sich nichts Bestimmtes vorgenommen haben. Viel Vernünftiges kann man ohnehin nicht tun. Der Tag ist ungewöhnlich finster. Der Himmel wie zugenagelt. Niemand denkt ernstlich daran, die Lampen abzuschalten, man lässt sie den ganzen Tag über brennen. Was will man noch draussen? Es zieht einen in die Stube und an den Tisch, in den warmen Lichtkegel, während sich die Landschaft in einem bedrohlichen Ausmass verändert, sich verdunkelt unter schneeschwarzem Gewölk. In der Stubenbeleuchtung wirken die Gesichter blass und aufgedunsen. Es macht mir nichts aus. Ich liebe Kunstlicht. Ich verputze heimlich ein Stück Schokolade, das ich in meiner Hosentasche gefunden habe, in jener, in der ich üblicherweise den Höhenmesser, das Sackmesser und den Pulsmesser aufbewahre, dann bestelle ich rasch einen Tee.
Entlang der Dorf-, Feld- und Waldstrassen sind jede Menge Warnschilder postiert, die uns schärfstens in die Pflicht nehmen, uns einschärfen, worauf wir als Verkehrsteilnehmer zu achten haben. Überall lauert Gefahr, droht Kollision und Absturz. Vorsicht Kühe. Vorsicht Baumschlag. Vorsicht Rehe. Vorsicht Schleudergefahr. Vorsicht Kurve. Vorsicht Bachgraben. Und nirgends auch nur der geringste Hinweis auf die wirkliche, die allergrösste Gefahr: das Auto.
Es mag lachhaft erscheinen: in dieser friedvollen Landschaft, in der das Verkehrsaufkommen so niedrig ist, dass man mitten auf den Strassen gefahrlos picknicken, ja ein Mittagsschläfchen halten könnte, wäre ich schon mehrmals fast unter ein Auto gekommen. Wahrscheinlich machen sie es absichtlich. Immer tauchen sie auf wie aus dem Nichts. Und immer brausen sie genau auf mich zu.
Es gibt Menschen, die überstehen jede Krankheit, jede Naturkatastrophe, sogar Kriege. Und dann werden sie von einem Trottinett umgefahren und sind tot.
In einer Grube, einer Art Backform, die aussieht, als wäre sie durch Spatenstiche entstanden, hat sich Wasser angesammelt, und das Wasser ist gefroren. Es bildet eine rissige, bräunliche, mit Luftbläschen und grün geschlängelten Nähten durchsetzte Form, auf die man treten kann, ohne dass es knackt. Wenn man das Auge nah genug an das Eis heranbringt, sieht man Steinchen, Gräser, auch Insekten, alles luftdicht eingeschlossen. Hier wird der Sommer konserviert.
Wie das Edelweiss und der Regenbogen wurde der Fliegenpilz aus seinem Naturzustand herausgerissen und für die bürgerliche Wohnstube präpariert.
Die romantische Symbolisierung hat ihn verkitscht, inflationär entwertet. Sein Bild ist erstarrt zu einer Nippesfigur, die nur noch für sich selber steht. Und deshalb fällt es schwer, ihn als etwas zu sehen, das nicht von Unwirklichkeit verschleiert ist.
Wenn dieser Pilz dann auch noch seinem eigenen Klischee ähnelt, es sozusagen auf dem Boden der biologischen Realität verwirklicht, so ergibt sich daraus ein Widerspruch, dem man nicht so leicht gerecht wird. Das jedenfalls war mein Gefühl, als ich letzthin einen echten Fliegenpilz gesehen habe.
Ich war verlegen. Was soll man da noch sagen? dachte ich. Der ist ja genauso, wie er sein sollte; bis in alle Einzelheiten ähnelt er dem naiven Phantasiebild, das ihn der realen Welt entfremdet. Und trotzdem ist er real. Ich wusste nicht, was ich rapportieren sollte. Fliegenpilz gesehen... Und weiter?
Die Realität übertraf das Klischee, sie karikierte sich selbst. Ich konnte nichts hinzutun, nichts wegnehmen. Der Pilz hatte sich zur Perfektion gebracht. Er versinnbildlichte sein ganzes Wesen, drang aber nicht bis zu jener Bedeutsamkeit vor, die ich aufgrund seines Rufs von ihm erwartet hätte. Er war lediglich kitschig, eine Bestätigung seiner selbst, makellos, eine kinderstubenhafte Preziosität, wie aus Plastik und hübsch gepunktet.
Es hätte mich nicht gewundert, wenn er auch noch eine hübsche Spieldosen-Musik heruntergeklimpert hätte. Die Tatsache, dass er physisch anwesend sein konnte wie eine hundsgewöhnliche Primel oder Rossnelke, empfand ich beinahe als beleidigend. (Wer jemals ein ausgestopftes Einhorn gesehen hat, wird das nachempfinden können. Nichts schadet dem Zauber mehr als seine Verdinglichung). Und je länger ich den Pilz anschaute, je mehr Photos ich von ihm schoss, desto unbehaglicher fühlte ich mich.
Was, wenn mir jemand nachspioniert hatte? War ich wirklich alleine? Ein derart symbolträchtiges Kleinod zu finden, ist ein Glück, das man ungern teilt. Wie immer in solchen Fällen ist dem Glück auch ein wenig Unglück beigemischt. Der Finder sieht sich alsbald gezwungen, seinen Schatz zu verteidigen. Wozu ihm fast jedes Mittel recht ist. Er wird die Fundstelle geheimhalten. Er wird sie mit Blättern und Ästen zudecken - oder sie, falls sie am Wegrand und vor aller Augen liegt, mit einer durchgeladenen Flinte eifersüchtig bewachen.
Der Fliegenpilz ist nicht irgendein Pilz. Er ist nicht nur als biologische Rarität geschützt. Man muss ihn unter das Kriterium des Geheiligten stellen, ihn als Reliquie behandeln. Noch immer, unverändert seit Kreidolf und den Gebrüdern Grimm, verkörpert er das raunende, zirpende, grummelnde, brummelnde Märchenorakel.
Märchen stehen zu Unrecht in der Verkleinerungsform. Sie markieren eine Schattengrenze, weisen hinab in die bewaldeten Täler unseres Ichs, in die gotischen Krypten des Humors, der Phantasie und des Wahnsinns.
Die Hexe verbrennt im Ofen, dem Wolf wird der Bauch aufgeschnitten, und der Menschenfresser frisst Menschen. Und nun schlaf schön, liebes Kind.
Die volkstümlichen Anspielungen und Anklänge gehen weit über das putzige Äussere hinaus, sie berühren die Geschichte und bezeugen den Gebrauch, den die Menschen seit jeher von diesem Pilz gemacht haben. Man schreibt ihm Zeichen und Wunder zu. Der Grund dafür liegt wohl zur Hauptsache in seiner inneren Chemie. Die weissen Streusel sind nicht aus Zucker, die süssen Kontrastfarben sind keine Glasur.
Allen Verharmlosungen zum Trotz: essen sollte man ihn nicht. Auch nicht versuchsweise. Aber immerhin, und das wollen wir ihm zugute halten, bis zu einem gewissen Grad ist er durchaus geniessbar. Plötzlich sind sie wieder im Umlauf, die stockfleckigen Rezepturen aus Ururgrossmutters Mixturenbuch. Indem man die empfindliche, giftschwitzende, weissgepunktete Kopfhaut abschält, sie wie eine Wursthaut abzieht in einem Stück, kommt man an das Toxikum heran, das Tröpfchen, das in keinem Hexengebräu fehlen darf, den teuflischen Messwein.
Dessen Wirkung könnte man anschaulich machen, indem man eine steil ansteigende Glückshyperbel zeichnet, die hinten einen absteigenden Ast hat. Wenn es stimmt, dass manche Tiere die rotweisse Warnung missachten, um sich zu berauschen, so möchte ich meinen, dass der Mensch sich diesbezüglich schon vor Jahrtausenden an den Tieren orientiert hat. Schon seit Urzeiten essen oder rauchen die Menschen toxische Pilze. Auch die Menschen missachten die Warnung, auch sie haben das Bedürfnis, aus dem starren Wandrelief der Normalität herauszutreten und in den Wäldern zu tanzen.
Ein Fuchs. Fast ein wenig lässig, graziös, kokett, mit der Andeutung eines Ausscherens, einer Drehung, eines seitlichen Wegtauchens, trottet er - schakalhaft geduckt - an mir vorüber und verschwindet in einem Tannenwäldchen. Kein freilebendes Säugetier (ausgenommen vielleicht das Eichhörnchen) sieht man so häufig wie ihn, keines nimmt sich soviel heraus. Er ist allgegenwärtig wie eh und je. Eine Mischung aus Katze und Hund.
Die typische Gangart des Fuchses nennt man „Schnüren“. Aber anstatt einfach ein Wort einzusetzen, das summarisch etwas auf den Punkt bringt, ziehe ich es vor, zu beschreiben, was ich sehe. Auch wenn dies vielleicht etwas umständlich ist. Man kann den Punkt auch einkreisen. Ein stilistisches Prinzip. Mit einer Beschreibung verkompliziert man etwas Einfaches, zeigt es vielgestaltig und detailliert, damit der Leser oder Zuhörer daran hängen bleibt. Aber daneben hat die Beschreibung einen noch viel näherliegenden Sinn. Es gibt zwei Formen, etwas mitzuteilen: die Aussage (Er steht auf) und die Beschreibung (Er erhebt sich mühsam, gähnend). Die Beschreibung gibt ein Bild, das für sich selber steht, die Aufmerksamkeit bündelt, dagegen die Aussage: sie gibt eine Überleitung, sie peilt etwas an, ist ergänzungsbedürftig. (Er steht auf, und dann... Oder: Er steht auf, weil...) Wenn ich also sage „Der Fuchs schnürt“, so muss ich, um die Aussage nicht zu entwerten, das Schnüren auf etwas ausrichten, das mit der Erwähnung des Schnürens noch nicht gesagt ist. Man sieht, die Sprache macht es einem nicht leicht. Es ist selten damit getan, einfach nur das richtige Wort zu finden.
Die nicht unbeträchtliche Fresslust der Kühe wird gemindert durch die Kürze des Grases.
Unterschied zwischen Zeit und Zeitigkeit: während die Zeit (Tick-tack Tick-tack) in regelmässigen Intervallen fortschreitet, manchmal schneller, manchmal langsamer, aber ohne Sinn für eine Steigerung des Zustands, der Qualität, ohne die Befähigung zur Materialisation, markiert die Zeitigkeit den Punkt, wo die Zeit sich mit einem Wesen, einem Zustand, einer Besonderheit vereinigt und als inhaltlich und örtlich determiniert erscheint: vergleichbar vielleicht dem Punkt, wo das Wasser gefriert, also umschlägt in Festigkeit. Wenn etwas zeitig ist, ist es fällig, reif, zeitigt es Wirkung, ist es sichtbar und greifbar. Es kann nicht mehr verschoben werden, die Entwicklung hat einen unwiederholbaren Punkt erreicht. Für solche Zustände muss man das Auge schärfen.
Obwohl noch keine einzige Schneeflocke gefallen ist, liegt ein merkwürdiges Glänzen in der Luft, der flirrende Widerschein einer immateriellen Schneemasse.
Woran erinnert man sich, wenn man wieder zu Hause ist? Was bleibt einem? Die Bilder im Gedächtnis sind merkwürdig kraftlos und blass, es sind undeutliche, sich langsam auflösende Photographien, die man nach Gutdünken nachkoloriert, um sie irgendwie zu erhalten. Die meisten verschwinden dann trotzdem, werden gelöscht. Was aber bleibt, ist der Eindruck einer unbestimmbaren Weite. Einer Weite, die auch die Möglichkeit von etwas ganz Anderem einschliesst. Man erinnert sich auch an die Wege, die man nicht gegangen ist, an die Tiere, die man nicht gesehen hat, und an die Ortschaften, um die man weiträumig herummarschiert ist. So funktioniert das Gedächtnis.
Durch den kahlen Wald torkelt ein Lichtfleck.
Reisen lähmt mich. Wenn ich reise, muss ich den Kopf ausschalten. Paris, London, die Provence, Süditalien: wie durch ein Loch ist das alles aus meinem Gedächtnis abgeflossen. Bleibende Eindrücke? Nichts. Auf einer Reise klappert man die Dinge ab, ohne sie zu sehen, wechselt Orte und Stimmungen, ohne irgendetwas mitzubekommen. Es geht alles zu schnell, und das Quantum des Neuen, das man sieht und erlebt, stimmt in keiner Weise mit dem Quantum überein, das man fassen und verarbeiten kann. Reisen ist eine Illusion, ein mechanisches Verschieben des Körpers. Deshalb dieses ständige Photographieren, dieses Nachprüfen, ob man wirklich da ist, wo man sich zu befinden glaubt. (Fussreisen sind freilich etwas anderes. Wenn man über eine längere Strecke hinweg zu Fuss unterwegs ist, reist immer alles mit, und man bleibt mit der Welt im Gleichschritt).
Nur unter einer einzigen Voraussetzung ist Reisen sinnvoll, dann nämlich, wenn man die Reise dorthin unternimmt, wo man geistig schon angekommen ist. Eine innere Notwendigkeit treibt manche Menschen dazu, den Ort zu suchen, den einmaligen Ort, wo sie ihrem ganzen Wesen nach hingehören. Den Ort ihrer Bestimmung. Reisen ist entweder gar nichts oder ein innerer Zwang.
Beispiele: Goethe in Italien, Kolumbus in Amerika, Van Gogh in der Provence, Livingston in Afrika, Odysseus auf dem Weg nach Ithaka.
Tiefschwarz und rot, knollig und wollig, glatt und gestielt, matt und glänzend, verschrumpelt und straff, regenfleckig und poliert, gefällig und plump, auf jedwede Art gestaffelt und miteinander verbunden: so heben sich die Beeren vor dem grünen, sie fleischig umschlingenden Blätterwerk ab. Aus dem wuchernden Gestrüpp eines verborgenen Schlaraffenlands springen sie plötzlich in den trüben Herbst hinein. Was wollen sie? Woher diese Plötzlichkeit? Sind sie sich selbst nicht genug? Wollen sie, dass uns das Wasser im Mund zusammenläuft? Zum Anschauen sind sie in jedem Fall, es wäre auch schwierig, sie nicht anzuschauen. Neben ihnen mutet vieles dürftig an, vieles, das für sich genommen durchaus sehenswert wäre, unterliegt der schieren Überzahl. Auch die Zahl ist lebensvoll, nicht nur das Aussehen. Die Mischrechnung aus Häufigkeit und Häufung garantiert den Erfolg. Die Beeren haben es heraus. Sie wissen, wie man sich ausstreut, wie man sich verschenkt und verschwendet. Sie kennen das Geheimnis der Vervielfachung. Das Einzelne gewinnt an Überzeugungskraft, sobald es sich zahlenmässig hochschaukelt, potenziert. Und genau das passiert hier. Die Beerenzahl schlägt exponentiell nach oben aus. Von den Beeren wird man überragelt, überschüttet, in fetten Trauben hängen sie an den gebogenen Ästen und versperren den Fliegen, Bienen und Hummeln die Flugbahn. Auf den Dolden herrscht ein erwartungsfrohes Gedränge, Gleich gesellt sich zu Gleich – und zwar in solcher Anzahl, dass die Beeren gezwungen sind, zusammenzurücken. Sie machen sich klein, um in dieser Kleinheit desto üppiger aufzutrumpfen. Beeren gibt es im Überfluss. Selbst in den widrigsten Ecken, wo niemand hinschaut, niemand herumfingert und die dornigen Wedel wegschiebt, drängeln sie sich keck und umstandslos nach vorn. In einer Sprache, die wahrscheinlich so ziemlich die geläufigste ist, verkünden sie, dass sie zur grösstmöglichen Verbreitung bestimmt sind. Hängenbleiben (Gehängtbleiben) kommt für sie nicht in Frage. Sie müssen sich abstossen, sich hinabwerfen in den Zufallsschlund. Das ist denn auch ihr Kerngeschäft, - das schmackhafte Fleisch als Entgelt für die Arbeit des Auskernens und Aussäens. Jede Beere sichert sich ihren Anteil, überantwortet sich ihrem Schicksal. Die eine lässt sich fressen, die andere rollt in ein Stilleben hinein. Still sind sie indessen nicht. Allen ist gemeinsam, dass sie begierig darauf sind, aufzufallen, aus der Masse zu fallen. Sie schreien: ich, ich, ich. Das ist ein Chor, in dem die einzelne Stimme untergeht. Die einzelne Beere, ein Winzling, ein Staubkorn im Weltall, wäre nichts, hätte sie nicht den Gesamtchor im Rücken. Wollte sie sich unabhängig von den andern zur Geltung bringen, so würde ihr Stimmchen (ein Gequäke) ungehört verhallen. Um präsent zu sein, müssen sich die Beeren zusammentun. Sie schliessen ein Zweckbündnis. Nur als Masse bewirken sie etwas, nur als Masse mischen sie mit und erreichen sie ihr weit- und hochgestecktes Ziel. Dicht und verschwenderisch sind Böschungen und Waldränder mit ihnen bepackt, kübelweise reichen sie sich dar, reichen sich einem zu, Beeren in Hülle und Fülle, die wissen, dass ihre Zeit gekommen ist. Sie stechen aus jedem Gesträuch heraus. Sie schreien: ich, ich, ich. Bald wird der Zufall seine Auswahl treffen, seine Arbeit verrichten. Ich, ich, ich. Die vielen Ichs rufen ein Wir herauf, das in seiner Gesamtmasse aufquillt wie ein Kuchen. In diesem Kuchen picken nun die Vögel herum, was unvermeidlich eine Abnahme der Beerenzahl zur Folge hat. Aber so läuft nun mal das Geschäft. So ist die Abmachung. Die Vögel sind gierig auf die Beeren, und die Beeren sind gierig darauf, verschlungen zu werden. Die Beeren verschwinden also im Zufallsschlund, sie werden davongetragen, gegessen und verdaut. Das Erbgut aber verschwindet nicht. Unbeschädigt wird es herausgeschissen.
Hochspannungsmasten. Unter den weit geschwungenen Drähten steht man sekundenlang in der Gefahr, unter die Macht eines neuronalen Gewitters zu geraten.
Die Landschaft. Von oben und unten zusammengepresst wie ein Cinematoscope-Film. Eine beklemmende Weite, „so weit das Auge reicht“.
Die Rohheit des Holzes ist immer wieder erstaunlich. Im Winter schält sie sich quasi heraus, wird plastisch.
Die interessantesten Tiere sind – ja, die Kühe. Wie die Spatzen nimmt man sie schon fast nicht mehr wahr. Man hält sie für langweilig, zumindest sind sie nichts, womit man sich länger aufhalten möchte. Es sind ja „nur“ Kühe. Aber wenn ich eine Stunde damit verbringen würde, eine Kuhherde zu beobachten, könnte ich ohne weiteres genügend Material zusammenbringen, um daraus einen Roman zu bauen.
Ich behalte meine Zeitungen auf – nicht um sie in die Papiersammlung zu geben, sondern um sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder hervorzunehmen und zu lesen. Ich halte mich gerne auf dem laufenden, auch was die Vergangenheit angeht. Ein ähnliches Bedürfnis bringt mich dazu, immer wieder hinauszugehen in eine Landschaft, die absolut nicht neu ist.
Abend wird es niemals zufällig. Jemand treibt da seine Schäfchen zusammen.
Natur ist das, was keinen rechten Winkel hat. Natur ist das Gegenteil von Donald Judd. Deshalb liebe ich die Natur. Ich hatte in der Sekundarschule Werkunterricht, wo man uns eingetrichtert hat, dass ein Schrank oder ein Kästchen so zusammengebaut sein muss, dass die Wände zum Boden im rechten Winkel stehen. Das hat mich immer geärgert. Warum sind Möbel nicht so, wie das Holz gewachsen ist? Kein Baum wächst gerade, - es wäre übrigens für den Baum auch schwierig herauszufinden, wo die Horizontale liegt. Es scheint, als hätte der liebe Gott aufs Winkelmass verzichtet, um alles ein bisschen vielgestaltiger und flexibler zu machen. Keine einzige Wiederholung, keinerlei Stereotypien. Ich lasse mich hier schon weit auf die Äste meines Naturverständnisses hinaus, denn zweifellos könnte man mir das Gegenteil beweisen und Beispiele anführen, die zeigen, dass die Natur auch einen Sinn für mathematische Ordnung hat. Die naturgegebene Ordnung will ich auch gar nicht leugnen. Ich gebe lediglich einen Gesamteindruck wieder. Paul Valéry hat gesagt: es gibt keine Natur. In gewisser Weise stimmt das ja schon, die Natur ist ein Konstrukt. Und in gewisser Weise stimmt es auch nicht. Der gesunde Menschenverstand sagt uns klipp und klar, dass die Natur sich graduell, wenn auch nicht der Sache nach, von dem unterscheidet, was wir aus ihr machen. Wenn man in einen Ameisenhaufen hineinhockt, merkt man sehr schnell, dass das etwas anderes ist als ein Stuhl. Also muss die Natur doch irgendwie real sein. Sie ist etwas anderes, sie ist eben Natur. Von der anderen Seite her betrachtet, von der Stuhl-Seite her, findet man die Natur auch in einem Stuhl, weil er aus Naturstoffen besteht, aus Holz beispielsweise. In unterschiedlichen Graden der Bearbeitung und der Manipulation ist alles Menschengeschaffene natürlich. Umgekehrt ist das Natürliche, sofern wir es unserem Rezeptionsapparat einverleiben, ein Bestandteil unserer kulturellen Welt. Natur und Kultur sind also ein und dasselbe und lassen sich nur graduell voneinander unterscheiden. Das deckt sich übrigens mit der Naturauffassung der Romantik. Es war der Philosoph Schelling, der Natur und Geist in ein einheitliches und absolut plausibles Konzept gebracht hat. Bei ihm ist die Natur keine Sache, kein objektivierbares Gegenüber wie bei Descartes, sondern ein Prozess des Werdens und der Vergeistigung, in den der Mensch eingebunden ist. Auch das Auge ist Natur, auch das Denkvermögen. Der Mensch ist also sozusagen das Auge der Natur, mit dem die Natur sich selber betrachtet und reflektiert. Wir sind ein Organ der Selbsteinsicht der Natur. Für mich ist diese Annahme ganz grundlegend: wenn die Natur sich selber betrachtet, so liegt das in ihrer Absicht. Dahinter steht also eine naturbedingte Absicht. Die Trennlinie zwischen Geist und Natur, die sich definieren lässt, wie man will, der Spielraum ist riesig, entspricht einem Auftrag, nicht einer fixen Barriere. Es wäre genauso blödsinnig, diese Trennlinie abzuschaffen, wie es blödsinnig wäre, sie absolut zu setzen. Sie ist Teil des Prozesses, an dem wir teilhaben, und gerade als Künstler kann ich sehr viel zu diesem Prozess beitragen. Beim Künstler, betrachtet man ihn als soziales Subjekt, ist ja auch nie so klar, wo der Geist und wo die Natur steckt. Er ist derjenige, der die Kultur behütet und vorantreibt, einer ihrer Repräsentanten, aber er ist auch derjenige, der sich einem dubiosen Instinkt überlässt und die schönen Verschanzungen der Kultur niederreisst, indem er genau dorthin zielt, wo wir den animalischen „Knieschlotteri“ haben. In jedem Künstler steckt ein Dädalus, aber auch ein Rübezahl. Jeder Künstler ist ein Gestalter, ein Lichtbringer und Kulturmensch, aber auch ein Monster, ein Berseker, ein Asozialer. Selbstredend sympathisieren die meisten Künstler heute mit Dädalus, sie wollen ingeniös sein und rational, sie füttern sich mit Medientheorien und Foucault, und an den Hochschulen wird auch das entsprechende Identifikationsmuster vermittelt. Dagegen ist ja gar nichts einzuwenden. Rationales Denken hat noch niemandem geschadet. Es ist wie Masern, man muss es einmal gehabt haben. Aber mit der Natur ist es halt so eine Sache: wenn man sie von der eigenen Natur abkoppelt und nur als Gegenüber zu fassen versucht, bleibt man von ihr isoliert und unterschätzt die Wirklichkeit, aus der heraus wir leben. „Das schmale Gelenk meiner Hand spottet aller Technik.“ sagte Whitman. Da die Natur ein Geschehen ist, das uns voll miteinbezieht, uns einen Spiegel vorhält und geistig herausfordert, lebt man in einer Art Verblendung, wenn man seinen dürftigen Geist nicht einbindet in das Ganze, das ihn umgreift. Was ist das Ganze? Es ist die Natur. Sie ist mit uns identisch - und doch ist sie grösser als wir. Mit einem gleichgültigen Schulterzucken könnte sie uns von der Erdoberfläche wischen. Was ist schon ein Vulkanausbruch? Ein Tsunami? Was wir als menschenfeindliche Katastrophe auffassen, ist für die Natur bloss ein Niesen oder Husten – etwas völlig Normales, etwas Nebensächliches. Naturkatastrophen ereignen sich auch im Kleinen. Ein simpler Schnupfen kann den präzisesten Verstand lahmlegen. Mit einer verstopften Stirnhöhle kann man weder schreiben noch rechnen, und mit Fieber ist man bereits auf dem Niveau einer geistigen Erkrankung angelangt. Alles Denken, Fühlen, Meinen und Wollen beruht auf körperlichen Vorgängen, auf Biologie und Chemie. Drückt mich der Schuh, kann mein ganzes Weltbild wackeln. Bei Kälte und Schnee fällt meine Laune in den Keller. Der Körper ist immerzu gefährdet, ein Schauplatz unzähliger Naturkatastrophen, ein Schlachtfeld, und der menschliche Geist, auf den wir uns so viel einbilden, ist eigentlich nur das, was wir diesen Katastrophen abtrotzen. Ein kleine Darmstörung - und der Geist ist buchstäblich im Arsch. Auf Gedeih und Verderb sind wir der Natur ausgeliefert, auch der eigenen. Die Natur enthält uns. Sie ist die grosse Meta-Erzählung, in der wir auftreten als Protagonisten. Wir können diese Erzählung zu lesen versuchen, aber da wir selbst in ihr vorkommen, gelingt uns das nur stückweise. Würden wir die Natur vollumfänglich verstehen, wäre das ungefähr so, als würde Shakespeares Hamlet Shakespeares Hamlet lesen und auf einmal kapieren, dass er nur eine fiktive Figur ist. So etwas geht einfach nicht. Und trotzdem ist es unsere Bestimmung, im “Buch der Natur” nach den grossen und schlüssigen Erklärungen zu suchen.
Der Wald birgt Fremdartiges. Pilze, überall Pilze. Überall wuchern sie empor und verbreiten ihren bräunlichen Moder, ihre schleimigen Absonderungen. Pilze demonstrieren Mannigfaltigkeit und Monotonie. Sie sind eklig und schön, immer etwas angefault, aber für das Auge durchaus geniessbar. Sie scheinen die letzten Abkömmlinge einer blinden und primitiven Lebensform zu sein, die auf diesem Planeten vor Urzeiten alles überwuchert hat, lange bevor auch nur ein einziges grünes Pflänzchen ins Licht gewachsen ist. Pilze sind blind und ohne jedes Verständnis für den Himmel, dem sie insofern Dank schulden, als er sie mit Tau und Regen benetzt. So sehr sie die Feuchtigkeit schätzen, so wenig machen sie sich aus Licht. Sie ducken sich im Schatten und kehren den Öffnungen des Waldes den Rücken zu. Und so schnell sie auch aus der Erde schiessen: hoch hinaus wollen sie nicht. Sie sind keine Fenstergucker. Sie lieben das Dunkle, das Feuchte, das an der Grenze zur Fäulnis Schwärende, sie sind die feuchtkalten Metastasen der Erde. Was sie mit ihren langen Tentakeln aus dem Boden herausholen, schlingen sie auf Vorrat. Eigentlich sind sie aus Fleisch, Hohltiere mit einem rhythmisch hochschnellenden kleinen Puls hinter der halbdurchsichtigen Aussenhülle. An Pflanzen erinnern sie nur entfernt. Die Aussenhülle bildet oft einen Grauschleier, eine halbtransparente Kapuze, die das Innere verbirgt, ohne es unsichtbar zu machen. Oft kleiden sie sich in Tarnfarben. In den gut durchforsteten Buchenwäldern sind sie allerdings kaum zu übersehen. Sie sind überall: vor allem dort, wo es sonst am wenigsten zu sehen gibt, auf dem kahlen Boden, im Dreck zwischen halb abgestorbenen Wurzeln, treten sie in gut organisierten Scharen auf, in Trupps, in geschlossenen Haufen und offenen Kreisen. Bemützt und bezipfelt, gebogen und stämmig, glockig und dickhäuptig, keulen- und beulenförmig, manchmal auch winzig und wimmelnd. Ihre Erscheinungsform ist ausgesprochen erdgebunden, oder wie soll ich sagen: zwergisch? Sie leben auf kleinem Fuss, dicht bei dicht, und sehen einander so ähnlich, dass es den Eindruck macht, als hätte einer dieser Winzlinge, der Erstgeborene vielleicht, sich endlos und ohne Variante reproduziert. Warum treten sie in Gruppen auf, in der Vervielfachung? Es liegt am Wald, mit dem sie ja in engster Verbindung stehen. Im Herbst macht der Wald eine grosse Veränderung durch. Er gibt seine Regentschaft ab und entfernt sich. Viele seiner Gewohnheiten schlafen ein. Der Lebensrhythmus bricht ab. Vielleicht vermehren sich die Pilze nur deshalb so fleissig, um der Leere zu trotzen, die sich ringsum auftut, wenn die Blätter fallen und der Lebensbetrieb erlahmt. Die Pilze sind das, was übrigbleibt, wenn alles andere geht. Die Punkte hinter dem abgebrochenen Satz, die Andeutung einer Fortsetzung, die eigentlich ein Ende ist. So kommentieren sie den langanhaltenden Abschied, dem sie früher oder später nur noch das eigene Sterben hinzuzufügen haben. Dann ist alles gesagt, und es kann Winter werden. Das weisse Rauschen kann beginnen. Bevor es aber beginnt, bekommt man die Abwesenheit des Waldes und das Aussetzen jeglichen Lebens auf jedem Waldspaziergang deutlich zu spüren. An dieser Zeit- und Raumschwelle sind die Pilze postiert als Wächter, postiert im Nirgendwo, in der Ödnis zwischen den kahlen Bäumen. Sie bewachen den Tod, ihren wichtigsten Nahrungsspender. Doch die Fäulnis in diesen Pilzen ist Täuschung und Verzögerung. Man könnte sagen: sie sind zu faul zum Sterben. Es geht sehr lange, bis sie völlig verschwunden sind. Im Zwielicht des sinkenden Jahres harren sie aus. Tag für Tag und Nacht für Nacht. Eine starre Gehorsamsregel bindet sie an den Wald, und der Wald stirbt ihnen weg. Sie frieren und verholzen. Oder sie werden weich und kehren, indem sie sich schmatzend umstülpen, in die Erde zurück.
Der Winter ist die unangenehmste Jahreszeit. Das Leben ist ausgelöscht, eine Banalität. Man darf sich nicht einmal darüber beklagen, es kommt ja wieder. Aber einstweilen ist da dieser Schnee, der nicht aufhören will vom Himmel zu rieseln. Er deckt alles zu. Er ist farb- und geruchlos, hat kaum Eigenschaften, obwohl man sich gerne einbildet, „es rieche nach Schnee“. Vonwegen, Schnee riecht nicht, und auch sonst ist er fast eigenschaftslos, ein Unding. Flocken, die durch die Luft schweben, auf dem Boden aufsetzen und sich langsam aneinanderfügen, machen kein Geräusch. Schneien hat etwas Geisterhaftes, etwas Hypnotisches, langsam Einlullendes, und wie gesagt: Schnee hat keine Farbe. Farblich ist er neutral. Schnee ist überhaupt schwer in eine Definition zu bringen. Jedesmal, wenn man ihn in die Hand nimmt und zusammenquetscht, scheint er sich anzufühlen wie etwas, das man noch nie in der Hand gehabt hat. Bei jeder Temperaturschwankung ändert sich seine Beschaffenheit. Nie ist er so, wie er eben noch war. Was soll man darüber schreiben? Noch weiss ich nicht, welche Aufgaben mir im Winter zufallen werden. Was kann man im Winter entdecken? Der Winter ist die tote Jahreszeit, sagt man, das Grab der Natur. Ich kann das nur bestätigen. Die Natur schweigt und verbirgt sich. Das Leben ist von innen verriegelt. Was man da allenfalls entdecken könnte, erscheint vereinfacht bis hart an die Grenze des Stumpfsinns: kahle Bäume im Schnee, Fällholz, ein wenig Tannengrün. Auf einmal wird das Menschliche wieder interessant.
In der keuschen Schneelandschaft steigt schwarzer Rauch auf. Ein Bauer hat ein Feuer entfacht, in das er Obstkisten und zersägte Dachsparren hineinwirft. Ein Hund steht daneben und frisst Schnee.
Das Spannendste am Telefonieren ist das Knacken in der Leitung. In einem ähnlichen Sinne könnte man den Winter spannend finden: da knackt es manchmal überall.
Auf den Waldkuppen sitzt Rauhreif. Die Luft ist spürbar gereinigt. Man atmet anders, intensiver. Jede noch so schmale Oberfläche ist mit einer Unzahl funkelnder Kristallnadeln bedeckt. Doch sobald die Schatten schrumpfen und man im Aufstieg aus der sinkenden Morgenkälte herauskommt, wird es anders. Die Sonne hat Kraft, und die nasskalte Pracht gibt nach. Sie zerscherbelt und zerrieselt. An manchen Stellen wird sie pappig und matschig, und wie ein missglückter Gewehrschuss patscht da und dort ein kompaktes Stück Nässe auf den Boden. Was soeben noch starr und fest war, flutscht nun weich herunter oder prasselt einem auf den Kopf. Die brüchige Inkrustation löst sich ab, wie es sich aus Windstärke und Sonneneinstrahlung ergibt. Etwas Geschäftiges zieht in den Wald ein. Das Licht wird heller. Es sticht in die Augen, geht unter die Haut. Während ich durch den auftauenden Wald stapfe, umgibt mich eine seltsame Mischung aus Stille und Lärm. Ein vervielfachtes Triolengetröpfel erfüllt den Wald.
Ich vergesse die Zeit. Ich werde unaufmerksam, trödle vor mich hin. Und auf einmal merke ich, dass sich etwas Entscheidendes geändert hat. Noch ganz im Zauber des Vormittags gefangen, habe ich diesen Moment verpasst. Auf ihrer tiefstehenden Bahn rollt die Sonne langsam nach Westen. Sie hat sich zurückgenommen, sie hat noch andere Verpflichtungen. Und auf einmal ist sie weg. Sie ist hinabgerollt auf die andere Seite. Wenn man jetzt aufblickt, sieht man nur noch Leere. Nichts unterscheidet den sonnenlosen Himmel von einem schäbigen Fussläufer. Licht und Schatten verweben sich zu einem dumpfen Grau, und die Landschaft verwandelt sich in ein Tiefkühlhaus. Da friert alles wieder ein, kaum ist es aufgetaut. Die Dezembertage sind kurz, mickrig fast. Drunten in den Ortschaften gehen schon die Fünfuhr-Lichter an, die Strassenlampen und Signallampen, und ringsum auf den Höfen brummen Generatoren, die lebenserhaltenden Maschinen nehmen ihren Betrieb auf, die Herzschrittmacher der Zivilisation.
Ein zugefrorener Teich. Bäume, die ihre Äste ins Wasser hängen lassen, stecken jetzt fest. Sie sind doppelt festgehalten. Es sieht aus, als ob sie an beiden Enden Wurzeln hätten.
Im schneebestäubten, schrundigen Eis sieht man uhrglasartige Einschlüsse, kleine Gucklöcher. Das Wasser darunter ist schwarz. Durch den Eispanzer dringt kaum Licht.
Ich betrachte den Teich vom Ufer aus. Das Eis wäre zwar dick genug, dass es mich tragen würde, aber wer kann mir garantieren, dass ich nicht ausrutsche?
Auf Baumstrünken und Steinen finden sich aufgesprayte Zeichen. Da gibt es Symbole, geometrische Formen, Zahlen, Buchstaben oder einfach nur Einfärbungen. Es sind Markierungen, die grell gegen den Schnee abstechen. In leuchtenden Farben sprechen sie die verklausulierte Sprache des Machens und des Habens. Man sieht: hier hat jemand seine Hand draufgelegt.
Ein Marder rennt auf mich zu, blitzschnell macht er kehrt. Ich sehe noch seinen Staubwedel im Gebüsch verschwinden.
Unter der Schneedecke: ein Schnarchen.
Schnee riecht nach nichts und hat auch keine Farbe. Es mangelt ihm an Originalität. Er ist langweilig. Seine Frische ist ungesund. Was man ihm allenfalls zugute halten könnte, ist seine Formbarkeit. Seine Konsistenz liegt im Bereich des Körperlichen, des Schmierigen, Eisigen, Bröckeligen, irgendwo zwischen Stein, Seife, Wachs, Sand und Birchermüesli. Aus Schnee kann man regelrechte Kunstwerke machen, sogar Häuser bauen. Doch was man da kneten, rollen und häufen kann, ist nur Wasser. Aufgeblasenes Wasser. Früher oder später geht die ganze Pracht den Bach runter. Sie verschwindet wie eine Fata Morgana. Und das ist gut so. Schnee beansprucht viel zuviel Platz, und auch sonst bringt er nur Nachteile. Seine Farblosigkeit verdirbt die Augen, seine Kälte verursacht Erkältungen und Frostbeulen, seine Härte wie auch seine Weichheit erhöhen die Unfallgefahr. Ist er weich, sinkt man ein, ist er hart, fällt man hin. Abschüssige Wege verwandelt er in Rutsch- und Bobbahnen, Feldwege sind nach einem ausgiebigen Schneefall wie ausradiert. Hat man die Schneedecke festgestampft, lässt sie sich kaum noch wegschaufeln. Schaufelt man sie weg, fällt sofort neuer Schnee. Weigert man sich, ihn jeden Tag aufs neue wegzuschaufeln, türmt er sich höher und höher. Regen fliesst ab, Schnee bleibt liegen. Regen ist emsig und beweglich, Schnee ist plump und bequem. Regen gurgelt, Schnee schweigt. Regen bewässert den Boden, Schnee versiegelt ihn. Regen wäscht den Schmutz ab, Schnee verwandelt die Welt in ein leeres Blatt Papier. Er macht die Vielfalt des Bestehenden rückgängig, löscht sie aus. Es ist unmöglich, Schnee zu bejahen. Sieht man ihn so, wie er ist, mit all seinen Konsequenzen, so muss man ihn verfluchen. Schnee ist eigentlich für überhaupt nichts gut, im Gegenteil, er ist der reinste Ballast. Auf seine passive Art richtet er nur Schaden an: ein bombastisches Trugbild aus Wasser und Kälte, auf das man ebensogut verzichten könnte. Die Autofahrer haben es da vergleichsweise gut, sie haben Schneeketten und Winterpneus, sie sind gerüstet und abgeschirmt. Im geheizten Wagen kann es schön warm sein, man geniesst dort jeglichen Komfort, und der motorisierten Schneeräumung ist kein Aufwand gross genug, um die Sicherheit des Verkehrs zu gewährleisten. Weniger komfortabel hat es der Fussgänger. Er bibbert, schneuzt Eiskörner, und die Genitalien stülpen sich nach innen. Jeder Schritt wird zur Qual. Die undeutlich gewordenen Wege sind kaum noch auffindbar. In den klebrigen Schneemassen gibt es kein Vorankommen, selbst Skier können da keine Abhilfe schaffen. Skier bewirken eher das Gegenteil. Sie beschleunigen den Untergang. Sobald ich auf Skiern stehe, weiss ich, dass ich schon so gut wie hospitalisiert bin. Es ist dann nur noch eine Frage der Zeit, bis ich irgendwo hineindonnere. Gut, zugegeben: ich kann es nicht. Aber das ist keine Schande. Einer, der nicht skifahren kann, braucht sich bezüglich des beliebtesten Wintersports nichts vorzumachen. Mit Skiern kann man immer nur dort unterwegs sein, wo es Pisten oder Loipen gibt. Trotz aller Mühen, die der Fussgänger auf sich nehmen muss, wenn er sich gegen den Schnee behaupten will, ist er doch noch besser dran als der Skiheini. Er kann gehen, wohin er will, er kann sich durch Schneeverwehungen kämpfen, wo ein Skiheini steckenbleibt und aufgibt.... Ja, ich habe letzthin eine kleine Schneewanderung gemacht. Es soll mich niemand fragen, wie es gewesen ist. In meinem Kalender habe ich hinter den Frühlingsanfang ein rotes Kreuzchen gezeichnet.
Um mich auf die Kälte vorzubereiten, vollführe ich Einwärmübungen: ich kurble mich an, rolle die Schultergelenke, ziehe meine Fäustlinge straff über die Knöchel, boxe in die Luft, stapfe eine Weile vor dem Haus hin und her und trete dabei eine Spur, die vom Hauseingang direkt zum Wald führt. Von dort aus folge ich einem Weg, dessen Schneebelag schon ziemlich zerstampft ist, viele Spuren gehen den Berg hinauf, Tüpfelchen von Vogelklauen, breite Schuhspuren und die patzigen Trittsiegel von Hundepfoten. Ich folge diesem Weg aufwärts durch den Wald und in die weich verhüllte Hügelzone hinein. In den Rillen meiner Sohlen pappt Schnee, der teils bröckelig, teils griessig ist und bei jedem Schritt gemütlich knirscht. In der gefrorenen Stille ist nur dieses kurze, rollende, regelmässige Geräusch zu hören, dieses trockene Knirschen, wenn die winzigen Kristalle zusammengepresst werden unter dem Druck des in den Schnee eindringenden Körpers; ein schönes Geräusch, es zeigt mir mein Vorankommen an. Als der Weg schmäler wird, peitscht mich hie und da ein zurückschwingendes Ästchen, das ich gestreift habe, und hie und da rutscht etwas Schnee herab, dem ich nicht ausweichen kann. Ich gehe lange so dahin, und je höher ich komme, desto weisser und feiner wird der Schnee. Der Weg ist etwas aus der Form geraten, weder links noch rechts eine Böschung oder auch nur ein Rändchen; er macht Anstalten, völlig mit seiner Umgebung zu verschmelzen. An die Belästigungen des herabrutschenden Schnees gewöhne ich mich genauso wie an das Steckenbleiben. Mit jedem Schritt hebe ich ein kleines Loch aus. Was ich da auf mich nehme, ist mühsam, aber auch kräftigend. Es ist ein langer und langweiliger Weg. Aber ich gewöhne mich daran. Ich gewöhne mich an die Langeweile, die Langsamkeit, den gleichmässigen Schritt, die endlosen, wie mit Tünche beworfenen Baumreihen. Nichts Besonderes jedenfalls, viele Wiederholungen, ich könnte diese Beschreibung abkürzen. Was ich natürlich nicht will: die Langatmigkeit der Beschreibung hat ihren Sinn. Sie rekapituliert die Monotonie der Schneewanderung. Der Wald, den ich hier vorfinde, ist ein typischer Wintermusterwald, wie aus dem Weihnachtskatalog. Da ich nicht schon umkehren möchte, konzentriere ich mich auf das Ein- und Ausatmen. Die Luft ist schneidend, jeder Atemzug ein geschliffenes Messer. Die erste Krise, ich muss durchhalten. Ich bin also vollauf von mir selber in Anspruch genommen. Die Schmerzen des Luftholens und die Erleichterung, die es mir verschafft, die eiskalte Luft wieder auszustossen, halten meine Blutzirkulation in Gang. Ich verpasse nicht viel. Die Umgebung ist nicht besonders interessant, ich schaue sie mir nur sehr flüchtig an. Ich stelle fest, dass es hier viele Tannen gibt, mit Stalaktiten befranst, Stämme und Nadelkleider in lotrechter Erstarrung, unter den Tannen jedoch kaum Schnee, trockene Reiser in Mulden. Dort bauen Ameisen immer noch ihre Nester. Nun ist dieser Tannenwald bei weitem nicht überall so hochstämmig, wie es zuerst den Anschein gehabt hat. Ich komme, während der Weg sich unschlüssig dahinwindet, an etlichen aufgeforsteten Stellen vorüber, an Jungwuchs, den man jeweils auf die Fläche eines Vorstadtgartens zusammengedrängt hat. Dann fällt der Weg plötzlich ab, ein Stück weiter unten, in der Mitte eines breit sich auffächernden Tales, erhebt sich eine einzelne mächtige Kiefer mit einem Wust aus Zweigen und Reisern an der Spitze. Wie ein Aussichtsturm ragt dort dieser Solitär deutlich über die andern Bäume hinaus, er halbiert mein Gesichtsfeld. Der Weg führt weiter abwärts, in dieses weich zugeschneite Tal hinein. Die Stelle, an der ich mich jetzt befinde, scheint mir geeignet, ein wenig Atem zu schöpfen und Umschau zu halten. Vom Wegrand aus habe ich eine gute Aussicht, besonders nach Süden, schräg unter mir beginnt ein lichtes Gewimmel jüngerer Tannen: Indianerzelte, mit Fellen und Fransen behangen, vermummte oder halbvermummte Wichte, in den Himmel hinaufglotzend, klobige Statuen, von weissen Stuckgirlanden umschlungen. Ein Gewimmel von Gestalten. Da und dort, in steif ausladender Würde, in einem weiten verfilzten Umhang, sticht aus dem Gewimmel des Jungwuchses eine ältere Tanne heraus, kummervoll und stolz, etwas kleiner vielleicht als die Kiefer, aber ihr mindestens ebenbürtig an Alter und Knorrigkeit. So wettererprobt diese Altersriesen auch sein mögen, ein Blitzschlag oder Windstoss könnte ihnen mit Leichtigkeit das Genick brechen. Sie haben sich überlebt, sind auf die Zuschauerränge verbannt. Dieser Waldabschnitt gehört den Jungtannen, die ihn mit ihrer Vielzahl und der jeder Berechnung spottenden Schnelligkeit ihres Wachstums vollständig in Besitz genommen haben. Die ungünstige Hanglage scheint sie anzuspornen. Weiter oben jedoch mehren sich die Fehlwüchse: einzelne Tannen und Tännchen stehen schräg und verkrümmt, mitunter leicht zurückgelehnt, als fürchteten sie, den Halt zu verlieren und ins Tal hinabzupurzeln mitsamt dem aufgebuckelten Schnee. Da und dort sehe ich ein Bäumchen, das sich mit ein paar haardünnen Wurzeln, unter Aufbietung letzter Kraftreserven, an ein Stück Kalkfels krallt. Das Gelände ist überhaupt sehr felsig hier. Hangaufwärts geht der Waldboden in eine schüttere Fluh über, grosse Steinmassen sind aus ihrer ursprünglichen Fassung herausgetreten und in Blöcke zerborsten, formen nun Schlupfwinkel und Klimmstufen. Alles, was höher als mannshoch ist, ringt mühsam mit dem Gleichgewicht, rennt, bildlich gesprochen, auf der Flucht vor den Auswirkungen des Gefälles bergaufwärts. Die Tannen dort oben sind Akrobaten, Überlebenskünstler. Sie haben ungewöhnliche Methoden entwickelt, um sich in dieser lebensfeindlichen Lage behaupten zu können. Zum Beispiel klammern sich etliche von ihnen an ihre Nachbarn, bilden Paare, umschlingen einander unter konischen oder kubischen Hüten. Diese Umarmungen spielen sich in einer vollkommenen Lautlosigkeit ab. Wären mir die Augen verbunden, ich würde annehmen, ich befände mich auf dem Mond. Ein gähnendes Schweigen umgibt mich, nahezu greifbar, etwas Wattiges, Weiches, das jedes Geräusch, selbst das Knirschen unter den Schuhsohlen, aufsaugt. Inzwischen bin ich weitermarschiert, meine Pause ist nur ein Gedankenstrich gewesen, ein kurzes Aussetzen der Beine. Wenn man plötzich stillsteht, kann man nicht alles anhalten. Dem einmal eingeschlagenen Weg stellt man sich wie einem Kampf, von dem man nicht ablassen kann. Eigentlich möchte man ständig vorwärts. Macht man eine Pause, so marschiert es im Kopf drin weiter, allerdings nur im Kreis herum, in eine seltsame Zagheit hinein, die absinkt in die Beine und deren Schrittfestigkeit lähmt. Die Kälte kriecht mir unter die Kleider, zwingt mich zum Weitergehen. Ich plustere mich wie ein Kragenhuhn. Nach einem Schluck aus dem Thermoskrug setze ich meinen Weg fort. Es ist mir egal, wohin ich gehe, in dieser eintönigen Schneelandschaft kommen mir alle Aussichten und Richtungen etwa gleichwertig vor. Ich stapfe, ohne mir etwas dabei zu überlegen, über die Wegkante hinaus und drücke meine Schritte in den unberührten Schnee. Dieser Gang ist ein nicht enden wollendes Abwärtsgehen und Beiseitewerfen des Schnees. Zwischen den Tannen streicht ein stäubender Wind herauf. Die Äste zittern, winzige Schneeklümpchen prasseln herab. Ich habe das Gefühl, zu trudeln, halb in der Luft, halb auf dem Boden, der keinen sicheren Halt mehr bietet, renne ich steil abwärts, rutschend fast, das Gelände senkt sich in immer kleiner werdenden Stufen zum Talboden hinab, flacht ab. Doch bevor ich unten ankomme, reisst es mir, just an der Kante der letzten Böschung, die Beine unter dem Körper weg, und ich purzle Hals über Kopf dem Talboden entgegen. Und dort liege ich dann. Spucke Schnee, drehe mich um, versuche mich aufzurappeln. In meinen Ohren ein Dröhnen von Pauken und Trompeten, das nach kurzer Zeit einem kläglichen Pfeifton weicht. Und als auch noch der Wind verstummt, wird es wieder still wie in einer Kirche. Ich stapfe drei, vier Schritte geradeaus, pflüge mich durch Schneeschichten, die sich dick überlagern, und halte den Kopf zu Boden gesenkt. Ich höre nur meinen Atem. Ich bin eingekapselt in meinem Körper. Plötzlich ist da etwas, das mich zurückprallen lässt: ein hochaufragendes, borkiges Ungetüm. Wenige Schritte vor mir erhebt sich die mächtige Kiefer, die ich von weitem schon bewundert habe. So von nahem wirkt sie erschreckend gross. Ich zögere. An den Stamm ist eine Schaufel gelehnt, das Schaufelblatt zur Hälfte eingeschneit. Ich weiss nicht warum, aber ich finde das sehr sonderbar. Ich stapfe weiter, schleppe mich voran zwischen den einzeln stehenden Tannen und Tännchen auf dem schrundigen Talboden, den kleinen Verwehungen, Brüchen und Kanten des Schnees. Die Unterlage, auf der ich da gehe, hat die glasige Härte eines Gletschers, links und rechts je ein Buckel, in den grauen Himmel hinaufgewölbt, steil, oben abgeschliffen, das sind die Talwände, an denen die Tannen ins tiefliegende Tal hinabschauen. Überall Tannen, ein schwarzes Gesprenkel, über eine kreuz und quer aufgefaltete Fläche verteilt. Der Schnee liegt ganz und gar nicht überall gleich hoch, das sieht man an den Unregelmässigkeiten seiner Oberfläche. Nach einer Weile wird der Wald dichter, schwärzer, die Schneefelder schrumpfen, die Tannen schliessen sich zusammen, und bald umgibt mich wieder ein richtiger Wald, in dem ich alle naselang auf ein Eichhörnchen oder ein Reh stosse. Plötzlich bin ich wieder auf einem Weg, was meinen kurzbeinigen Zustand aufhebt. Dieser Weg ist angenehm. Unter schwarznadligen Tannen hinschleichend, hält er zuverlässig die Richtung, in die ich will. Hier ist endlich alles genauso, wie es in einem Tannenwald sein sollte: dunkel, russig, leer, kerzengerade Stämme mit Kerben, aus denen steinhart schäumendes Harz quillt, kissenweiches Gehen auf vergilbten Nadeln, ringsum faserige Schwärze, in deren Schutz sich der spärlich beschneite Weg den Berg hinauf schlängelt, einer Art Pass entgegen. Als ich dort ankomme, ist mir wieder warm. Ich schwitze, huste. Meine Augen laufen über, ein Wind wehte mich an, der über den Schnee kratzt wie ein Reibeisen. Ich stelle mich ihm entgegen mit ausgebreiteten Armen und offenem Mund. Von hier aus führt der Weg stracks ins Offene, auf ein leicht abschüssiges Feld. Der Weg verschwindet im Schnee. Nicht weit vor mir, mitten auf der Wiese, erhebt sich ein Felsgupf, schroff, von einer hohen, runden Mauer gekrönt. Ein düsteres Gemäuer zeichnet sich scharf gegen den grauen Himmel ab. Unter meinen Füssen häufen sich Steine, die durch den Schnee stechen. Geröll, Bruchsteine. Auf einem wendigen Ziegenpfad komme ich zu einem schmiedeeisernen Tor, das sich nicht öffnen lässt, so sehr ich auch daran rüttle. Eine rostige Kette, mehrfach um die Gitterstäbe geschlungen, und ein rostiges Vorhängeschloss weisen mich ab. Ich bin ziemlich verärgert. Auf eine Tafel mit der Aufschrift “Zutritt verboten” hat man freundlicherweise verzichtet, was meinen Ärger dann doch etwas dämpft. Wenigstens ist hier keine amtliche Ordnungswut am Werk gewesen. Durch die Gitterstäbe sehe ich einen Ausschnitt des Innenhofs, der einem Trümmerfeld gleicht, und im Hintergrund eine schöne weisse Kapelle, die allem Anschein nach nicht aus dem Mittelalter stammt. Sie ist putzig gebaut, auf dem Dach hockt ein Türmchen. Ansonsten sehe ich kaum etwas, nur Geröll und Mauern. Ich horche, jedes Geräusch kann mich jetzt nervös machen. Durch das Rauschen in meinen Ohren hindurch höre ich ein fernes Rabengekrächz und den flachen, dünnen, den Glasschnee schleifenden Wind der Hochebene. Was soll ich hier noch? Ich nehme den Heimweg unter die Füsse, gehe langsam, zögernd davon, ziehe dann aber nach wenigen Minuten energisch an, um kaum zwei Stunden später wieder in meiner Küche zu sitzen. Es ist Zeit für den zweiten Kaffe.
Der Frühling fällt passabel aus. Er macht seine Sache gut, Rückfälle in den Winter sind unvermeidlich, der Zeitpunkt ist früh, aber nicht verfrüht. Die grauen, versumpften Wälder und die an hohen Hanglagen klebenden Schneereste verblassen wie Geister bei Tageslicht. Das Licht knallt vom Himmel, es weckt die Lebensgeister, schickt die andern Geister ins Grab. So ist es jedes Jahr: ein kleines Ziehen und Rucken, und auf einmal ist alles grün. Schau dich nicht um. Womöglich hat es schon begonnen.
Wenn man ein schäbiges Tuch, dem niemand mehr etwas zutraut, in den Wind hängt, so bauscht es sich in die Breite und Höhe, es wird riesig, weltbedeckend. Der Frühling verlängert die Tage, vergrössert den Einfallswinkel des Lichts. Die Zeiten und das, was sich am Himmel abspielt, geraten durcheinander. Auch wärmer wird es schon. Die Märzenbecher und Schlüsselblümchen können sich nun einschmeicheln bei Hinz und Kunz. Man muss sich daran gewöhnen, dass man nicht mehr alleine unterwegs ist. Man bekommt Gesellschaft. An jedem sonnigen Nachmittag wimmelt es im Wald von Leuten, die „es“ erleben wollen.
Zum Thema Hunde. Die lautesten Kläffer sind die Dackel. Sie haben auch die kürzesten Beine. Die Berner Sennenhunde sind im Verhalten sehr unterschiedlich. Kürzlich wollte mir einer ans Lebendige. Er lag, wenigstens dem Anschein nach, ganz friedfertig vor der Eingangstreppe eines Hauses: ein Steinlöwe, der die Stufen zu einem Portal bewacht. Er beobachtete mich schon von weitem. Als ich ihn bemerkte, nahm ich schnell einen Stecken zur Hand. Irgendein Gefühl sagte mir, dass ich dem Kerl nicht trauen durfte. Er sah mir eine Spur zu friedlich aus. Er liess mich seelenruhig herankommen, schoss dann aber, kaum hatte ich ihm halbwegs den Rücken zugekehrt, blitzartig auf meine Fersen zu, nicht spielerisch oder bloss drohend, sondern tatsächlich bösartig: knurrend und zähnefletschend. Mit dem Stecken konnte ich ihn einigermassen in Schach halten. In diesem Moment ging oben ein Fenster auf und eine Frau rief heraus: „Er ist ein Lieber. Er tut nur so blöd, weil Sie einen Stecken haben. Tun Sie den Stecken weg, und er ist lieb!“
Stellen wir uns ein gewöhnliches Dorf vor, ein Dorf, das als typisch gelten kann für diese Gegend, und nennen wir es Uckten, ja, das klingt nicht schlecht, Uckten, im Hochmittelalter erstmals urkundlich erwähnt, ein mittelalterliches Dorf also, vermutlich aber älter, eine alemannische Siedlung mit einem keltischen Anteil, dessen Ursprünge sich irgendwo zwischen Jungsteinzeit und den ersten Temperaturstürzen des Pleistozäns im Dunkel des Höhlengepolters verlieren. Dieses Dorf, so alt es auch sein mag, erhebt in aller Bescheidenheit Anspruch auf gediegenen Neuwert. Die mustergültig renovierten Häuser im Dorfkern haben nichts Aussergewöhnliches, aber sie sind schön, sie geben sich stattlich; wer sowas sein eigen nennt, kann sich mit Notproviant jahrelang einschliessen, ohne sich schämen zu müssen. Andererseits braucht sich auch auf der Strasse niemand zu schämen. Eine breite Strasse schneidet das Dorf entzwei. Sie ist breit genug, um einen Fussgängerstreifen zu rechtfertigen. Damit haben hier selbst die Fussgänger Anschluss an eine Zeit gefunden, in der ein Mensch, wenn er von A nach B will, eine narrensichere Signalisation nicht zu entbehren braucht. Uckten kann es sich leisten, die teuersten Signalfarben zu verwenden. Baulandumlegungen, verbunden mit Spekulationen und Aufkäufen, haben dazu geführt, dass höhere Angestellte der städtischen Chemie hierhergezogen sind mit Geld und dem Wunsch, in ein verkehrstechnisch gut erschlossenes Dorf zu investieren. Man will hier seine Bequemlichkeit haben, und darüber hinaus will man, dass die Kuh, die man füttert, schön rund ist, gut im Saft, und den Dreck dorthin fallen lässt, wo das Gras wachsen soll – aber keinesfalls daneben. Dieses Anliegen scheint mir berechtigt. Reinlichkeit, Schönheit, Zweckmässigkeit sind wichtige Standortvorteile. Die neue Zeit wird auch dort eingeläutet, wo die Glocken zur Bewahrung der Idylle aufrufen. Die neue Zeit passt gut dorthin. Für den passenden äusseren Anschein ist gesorgt. Warum soll das industriell erwirtschaftete Geld nicht einem Dorf zugute kommen, das seine dick und klobig die Strasse einfassenden, kleinfenstrigen Bauernhäuser aufbewahrt und ausstellt wie antiquarische Kostbarkeiten? Der Kapitalfluss hat die bauliche Substanz unangetastet gelassen, hat sie lediglich umgebildet, aufgewertet, diskret aufgemöbelt. Das Dorf sieht nun aus, wie es auf alten Postkarten möglicherweise hätte aussehen sollen, aber wegen der vielen Misthaufen und zerfallenen Schuppen gar nie ausgesehen hat. Gemeinschaftlich hat man sich ans Werk gemacht, und nun glänzt alles wie neu. Was man gemacht hat, hat man den Alten nachgemacht, aber man hat es besser gemacht als sie. Perfekter. Die heruntergekommenen Höfe hat man geflickt, entrümpelt und ausgemistet, die Jauchegruben sterilisiert, die Dächer neu gedeckt, die Tragbalken ersetzt, die Dachböden entstaubt, die Kamine entrusst, die Türklinken entrostet und alles, was sonst noch zu einem Haus gehört, Öfen, Heizungen, sanitäre Anlagen, auf den neusten bauamtlich vorgeschriebenen Stand gebracht. Auf allen Seiten hat sich das Dorf herausgeputzt wie für ein Fest, das jedoch nie stattfindet, sondern ein ewiges, nie ganz spruchreif werdendes Projekt bleibt. Uckten ist eigentlich nichts Wirkliches, eher die Vorstufe dazu, ein Modell zur Belehrung und Veranschaulichung, ein Musterkatalog oder Prospekt, der die Dinge so hinstellt, wie sie sein könnten. Uckten ist widerrufbar, austauschbar, beliebig: aber gerade darin liegt die Einzigartigkeit dieses Dorfs. Durchschnittliches braucht nicht minderwertig zu sein. Manche Fassade ist so weiss, dass sie im Auge einen brennenden blinden Fleck hinterlässt, wenn man sie längere Zeit anschaut. Im Gegensatz dazu fällt die grossflächig verglaste Turnhalle kaum auf, sie könnte durchsichtig sein, vollständig aus Glas, Obstwiesen und Waldhügel schimmern durch sie hindurch. Das Umland ist ländlich geblieben, ein Auslauf für Kühe und Kälber, nur spärlich überbaut und deshalb überhaupt nicht verschandelt. Man kann sogar sagen, dass sich die Feldregulierung, die vor Jahren gegen den Widerstand einiger Altbauern in die Wege geleitet wurde, mit dem Dorfbild gar nicht so schlecht verträgt. Was wäre Uckten ohne diesen weitgefassten Umraum? Was wäre das Dorf ohne sein ganzes Drumherum? Was hält den Dorfkern zusammen, was bändigt und bündelt ihn? Dank der Regulierung ist das Dorf ein Dorf geblieben. Diese politisch nicht unumstrittene Bürokratentat hat die Ausbreitung der Einfamilienhäuschen und Altersresidenzen gestoppt, hat die Architekten geknebelt, die Bauherren vertrieben und die Zonenplaner in die Pflicht genommen. In aller Einfalt hat man so die üblichen architektonischen Fehlleistungen vermieden. Ein Verlust an Landschaftsschönheit ist kaum zu beklagen. Was erhaltenswert ist, hat sich erhalten, was, in welcher Form auch immer, eine Entwicklung durchgemacht hat, ist zu einem halbwegs gelungenen Abschluss gelangt. Als hätte man in der Mitte von Uckten einen Zirkel eingesteckt und ihn mit kräftigem Daumendruck ein paarmal herumgeschwungen, ist um das Dorf ein Bannkreis gelegt worden, ein Grüngürtel mit Strommasten und Silos und schroffen Übergängen von Pflanzgärten zu Riesenfeldern, die man bequem durchwandern kann auf kreuz und quer verlaufenden Spazierwegen. Die Ucktener betrachten das alles mit Stolz. Sie lieben ihr Dorf auch deshalb, weil sie sich bezüglich der Gestaltung ihres Lebensraums nichts vorzuwerfen haben. Nichts könnte auch nur ein klein wenig anders sein, als es ist, sagen die einen. Und die andern sagen: es könnte auch alles anders sein, das Dorf könnte Vorstellungen entsprechen, auf die wir noch gar nicht gekommen sind, und deshalb, weil das Dorf so bescheiden zurechtgemacht ist, ein stets veränderbares Provisorium, das seine Vervollkommnung quasi aufschiebt, gefällt es uns. Mit gutem Recht hat man überall Fahnen aufgezogen, Landesfahnen, Kantonsfahnen, Gemeindefahnen. Die Ucktener lieben ihr Dorf, und sie beflaggen es von oben bis unten wie ein Schiff, besprühen es feierlich, erstaugustlich, mit Farben, sie brennen Feuerwerke ab, die entweder schnalzen und schnippen im Wind oder still aufschiessen aus Blumentöpfen. Gerade im Sommer, wenn die Leute wieder etwas mehr Zeit für sich selber haben, lassen sie es sich nicht nehmen, in den Gärten und auf den blumenüberladenen Balkonen alles mögliche aufzuhängen, was Bewegung vortäuscht. Täuschung, wenn sie gelingt, ist ja in gewisser Weise keine. Sie verschmilzt mit dem, was sie vortäuscht, sie erzeugt Wirklichkeit. Auf diesem Prinzip beruht jede Kunst: so auch die Kunst der heimischen Kinetik. Da flattern und flappen Tücher und schlagen mit schlappen Fäusten auf den Himmel ein. Da schaukeln aufgehängte Papiergirlanden, Windglockenspiele tönen, Teelichthänger scheppern, Plastikbänder verflechten sich ineinander. Mit diesem an Stangen, Häusern und Balkonen festgezurrten Farb- und Luftspektakel hofft man den toten Punkt des Jahres zu überwinden, den Hundslochpunkt, wie man hierzulande sagt. Manchmal fährt in die schlimmste Hitze ein Wind hinein. Wenn die Ventilatoren versagen, weil sie überhitzt sind, und selbst die Fliegen sich verkriechen, kann es vorkommen, dass das ganze Spektakel nach einigen Momenten der Ruhe plötzlich wieder losgeht: das Schnurren von Windrädchen, das Knattern von Folie, das Klingeln von Windglocken, das Scheppern von Teelichtern, das Flappen von Fahnen und das Rascheln dürrer Blumenblätter. Dann weiss man: Uckten lebt.
Wenn man blind drauflosgeht, durch viele Schwierigkeiten und Aussetzer hindurch, wird man vielleicht eine Ahnung davon bekommen, was Gehen sein kann. Man kann das Gehen immer weitertreiben, das Immer-Weiter hat es in sich, es treibt an, es berauscht. Wer ein festes Ziel hat, geht eigentlich rückwärts - oder gar nicht.
Sobald die Landschaft merkt, dass man sie photographiert, wirft sie sich in Pose, lächelt. Sie hat durchaus freundliche Züge. Sie möchte gefällig sein. Wenn wir sie bewandern und bewundern, kommt sie uns entgegen, macht uns bereitwillig Platz. Sie schiebt uns einen Weg unter die Füsse, stellt Wegweiser auf, ordnet Fällungen an, zieht Gräben für das Abwasser, streut ein paar Häuschen hin, ein paar Hundetoiletten, rückt die Berge zurecht: so zeigt sie uns ihre Freundlichkeit. Sie möchte uns das Gehen so angenehm wie möglich machen, sie unternimmt alles, damit wir uns wohl fühlen. Aber ist das die wirkliche Landschaft?
Die wirkliche Landschaft verschliesst sich, sobald man aus dem Spiel des geordneten Wanderns aussteigt. Sobald man die ausgetretenen Pfade verlässt.
Dort also, im Süden, geht der Tafeljura in den Faltenjura über, den man ständig vor Augen hat, eine in westöstlicher Richtung verlaufende Ansammlung paralleler Bergketten. Man könnte auch sagen: von Hügeln. Ja, es sind Hügel, sie heben und senken sich wie Hügel. Mit ihrem Wiesenschmuck, ihrem Tannenwaldgefälle wirken sie gerundet und weich, gar nicht gebirgig, alles an ihnen ist hügelig, oder fast alles. Vielleicht ist das Hügelige an ihnen nur ein Gewand, das sie sich übergeworfen haben, um ihre Kargheit zu verbergen. In ihrem Innern steckt sehr viel Gestein. Also sind es doch auch Berge, halbe Berge. Das Problem ist, dass es für diese geologischen Gebilde keinen tauglichen Begriff gibt. Natürlich sind es Berge, keine Hügel, aber eben sehr kleine Berge. Winzlinge, und doch auch wieder zu umfangreich für Hügel. Von einem Berg erwartet man, dass er etwas Gewaltiges darstellt. Der K2 ist ein Berg, das Matterhorn. Das sind richtige Berge. Zerklüftet und mit ewigem Schnee bedeckt, reichen sie bis weit über die Wolken hinaus. Dagegen sind unsere Juraberge beschämend klein. Sie wirken verkümmert, irgendwie abgeschabt, zerquetscht. Es scheint fast, als hätte sie der geologische Faltenwurf in eine peinliche Schräglage gebracht, als wäre die Auftürmung des Erdreichs missglückt. Sie stehen wacklig, lehnen sich aneinander an. Sind das Berge? Wenn es aber keine Berge sind, was sind es dann? Sollte man, um diese begriffliche Lücke zu schliessen, nicht ein neues Wort erfinden? Bürgel: das Wort wäre geeignet, die moderate Mitte zwischen Berg und Hügel. Also, könnte man sagen, diese Bürgel türmen sich im Süden zu blauschwarzen Gebilden. Selten sind sie umnebelt, Aufwind treibt dort Nebel sehr schnell fort. Aber wie sieht es dahinter aus? Was dahinter ist, das weiss diesseits des Juras kein Mensch. Gibt es intelligentes Leben hinter dem Jura? Jemand, der die Gegenden dort - meistens liegen sie unter einer dicken Nebeldecke - bereist hat, angeblich bereist hat, müsste man sagen, er behauptet es ja nur, berichtet von gewaltigen Städten und grossen Industrien, von Hochhäusern, Autobahnen, Kühltürmen. Dieser Mann, ein Spinner wie Marco Polo, ein notorischer Aufschneider, ausserdem vorbestraft, erzählt seine Geschichte allen, die ihm mit einem Schulterklopfen ein Bier spendieren, und niemand glaubt ihm auch nur ein Wort. Geschieht ihm recht.
Auf jeder Hochebene findet man mindestens ein Dorf, in dem alle Wege zusammenlaufen, eine City mit einem Verwaltungsgebäude, einer Schule, einer Mehrzweckhalle, einem Sportplatz, einer Tiefgarage, einem Einkaufslädeli und einer Handvoll Bauern, die in dem Gewirr der Häuser, in dem sie leben, oft selbst nicht wissen, wo der Stall aufhört und der Wohntrakt anfängt. Solche Ortschaften können nur auf der Grundlage einer intensiven Bodennutzung entstehen. Dank den heutigen Anbaumethoden haben es viele Bauern zu Wohlstand gebracht. Bäurischer Wohlstand bedeutet: Geld in der Matratze und Heu im Tresor. Die hiesige Agrokultur ähnelt einer Waschmaschine, die Obstbäume wirken gepflegt, die Felder glänzen, die Böden sind nahrhaft, die Anbauflächen gross, und der Wind, der die Bienen in die Blumenmatten hineinwirft, bläst steif, verleiht Fruchtbarkeit. Man geht über die Felder, halbe Tage lang, man wird robust bei diesem Gehen, fängt an zu pfeifen, krempelt die Ärmel hoch, bietet den tanzenden Zitronenfaltern die Handflächen dar, und wenn die Sonne allzu heiss wird, schlüpft man in ein kleines Wäldchen und pfeift dort ein Liedchen, bis ein Bauer angestiefelt kommt. “Heda! Hueresiech! Was isch los?” Die Bauern mögen es nicht, wenn man ihre Wäldchen, Hecken und Wiesen als Freizeitanlage benutzt. Sie verstehen die Logik der Freizeitgesellschaft nicht, so wie sie auch das Nichtstun nicht verstehen, überall wittern sie eine heimliche Bereicherungsabsicht. Als ob man nur drauf aus wäre, ihre Kirschen und Äpfel zu stehlen! In jedem Wanderer sehen sie einen potentiellen Verbrecher: das Gegenprinzip, nicht sesshaft, ein moderner Landstreicher, ein anrüchiges Subjekt! Und seltsam, seltsam: immer gerade dann, wenn man am Hosenschlitz herumnestelt, um an einen Baum zu pissen, taucht ein Bauer auf und möchte wissen, was man hier zu suchen hat. Bauern sind bauernschlau, und nicht seltsen sind sie sogar mit einem siebten Sinn begabt. Sie riechen den Angstschweiss eines Lumpenvagabunden gegen den Wind. Durch ihre unverhohlene Präsenz geben sie einem zu verstehen, dass sie die Bodenbesitzer und Verteidiger der Früchte und Knollen sind. Wer über die Felder geht, der geht nicht: er schleicht. Er macht sich verdächtig.
Ich habe mir vorgenommen, eine Hochebene zu überqueren. Zunächst macht sich alles ganz gut. Kein einziger Bauer stellt mir nach, wohl auch deshalb, weil ich die markierten Wege nur selten verlasse. Ich lege ein Marschtempo vor, das sich sehen lassen kann. Ich freue mich auf neue Eindrücke, die Sonne sticht, und die Landschaft flimmert. Aber mitten im sorglosesten Drauflosgehen - ich weiss nicht, ob ich mich klar genug ausdrücke - beschleicht mich ein Gefühl der Monotonie, der Vergeblichkeit. Die Landschaft erstreckt sich von einem Rand zum andern. Sie ist begrenzt. Immer wird mir der Weg irgendwo abgeschnitten, und jedesmal, wenn ich merke, dass es nicht mehr weitergeht, kehre ich um. Ich verhalte mich wie ein Insekt, das kopflos auf einem Teller herumkrabbelt. Ich bin verwirrt. Die schöne weite Fläche, die Freiheit suggeriert, Sturmwind, Präriestimmung, erweist sich als eine Ptolomäische Weltscheibe. Wo ich auch hingehe, überall stosse ich an den Rand. Ich pralle ab wie eine Billardkugel. Mit grossen ausgreifenden Schritten gehe ich wieder und wieder über die ganze Ebene hinweg, von einem Ende zum andern. Komme ich denn nie über den Rand hinaus? In gewisser Hinsicht ist das gar nicht so wünschenswert. An der Kante, dort, wo die Hochebene abbricht, kommt man leicht ins Rutschen, scheut zurück, muss sich festhalten. Dort ist ein Übergang, und Übergänge sind gefährlich. Die Landschaft hört auf, eine Landschaft fürs Geradeausgehen zu sein. Sie neigt sich, kippt, verengt sich zu einem Einschnitt, einem Tobel, einer Schlucht, und der Weg fällt holprig ins Tal hinab.
Eine rostrote Erdschnecke macht sich gemächlich über einen Pilz her. Sie benagt seine Ränder, saugt an seinem Fleisch. Sie schleimt. Was sich hier gut sichtbar am Wegrand abspielt, ist nichts Besonderes. Aber wenn man nicht gerade in Eile ist, wird man auf dieses beharrliche Fressen einen interessierten Blick werfen, vielleicht sogar längere Zeit dabei verweilen. Die Schnecke schnippelt und schlürft mit einer vollkommenen Konzentration. Hier spürt man sofort ein ungeheures Gewicht. Mit all seinem Wissen, Denken und Fühlen wiegt der Betrachter viel weniger als diese selbstvergessene, sich nur ums Fressen kümmernde Schnecke. Was sie tut, ist elementar, vielleicht das Elementarste überhaupt. Im Zolli sind Fütterungen eine Attraktion. Warum eigentlich? Woher kommt diese Fütterungsmanie? Obwohl es inzwischen verboten oder zumindest verpönt ist, lassen sich manche Leute nicht davon abbringen, ganze Säcke voll Brot an Tauben und Möven zu verfüttern. Sie mästen die Tiere zu Tode. Sie tun es nicht etwa aus Sorge um das Wohlergehen der Tiere, nicht aus fehlgesteuerter Tierliebe heraus, denn sie würden ihr Brot niemals hergeben, wenn sie beim Füttern nicht zuschauen könnten. Der Grund für diese Manie liegt woanders. Einem Tier beim Fressen zuzuschauen, ist eine Art Meditation. Der Zweck der Übung ist das Zuschauen, das Miterleben. Tiere fressen so schön. Es ist wunderbar, ihre Gier, mit der sie uns buchstäblich aus der Hand fressen, mitzuerleben. Tiere können noch richtig fressen. Sie machen Purzelbäume, um ein Stück Brot zu schnappen. Sie wühlen sich blind in das Futter hinein. Solange es da ist, ist es da. Ihre Gier ist gradlinig, voll konzentriert. Es gibt da keine Ablenkung, keine Zügelung, weder Tischmanieren noch das Einteilen in Portionen. Auch das Schwatzen mit vollem Mund ist ihnen unbekannt, dafür ist schlicht kein Platz, das Bewusstsein ist mit dem Fressen ganz ausgefüllt, und wenn sie etwas verschmähen, dann nur, weil es sie schädigen könnte. Da Tiere so ungeschützt sind, ihren Instinkten hörig bis zur Selbstaufgabe, rührt uns das Schauspiel des tierischen Fressens wie eine ferne Erinnerung. Wir sehen darin das, was wir unter all den kulturellen und zivilisatorischen Überformungen eigentlich sind. Das tierische Fressen und Schlingen öffnet uns die Augen für die Verbundenheit des Lebens - auch unseres Lebens - mit der Materie. Es ist eine Verbundenheit auf Gedeih und Verderb. Wir sind Materie, wir verschlingen sie und werden von ihr verschlungen. Alles frisst alles. Die Tiere machen es uns vor. Die Hingabe ans Beissen, Käuen und Schlucken bündelt das Universum in einem einzigen Willen, einem einzigem Bedürfnis. Das ist es, was uns Tiere voraus haben. Wenn sie Nahrung aufnehmen, sind sie voll dabei. Beim Fressen: ungeteilt. Sie werden eins damit, sie unterwerfen sich dem kosmischen Hunger, verschlingen Materie, um sich in der Welt, die in Form von Nahrung durch sie hindurchläuft, zu erhalten als Fleisch und Blut, als ein Stück Leben, das sich einspeist ins Ganze. Sie fressen die Welt, wie auch die Welt ständig darauf aus ist, sie, die Schlingenden, zu verschlingen. Das, und nichts anderes, ist Natur, darin liegt das Prinzip ihres Wirkens. Wir Menschen haben uns von diesem Vorgang ein wenig distanziert. Wir betrachten ihn nicht nur mit Freude. Das Gekrabbel der Fliegen auf einem Stück Fleisch widert uns an, und wenn unser braver kleiner Wuffi seine eigene Scheisse frisst, schicken wir ihn zum Hundepsychologen. Umso beglückter sind wir, wenn wir sehen, wie sich ein Tier, unberührt von all den Manieren und hygienischen Rücksichten, durch die wir unseren menschlichen Status erhalten, ein Stück Welt einverleibt. Da sind wir grosszügig, wir verteilen Futter und wenden alle möglichen Tricks an, um die Gier der Tiere anzustacheln. Plötzlich kommt auch bei der harmlosen Springmaus eine fangheuschreckenartige Bisswut zum Vorschein, die uns ergötzt; – wie auch Kinofilme uns ergötzen, in denen Häuser explodieren und grosse Monster kommen, die alles niedertrampeln. Dies ist die Kehrseite unserer Neigung, Tiere zu vermenschlichen und durch Überzüchtung und Dressur unter das Niveau der natürlichen Vitalität zu zwingen. Stubenreine Wollknäuel genügen uns nicht. Wir brauchen auch Gegenbilder. Wir brauchen den Bezug zum Nichtmenschlichen, zum Vormenschlichen. Darin, denke ich, liegt der wichtigste Antrieb, sich überhaupt mit Natur zu beschäftigen. Und deshalb bleiben wir stehen, um einer kleinen Schnecke beim Fressen zuzuschauen. Was bei der Schnecke noch dazukommt, ist ihre Langsamkeit. Auch das ist eigentlich ganz und gar unmenschlich: diese Ausführlichkeit, diese schlürfende Pulsieren des ganzen Körpers. Die Schnecke lässt sich Zeit, sie verschlingt sich mit dem, was sie verschlingt, sie bearbeitet es in einer langwierigen Prozedur.
Das Meer ist plötzlich da, unerwartet. Nach einem kurzen Aufstieg im schattigen Buchenwald trete ich vor ein belaubtes Tor, durchschreite es mit einem Ruck, und schon ist alles ganz hell und blau. Ich bin auf der Hochebene. Alles liegt in der Sonne. Ich sehe Himmel und Erde, unscharf getrennt durch einen Balken, der ein bisschen flimmert von aufsteigender Feuchtigkeit; ich sehe Äcker, quadratisch unterteilte Anbauflächen, ich sehe Baumzeilen, Hecken, Strässchen, Wege, grüne Mittelstreifen. Auf einem Wegweiser lese ich die Angaben. Gehstunden, Ortschaften. Die gelbe Bemalung ist teilweise abgeblättert, hat Blasen geworfen, Zahlen und Buchstaben behaupten sich gegen die Witterung. Jetzt, scheint es, haben sie ihre Schuldigkeit getan; ich bin auf dem richtigen Weg, kann sorglos weitergehen zu dem in entfernter Bläue verschwimmenden Wald und zum Abstieg auf der andern Seite. Ich überquere die Hochebene.
Zitronenfalter schwanken über den Weg, Hummeln umstreichen brummend, sich tolpatschig überschlagend die Grashalme. Da es nun nicht mehr aufwärts geht, komme ich wieder zu Atem. Ich gehe automatisch etwas schneller. Dann fällt mir ein, dass ich es ja nicht eilig habe, ich habe keinen Termin vor mir. Ich bin von allen Verpflichtungen entbunden. Wem ich das verdanken habe? Mir selbst! Die Schnelligkeit kommt vielleicht daher, dass man in dem reichlich vorhandenen Raum ständig das Gefühl hat, man sei zu langsam. Eine optische Täuschung. Die Entfernungen sind beträchtlich; wenn man stillsteht und einfach nur hinhorcht, glaubt man das ferne, singende Rauschen einer Meermuschel zu hören. Wellen, die sich an Klippen brechen, über Sandstrände hinlaufen, zischend versickern. Vor Jahrmillionen ist das hier Realität gewesen. Das Wasser eine haarige Suppe, das Land ein Bottich voller Dünste und Gewitter. Auch wenn das alles einer Vergangenheit angehört, die versunken und vergessen scheint, hat diese trockene, nirgends auf Wasserwegen erreichbare Gegend ein schläfriges Rauschen bewahrt, ein Schlürfen, Seufzen und Platschen.
Wenn man sich ganz still verhält und einfach nur in die Weite horcht, ist es beinahe, als ob man am Meer stünde, den auflandigen Wind spürte. In den Rapsfeldern spielen Reflexionen, die an verschiedenen Stellen immer wieder aufleuchten. Ein geisterhaftes Spiel. Ein heimliches Kommen und Gehen von Luft, von Schattierung und Farbe, Luft atmet sich selbst, Luft spiegelt Wasser vor. Man braucht kaum etwas hinzuzudenken. Wellen klatschen den Sand flach. Die Kopfhaut kräuselt sich. Ja, ich stehe am Meer, und ich weiss jetzt auch, warum unsere Tränen salzig sind.
Das Meer habe ich bis jetzt nur zweimal gesehen: einmal in Marseille und einmal in Konstanz. Vermisst habe ich es nie, und wenn ich irgendwohin reise, dann bestimmt nicht in der Absicht, das Meer zu sehen. Ich bin ein Binnenmensch. Ein Mensch, der die Vielgestaltigkeit braucht. Das Meer ist mir zu flach. Zu eintönig. Es gibt nur ein einziges Meer, eine einzige zusammenhängende Wassermasse, die nach Salz und faulem Fisch riecht. Unbegreiflich stupid. Wie interessant hingegen ist das Land! Vor allem dort, wo es sich in die Höhe wölbt. Ich liebe Berge, Waldwildnis, Gletscher, Schluchten, Täler. Ich liebe alles Unübersichtliche. Ich liebe die Abwechslung, das Relief, und ich liebe es, festen Boden unter den Füssen zu haben. Die Jura-Landschaft gefällt mir ganz besonders. Ich kenne sie von vielen Wanderungen her. Das Meer hingegen ist mir nur in der Vergangenheitsform vertraut, als ein Urzustand, der im Juragebirge noch merkwürdig präsent ist. Das Meer hat hier überdauert. Mit einem Schlag steht es wieder da, füllt die ganze Landschaft mit einem zum Himmel wachsenden Tosen und Schaukeln.
Ich bewege mich auf Meeresboden, ich bin ein Taucher in Bleischuhen.
Das Gelände bauscht sich als eine schräg gestaffelte Faltenflut, deren Ränder verfliessen. Aus dem grüngefleckten Dunst tauchen Bauminseln empor, verschwinden wieder. In der Ferne ein willkürliches Gemenge von Tälern, Dörfchen und undeutlichen Flächen: das Elsass, der Sundgau, der Rheingraben. Ständig hofft man auf eine Erweiterung des Ausblicks, hofft benommen, dass hinter dem Dunstschleier ein fremdes Land, ein fremdes Gebirge sichtbar würde. Und so selten sind diese Ausblicke nicht. Für Aufstiege, auch nur leichte, wird man reichlich belohnt. Auf dem Tafeljura berühren sich Himmel und Erde grossflächig. Man fühlt sich gehoben. Vergrössert. Es ist, als ob man auf einer Leiter, die schräg in einer Dachluke steht, in den Himmel aufsteigen könnte. Das Licht ist so hell, dass es die Dinge fast zum Verschwinden bringt. Alles scheint beleuchtet zu sein. Überbeleuchtet. Man sieht bis zum Atlantik, bis zur Nordsee. Im Süden die Alpen, blass wie angehauchte Gläser. Und immer ganz nah und plastisch die Wolken über der Jurakette, träge, fette Kuhwolken, die immer viel schneller sind, als sie zu sein scheinen. Natürlich sieht man das alles nie gleichzeitig, aber Ausschnitte davon sind auf dem Tafeljura öfter zu erhaschen, als einem lieb ist. Man kommt nicht aus dem Schauen heraus. Und häufig ertappt man sich dabei, dass man einem vagen Ferngefühl nachgibt. Ich weiss nicht genau, was das ist: Ferngefühl. Das Ferngefühl ist schwächer als das Fernweh, durchaus mit jenem verwandt, aber harmloser. Es spannt sich genussvoll in die Ferne, es labt sich an der Verschwommenheit. In diesem Gefühl, das ich nur unzulänglich beschreiben kann, weitet sich der Himmel ins Uferlose, weht eine Meeresbrise, entfaltet sich der stille oder laute Ozean.
Das Meer ist von hier nicht wegzudenken; unsichtbar, aber auch sichtbar ist es immer mit dabei. Wer beim Betrachten dieser Gegenden noch nicht an die Weltmeere denkt, tut es spätestens, wenn er die Steine betrachtet, die Kalkwände, die Trilobiten, die Ammoniten, die Teufelsfinger. Das Meer hat sich hier abgelagert, es hat sich eine Unterlage geschaffen, die in Jahrmillionen zusammengeschoben, gefaltet, umgewälzt und teilweise an die Oberfläche gehoben wurde. Der hellgraue Kalk, der die Flühe untermauert, den man mit metallbeschlagenen Wanderstöcken abklopft, aus dem man die Versteinerungen herauspickelt, herauskratzt, mit dem man Feuerstellen einfasst, Plastikplanen beschwert, aus dem man jahrhundertelang Burgen gebaut hat und Herrenhöfe, der durchs Waldlaub kullert, losgetreten von Wanderschuhen und Wildsäuen, den man verarbeitet zu Mörtel und Zement, dieser Stein, aus dem der Baselbieter, Solothurner, Fricktaler seinen Grabstein meisseln lässt, präsentiert sich als Schautafel der Vergangenheit. Dieser Stein ist lesbar wie der Stein von Rosette. In ihm sind Lebewesen konserviert, die der Evolution abhanden gekommen sind. Mehr noch: der Kalkstein selbst ist ein Lebensrelikt, denn er enthält die zerriebene Substanz von Knochen, von abgestorbenen Korallen, von Schaltieren. Auch unser Knochengerüst ist aus Kalk. Mit dem Kalkgestein, auf dem wir leben, sind wir auf makabere Weise verwandt. Wenn der Tod seine Arbeit getan hat, bleibt nur Kalk übrig.
Und dann prasselt es plötzlich los. Es regnet nur kurz, kaum länger als eine Minute. Als der Regen schon nicht mehr fällt, spritzt es noch auf dem Kies, hüpfen Tröpfchen auf dem Asphalt umher. Das abfliessende Wasser, eine Drecksuppe, rauscht durch ein am Wegrand einbetoniertes Rohr. Nach dem vielen Regen sind die Felder noch etwas verbeult. Es tropft von den Ästen. Die kilometerweit entfernten Pfeifsignale des Rangierbahnhofs von M. sind gut zu hören, so still ist es. Durch das nasse Gras streicht eine Katze. Sie stösst das Köpfchen vor, wagt sich kaum zu rühren. Alles ist feucht, ungesund. Die Katze bringt es tatsächlich fertig, immer nur eine Pfote auf dem Boden zu haben. Als sie mich bemerkt, bleibt sie stehen, wie versteinert. Ihre schmalen Augen folgen mir noch lange.
Das richtige Wetter gibt es nicht. Jeder, der in den Himmel schaut, möchte sein eigenes Wetter haben, massgeschneidert für individuelle Ansprüche und Begehrlichkeiten. Wie unten, so oben. Doch das Wetter hat nicht das Geringste mit uns zu tun, jedenfalls nicht mit uns Einzelnen. Dass es auf unsere Wünsche keine Rücksicht nimmt, ist eine altbekannte Tatsache, die leider oft verdrängt wird und zu Spekulationen verleitet, die nirgendwo hinführen. Ich für meinen Teil halte mich aus diesen Spekulationen heraus. Lieber befasse ich mich mit Dingen, die ich ändern, die ich beeinflussen kann. Ich möchte etwas tun können, das in meiner Macht steht. Das Wetter steht nicht in meiner Macht. Es untersteht mir überhaupt nicht. Das, womit ich mich beschäftige, soll etwas sein, bei dem ich nicht zu hoch greife, wenn ich es beeinflussen möchte. Durch die Beschäftigung mit dem Wetter, das nie und nirgends verfügbar ist, verschwende ich nur meine Zeit. Die Sonne leuchtet rot durch strähnige Wolken hindurch. Abendrot ist gut Wetter Bot’. Das mag ja schön sein und ist auch schön gereimt, aber was soll ich damit? Bringt es mich irgendwie weiter? Das Wetter ist eine flüchtige Begleiterscheinung des Lebens. Die Wolken kommen und gehen, der Himmel bleibt veränderlich. Was soll daran so interessant sein? Wäre es nicht gescheiter, man würde sich mit Dingen befassen, auf die man unmittelbar und produktiv einwirken kann? Das Wetter ist immer da, unabhängig von uns, und da wir es ohnehin niemals loswerden, brauchen wir uns nicht auch noch geistig daran festzuketten. Wäre ich dazu bevollmächtigt, ich würde die Beschäftigung mit dem Wetter per Gesetz verbieten. Nur eine Ausnahme würde ich gestatten: die berufsbedingte Wetterfühligkeit. Den Landwirt geht das Wetter wirklich etwas an. Für ihn ist der prüfende Blick zum Himmel lebenswichtig. Das Wetter gehört zu seiner täglichen Arbeit, er macht sich damit zu schaffen, weil es in sein Schaffen eingreift. Würde er das Wetter ignorieren, hätte er das Nachsehen. Während die meisten Leute über das Wetter schwafeln wie über irgendein Vorkommnis, das dem Alltag allenfalls ein bisschen Würze verleiht, kalkuliert der Bauer stillschweigend die wetterbedingten Gewinne und Verluste. Überhaupt, am Bauern sollten wir uns ein Beispiel nehmen: an seiner Gradlinigkeit, seiner Vernunft, seiner Klugheit. Er hat Augen, die nicht weiter blicken als bis dorthin, wo gekalbt und gemäht wird, und wenn er den Himmel beobachtet, so hat er immer genau das im Auge, was für seine Produktivität wichtig ist. Für mich als Künstler sind die Bauern die grössten Vorbilder. An zweiter Stelle kommen die Gärtner, an dritter Stelle die Flachdachdecker.
Warum machst du Videos? fragen mich die Maler. Warum malst du? fragen mich die Videokünstler. Warum photographierst du? fragen mich die Zeichner. Warum zeichnest du? fragen mich die Musiker. Warum machst du Musik? fragen mich die Schreibenden. Warum schreibst du? fragen mich die Maler.
Gegenfragen: bist du ein Pinsel? Bist du eine Kamera? Bist du ein Klavier? Bist du ein Schreibstift?
Wer mit unterschiedlichen Mitteln arbeitet, kann auch mal danebengreifen. Man ist nicht überall gleich gut - und braucht es auch nicht zu sein. Das Entscheidende ist, dass man beweglich bleibt, sich nicht auf die Mittel fixiert, die ja nur Mittel sind, Vehikel, Hilfswerkzeuge. In der heutigen Kunst werden die Mittel masslos überschätzt, trotz Multimedia, Crossover und der an Kunsthochschulen geförderten Theorielastigkeit. Da es keine Stilrichtungen mit entsprechenden ästhetischen Gruppenzugehörigkeiten mehr gibt, kann man die Künstler nur noch schubladisieren, indem man sie mit ihren Werkzeugen identifiziert. Wer malt, ist Maler. Wer Videos macht, ist Videokünstler. Als ob es auf die Werkzeuge ankäme! Als ob es drauf ankäme, auf irgendeinem Gebiet der absolute Könner zu sein, ein Artist oder Akrobat, der die Fähigkeit besitzt, auf seiner Nase ein Sofa zu balancieren. Natürlich ist dieser Artist auf seine Darbietung spezialisiert, Übung macht den Meister. Aber macht ihn das schon zum Künstler? Nach dieser Logik müsste jeder Wettkandidat von "Wetten dass..?" ein Künstler sein.
Spezialisten nerven. Mit dreister Selbstgefälligkeit heften sie sich die gängige Norm für Können und Begabung wie einen Orden an die Brust. Ich weiss, wir leben nun mal in einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Dabei gibt es Leute, die sich nicht spezialisieren können. Zum Beispiel Synästhetiker. Synästhetiker sind Leute, die die Welt mit vertauschten Rezeptoren wahrnehmen: sie riechen Klänge, hören Zahlen und sehen Formen als Farben. Das Phänomen entsteht durch falsch verknüpfte Hirnsynapsen und ist eigentlich eine Behinderung, wenn auch eine harmlose. Hin und wieder kann sie sogar nützlich sein. Wenn es um die Fähigkeit geht, Ideen zu liefern und Assoziationen herzustellen, verschafft sie einen natürlichen Vorsprung. Der Synästhetiker übertrumpft jeden Brainstormer mit Leichtigkeit. Während der Brainstormer seine Cluster und Begriffsketten skizziert, um aus ihnen irgendetwas Originelles auszusieben, braucht der Synästhetiker bloss in den Himmel zu gucken - und er sieht (oder hört oder liest) genau das, was ihn weiterbringt. Zahlen, Buchstaben, Farben, Wörter, Bilder und Klänge verzahnen sich bei ihm automatisch ineinander, das heisst: ohne sein Dazutun. Er muss überhaupt nichts suchen oder aussieben. Mühelos kommt er vom Hölzchen aufs Stöckchen. Andererseits fällt es ihm schwer, sich auf eine einzige Sache zu beschränken. Somit ist seine Stärke auch eine Schwäche. Selbst bei so genialen Synästhetikern wie Goethe oder Leonardo da Vinci ist diese Schwäche offenkundig. Beide haben sich unglaublich aufgefächert und dabei sehr viel Stückwerk, Klimbim und Pfusch produziert. (Nebst den Meisterwerken, die wir alle kennen). Natürlich rede ich hier über Ausnahmeerscheinungen, der normale Synästhetiker verfügt nicht zwangsläufig über eine "kreative Begabung", im allgemeinen ist seine Fähigkeit so belanglos wie freihändiges Velofahren oder willentlich herbeigeführtes Rülpsen.
Die Sonne rollt westwärts, und immer neue Wälder tauchen vor mir auf. Das Innere dieser Wälder ist dunkel und leer. Tannen, dazwischen ein paar Buchen, die noch kaum ihre Blätter entfaltet haben. Hinter dem schmutzigen Balkonfenster eines Waldhauses taucht plötzlich ein Gesicht auf, schneeweiss, uralt, voller Runzeln. Schräg hängt die Zunge aus dem Maul, ein rohes Stück Fleisch. Als ich nochmals hinschaue, ist das Gesicht verschwunden. Noch lange rätsle ich darüber, was ich da gesehen habe. Mensch oder Tier?
In den Gebüschen tropft es; durch das spärliche Blattwerk schimmert ein viereckiges Gebäude, in welchem ein Umformer oder Generator geheimnisvoll vor sich hinsummt. Die abgelegensten Häuser werden heutzutage mit Strom versorgt, notiere ich in mein Notizbuch, es ist erstaunlich. Es ist wie in den Märchen, wo das Tischlein sich selber deckt, der Esel Golddukaten scheisst und der Eimer von alleine in den Brunnen purzelt, um Wasser zu schöpfen. Die Wissenschaft hat uns erstaunliche Dinge beschert. Ich stecke das Notizbuch wieder in die Tasche. Bald bin ich oben auf einem schwarzen, feuchten Bergrücken. Ich schaffe den Aufstieg aus eigener Kraft, ohne Elektrizität. Als ich aus dem Wald trete, hat sich mein Körpergewicht um gefühlte zwei Kilo verringert. Die Aussicht ist herrlich.
Von einer Photographie erwarte ich, dass sie mir das Unwirkliche zeigt. Unbewusst ist diese Erwartung beim Angucken von Photos wahrscheinlich immer dabei. Und schon der Photograph hegt diese Erwartung, er möchte etwas zeigen, dass mit "blossem Auge" nicht zu sehen ist, er stellt den Sucher darauf ein, er fixiert das Unwirkliche. In der Anfangszeit der Photographie hat man mit Verblüffung festgestellt, dass man mit einer Photokamera den dubiosesten Erscheinungen eine fixierte Gestalt geben kann. Man hat Geister photographiert, Schemen, die an irgendeinem Fenster erscheinen oder eine Treppe hinabschweben. Meistens sind solche Aufnahmen unbeabsichtigt entstanden. Man hat etwas anderes photographieren wollen, etwa ein Blumenbeet, und erst nach dem Entwickeln hat man festgestellt, dass da auf den Blumen ein Geist herumtrampelt. Dieses Bündnis zwischen der Photographie und dem, was kaum sichtbar ist, liegt in der Photographie selber begründet. Die Photographie, die ja auf einer technisch-visuellen Ebene etwas realisiert, das einem Geisterphänomen sehr nahe kommt, gibt nicht das Reale, sie gibt das Fiktionale. Das Nessie ist vielleicht nur ein morscher Baumstrunk, der hin und wieder zur Wasseroberfläche hochsteigt, sich dort zweimal umdreht und mit ein paar Luftbläschen wieder absinkt. Aber wen kümmert das? Ist das Monster deswegen weniger existent? Sind die Leute, die es photographieren, Betrüger? Wenn ich als Photograph etwas abbilde, so ist das, was ich vor der Linse habe, nicht zwingend das, was ich meine. Hier gibt es eine Differenz. Wenn ich ein Abbild mache, ziele ich nicht auf das abgebildete Objekt. Ich reproduziere es nicht, ganz im Gegenteil, ich vernichte es und ersetze es durch etwas Neues. Genauso verhält es sich auch im Grossen. Jede künstlerische Umformung und Aneignung realer Gegebenheiten weicht nicht nur von der Realität ab, sondern ersetzt sie vollständig durch eine eigene Realität, eine Parallelrealität. Oft kommen hier Missverständnisse auf. Die Leute glauben immer, der Künstler würde etwas reproduzieren, sozusagen einen Weltausschnitt vorführen. Nein, genau das tut er nicht! Obwohl ich mich derzeit unablässig mit dem Gebempengebiet befasse, ist meine Arbeit keine Dokumentation. Ich bin kein Wissenschaftler, ich bin Künstler. Das Gempengebiet könnte auch Gümplengebiet heissen und im Lande Phantasien hinter den sieben krummen Bergen liegen. Es geht mir nicht um das Gempengebiet, mein Ziel ist nicht die Wiedergabe oder Bestätigung dessen, was ist. Die Realität hat man ohnehin, sie darzustellen, ist überflüssig. Wenn Kunst überhaupt einen Sinn hat, dann liegt er in dieser Verschiebung. Ich könnte meine Absicht auch schlichter ausdrücken, sie an der Kognition festmachen. Indem ich durch die Landschaft gehe, erschliesse ich sie meinem Vorstellungsvermögen. Klingt das paradox? Kann man sich nur etwas vorstellen, das man nicht vor Augen hat? Ich glaube nicht.
Ein plötzlich pfeifender Wind durchpflügt die Wiesen, die auf dieser Höhe noch gelb sind. Die Höhe ist karg, gefrorene Kuhfladen, gebleichtes Gras und Maulwurfshügel, sonst nichts. Unter hektisch ziehenden, seltsam zerrissenen Wolken marschiere ich weiter. Es geht auf und ab. Zum Glück ist der Weg so angelegt, dass man weder klettern noch auf dem Hosenboden rutschen muss. Plötzlich bin ich wieder unten im Tal. Über jedem Tal, jedem Tälchen, das sich im Schatten seiner geologischen Vertiefung dahinwindet zu einer Felsgrotte, einer plätschernden Quelle, erhebt sich die Stirnwand einer Ruine. Direkt über mir ragt ein solches Gemäuer in den Himmel. Ich brauche nur in die Hände zu klatschen, und aus den Scharten und Nischen flattern Krähen heraus.
Auf einem Baumstumpf liegen drei Haselnüsse. Sie stecken in einer Rille, die sich kaum daumenbreit durch die Schlagfläche des Holzes zieht. Jemand muss die Nüsse absichtlich hierhin getan haben. Die Platzierung ist einfach zu absichtsvoll, als dass man sie einem Zufall zuschreiben könnte. Die Nüsse liegen schön regelmässig verteilt in der Rille, aber nicht so tief, dass sie darin verschwinden. Sie schauen noch ein gutes Stück heraus, sind also so hingelegt, dass man sie sehen kann. Trifft man, wie es hier der Fall zu sein scheint, auf eine Anordnung, die keinen ersichtlichen Zweck hat, aber dennoch eine bewusste Handlung voraussetzt, dann wundert man sich darüber, dass so etwas überhaupt gemacht wurde. Wozu dieses Arrangement? Wenn der Zweck nicht ersichtlich ist, heisst das noch lange nicht, dass es keinen gibt. Man könnte den Zweck nun ziemlich voreilig daran festmachen, dass man die Nüsse sieht. Aber das wäre eine Tautologie. Wenn ich sehe, dass jemand eine weisse Fahne schwenkt, und daraus ableite, dass dieser Mensch die Absicht verfolgt, ein Stück weisses Tuch sichtbar zu machen, so habe ich damit noch nichts festgestellt. Zum Glück ist das Denken so angelegt, dass es tautologische Kurzschlüsse vermeidet. Ich gehe automatisch davon aus, dass die weisse Fahne geschwenkt wird, weil mir (oder sonst jemandem) etwas mitgeteilt werden soll. Diese Möglichkeit ziehe ich zumindest in Betracht. Ich wäge sie gegen jede andere Möglichkeit ab, etwa die Möglichkeit, dass da jemand sein Bettlaken ausschüttelt und gar nicht daran interessiert ist, mich auf sich aufmerksam zu machen. Dass die Absicht, eine Botschaft zu übermitteln, nicht deren alleiniger Inhalt sein kann, versteht sich normalerweise von selbst. Zweifellos sollen die Nüsse gesehen werden. Aber dies erklärt noch nicht wozu, und genauso wenig erklärt es, warum die Nüsse genau auf die Art arrangiert sind, wie sie nun einmal daliegen, – und nicht sonstwie. Alles deutet auf ein Zeichen hin. Es sind drei Nüsse. Die Dreizahl erscheint immerhin bedeutungsvoll: märchenhaft. Wer denkt da nicht an die drei Wünsche, die drei Brüder, oder an so geläufige Redewendungen wie: „Aller guten Dinge sind drei“? Aber selbst wenn man diese Reminiszenzen mal ausblendet und beschliesst, sich an die nüchternen Tatsachen zu halten, kann man die Vermutung nicht ganz von der Hand weisen, dass die Dreizahl eine Konfiguration darstellt: dass also die Nüsse mehr oder weniger gleichgültig sind. Nach dieser Lesart wären sie nur das Material, das sich zu einem Zeichen fügt, und nicht das Zeichen selbst. Die Konfiguration könnte auch aus Steinen oder Gräsern zusammengesetzt sein. Die Dreizahl könnte ein verschlüsseltes Zeichen sein, eine Art Rune oder Wegmarkierung. Aber dann fällt mir auf, dass in der Nähe nirgends ein Haselstrauch zu sehen ist. Also sind die Nüsse vielleicht doch keine Zufallswahl. Wer immer sie aufgelesen und auf den Baumstumpf gelegt hat, hat sich für Nüsse entschieden – und nicht etwa für die Steinchen oder Bucheckern, die in der Umgebung des Baumstumpfs massenhaft herumliegen. Meine Runen-Theorie muss also falsch sein: das Zeichen, wenn es denn eines ist, verfügt über die Nüsse nicht wie über ein x-beliebiges Bausteinchen. Das Zeichen spricht etwas aus, das ganz eindeutig mit Nüssen zu tun hat. Ich überlege mir, was das sein könnte, und ich merke, dass ich mir die wesentlichste Frage noch gar nicht gestellt habe, die Frage nämlich nach dem Empfänger. Richtet sich das Zeichen an einen bestimmten, zum voraus instruierten Empfänger? Oder richtet es sich an den Nächstbesten? Einen Ahnungslosen? Im ersten Fall hätte ich keine Chance, das Zeichen jemals entschlüsseln zu können. Mir fehlt der Code. Es bleibt mir gar nichts anderes übrig, als diesen Fall auszuschliessen. Ich nehme auf gut Glück an, dass die Nüsse etwas Allgemeinverständliches zur Mitteilung bringen: etwas relativ Allgemeinverständiches. Diese Erklärung halte ich für die natürlichste, die naheliegendste, sie ist einfach, und das Einfache sagt mir zu, weil es wahrscheinlicher ist als das Komplizierte. Eine Botschaft zu hinterlegen, die nur jemand verstehen kann, der über den entsprechenden Code verfügt, ist ein Unterfangen, das eine komplizierte Absprache voraussetzt, ein Agreement. Mit dieser Vorstellung mag ich mich nicht so recht anfreunden. Sie ist wenig plausibel, und deshalb ziehe ich es vor, die Nüsse als eine Botschaft zu interpretieren, die keine Absprache voraussetzt. Sie ist an jedermann oder auch an gar niemanden gerichtet. Es ist der alte Sherlock-Holmes-Trick: man nehme das Wahrscheinliche, das unmittelbar Einleuchtende, als faktisch gegeben und verwerfe das Unwahrscheinliche. Indem man sich von Ballast trennt, das Spektrum der Möglichkeiten und Annahmen immer mehr einengt, kommt man der Wahrheit schrittweise näher. Wilhelm von Ockham hat das so formuliert: „Kann etwas mit weniger Annahmen erklärt werden, sind mehrere Annahmen unsinnig.“ Sobald ich die komplizierten Vermutungen rund um kryptische Botschaften und geheime Absprachen weglasse und mich voll und ganz auf die Nüsse konzentriere, wird alles viel einfacher. Ich lasse das Zeichen so stehen, wie es ist, und wende mich der unstrittigen Tatsache zu, dass jemand die Nüsse gesammelt hat. Ein guter Ausgangspunkt. Ich versuche mich in diesen Menschen hineinzudenken; damit fällt vielleicht ein gewisses Licht auf die Motivation, die dazu geführt haben könnte, dass die Nüsse nicht klammheimlich in einer Tasche verschwunden sind. Wer tut so etwas? Wer sammelt Dinge und legt sie aus? Wer behandelt sie als Schätze und Opfergaben, die man darreicht, weitergibt, verschenkt? Ich denke da zuerst einmal an Kinder, ja es müssen Kinder gewesen sein. Kinder sammeln Schneckenhäuser, Steinchen, Teufelszähne – und wohl auch Nüsse. In dem Bild von den Kindern, die im Wald die unscheinbarsten Dinge aufsammeln und auf einen Altar legen, stimmt alles zusammen. Und damit habe ich auch die Erklärung für den Baumstumpf: er dient als Altar oder Gabentisch. Ein Kind – gehen wir der Einfachheit halber davon aus, dass es nur eines gewesen ist, ein Einzelkind – hat Nüsse gesammelt. Es hat aber diese Nüsse nicht alle behalten wollen, und so hat es die drei zuerst gefundenen Nüsse auf den Baumstumpf gelegt, vielleicht aus dem naiven Bedürfnis heraus, den Waldgeistern, die ihm zu dieser Ernte verholfen haben, ein kleines Opfer darzubringen. Klingt das unplausibel? Zuerst habe ich gedacht, diese Erklärung sei wohl doch etwas zu weit hergeholt, sie leistet eigentlich nichts anderes, als dass sie das Unerklärliche der Erscheinung (drei Nüsse auf einem Baumstumpf) in das Innere eines Kindes verlegt. Ein billiger Trick, könnte man sagen: in der Phantasiewelt des Kindes löst sich jede Unwahrscheinlichkeit auf, alles kann dort eine hinreichende Begründung finden. Dennoch will ich diese Erklärung gelten lassen, sie hat etwas für sich, sie bedarf keiner Ergänzung. Hauptsache ist ja, dass man die Beweggründe des Kindes nachvollziehen kann. Mit Hilfe meiner Hypothese kann man wirklich verstehen, was in dem Kind möglicherweise (mit aller Wahrscheinlichkeit) vorgegangen ist, und damit hat man eine brauchbare Hypothese, auf die man, falls man überhaupt das Bedürfnis haben sollte, jemanden in die Geschichte einzuweihen, mit einem wissenden, aber auch etwas vagen Lächeln verweisen kann. Eine Hypothese ist ja nur eine Hypothese. Was wissen wir schon? Letztlich gibt es für nichts, aber auch gar nichts in der Welt eine Erklärung. Die Welt ist dunkel, und die Lichter, mit denen wir sie zu erhellen versuchen, verlöschen beim leisesten Luftzug.
Ich springe über ein Kuhgatter. Bespritze mich mit Dreck. In buckligen Wellen heben sich Weiden und Waldrücken, tanzen blassbläuliche Hügel vorüber. Dörfer tauchen auf und verschwinden hinter Bauminseln. Die frischen Schollen glänzen glasglatt. Die umgepflügte Erde riecht ranzig. Hie und da flitzt eine Libelle vorüber. Jede Pfütze ein Tümpel, ein Laichplatz, das Wasser brodelnd wie eine Suppe, unendlich viele, etwa haselnussgrosse Kaulquappen wimmeln darin, schnappen nach Algen, Blättern, Moosfasern. Ich blicke in den Himmel. Wolken wachsen herab, schwarz hängen sie durch.
Ich komme in eine Maria-Grotte. Sie liegt direkt am Wegrand, eine katholische Klause mit Kerzen, Marienstatue, Opferstock und Blumen. Kitschig wie ein Kosmetik-Salon. Aber dennoch ein Ruheort, ein Ort der Kontemplation. Man kann sich hier einer Seelenmanikür unterziehen.
Ich gerate etwas weit westwärts. Ich habe immer diesen Drall nach Westen, wie die Sonne.
Der Himmel ist grau, absolut flach und grau, ohne jegliche Farbe oder Schattierung. Man spürt die Regenlast, die dort oben gespeichert ist, man spürt die Schwere der Luft. Ich bin in grosser Besorgnis, weil ich keinen Regenschutz dabei habe. Aber was will man? Kommen wir nicht schon nass auf die Welt?
Aus einem Waldhäuschen dringen Stimmen: Wanderer vermutlich, die sich vor dem drohenden Regen in Sicherheit gebracht haben. Dem Lärm nach ist das Häuschen voll besetzt. Wäre es leer, ich würde sofort hineingehen und den Regen abwarten. Da ich jedoch ungern in eine geschlossene Gesellschaft eindringe, haste ich weiter in der Hoffnung, baldmöglichst ein Dorf zu erreichen. Und der Himmel belohnt mich. So sehr ich mich auch beeile, der Regen bleibt aus.
Auf einer Weide, schräg gegen den Abhang gestemmt, steht eine Kuh, aus ihren Mundwinkeln läuft grüner, blasiger Schleim. Halb im Morast eingesunken, steht sie da wie ein grosses, eckiges, goldrot geflecktes Sofa. Eine gewöhnliche Kuh. Ist es nicht seltsam, geradezu absurd, dass ich dieses Geschöpf für beschränkt halte? Dass ich es bemitleide? Ich sollte es beneiden, nicht bemitleiden. Eine Kuh, wenn sie Gras frisst und Milch produziert, erreicht das Höchste, was einer Kuh möglich ist. Eine Kuh vollbringt das Gleiche wie ein Forscher, ein Künstler, ein Dichter. Sie ist schöpferisch, sie ist produktiv, sie weidet die Welt ab, sie verwandelt Gras in Milch.
Der Wald über der Wiese ist voller Stimmen, Vogelstimmen. Ich wische mir den Schweiss ab, ich höre ein Brummen, und ich wende den Kopf weg von der Kuh, weg vom Wald, in die andere Richtung. Auf der Karosserie eines dahinholpernden Traktors, der mit seiner angehängten Pflugschar die schwere, speckige Erde umwühlt, glänzt das Licht wie auf einem vergoldeten Cadillac, aufrecht aufgebockt der Bauer, die eine Hand im Hosensack, die andere am Steuerrad. Er raucht einen Stumpen, das heisst: der Stumpen ist erloschen, und der Bauer saugt durch den Stumpen die eisige Luft ein. Er nickt mir zu, während er den Traktor um einen Baum manövriert, wippend wie auf einer Schaukel. Zwei Stunden später bin ich schon in Hemdsärmeln, die Jacke habe ich über die Schulter geworfen.
Könnte ich mir ohne Rücksicht auf materielle oder finanzielle Aufwendungen einen Wunschtraum erfüllen, so würde ich diese ganze Landschaft in Modellform nachbauen, etwa in der Grösse einer Stube, eine Art Modelleisenbahn, nur ohne Eisenbahn: auf Strassen und Wegen könnte man Figürchen hin und her bewegen. Und überall würde ich kleine versteckte Lautsprecher einbauen mit Kuhglockengebimmel und dem Dröhnen von Kettensägen.
Kettensägen erzeugen Musik. Ich liebäugle mit dem Gedanken, eine Symphonie für Kettensägen zu schreiben. Der Dirigent müsste aussehen wie der Irre aus "Chainsaw Massacre".
Auf dem Bergsattel wird der Weg morastig, ich steige in ein steiles Waldtal ab. Der Himmel ist schwarz, die Luft seltsam unbewegt. Eine Totenstille liegt über dem Wald, nichts rührt sich. Meine Schuhe sind schwer vom Schlamm. Ich erinnere mich an einen Friedhofsbesuch, als die Wetterlage ähnlich war wie jetzt: man hat dort die Toten gerochen. Es war fast so peinlich wie Fussgeruch.
Bauern besprühen ihre Obstbäume. Sie verrichten diese Arbeit meistens zu zweit. Einer hält die Brause ins Geäst hinauf, und der andere sitzt auf dem Traktor und überwacht den Tank, aus dem das Gift gepumpt wird. Im Vorübergehen bekomme ich auch etwas ab von den Pestiziden. Ich öffne den Mund, eine Mundspülung, das ist gut gegen Karies.
In letzter Zeit habe ich einige Abfallkübel und Robidog-Kästen photographiert. Ich werde noch ein typischer Kunststudent der HGK Basel.
Gewisse Leute werfen mir vor, ich sei zu konservativ. Zu wenig experimentierfreudig. Ich male Blumen. Ich plädiere für die Scholle und das gesunde Volksempfinden. Ich betrachte Sonnenuntergänge. In meiner Stube habe ich ein Bild mit röhrenden Hirschen aufgehängt. Und ich stimme bei jeder Abstimmung für die SVP, egal, worum es geht. An der Hochschule kommt das natürlich nicht immer so gut an. Dabei bin ich der einzige in unserer Klasse, der jeden Tag pünktlich zum Unterricht erscheint. Dafür sollten mir die Professoren dankbar sein. Auf diesen Künstler ist Verlass!
Wenn ein angehender Kunstpädagoge aus der Abteilung "Lehramt für Bildende Kunst" einen Vortrag hält, benutzt er dazu eine Menge Sudelnotizen, die er kaum entziffern kann und die er zum allem Überdruss auch noch in die falsche Reihenfolge gebracht hat. Also fängt er einfach an zu improvisieren, und so klappt es dann doch. Ganz anders sieht es beim Studenten aus der Abteilung "Visuelle Kommunikation" aus. Der angehende Designer oder Grafiker bringt seinen Vortrag mit Power Point perfekt über die Bühne. Zu guter Letzt noch der Student aus der Kunstabteilung. Wenn der einen Vortrag halten soll, kann man auf ihn warten, bis man grün oder grau ist. Der Künstler braucht viel Schlaf.
Die verblüffendsten Funde, die ich verzeichnen kann, sind von Menschenhand gemacht. Und dennoch sind sie nichts, was man als Werk bezeichnen könnte. Bei ihrer Entstehung und Platzierung hat womöglich ganz entscheidend der Zufall mitgewirkt. In einer Landschaft, in der tausend Wege sich kreuzen, tausend Leben sich abgespielt haben und tausenderlei Arbeit verrichtet worden ist, sammelt sich im Laufe der Zeit eine Masse von Trödel an. Das Theaterstück ist vorbei, aber die Requisiten stehen immer noch herum. Sie bezeugen eine mit Geschichten angefüllte Vergangenheit, die längst verstummt ist. Diese Dinge sind aus der Zeit herausgefallen, und niemand kann sagen, was sie hier noch verloren haben. Es wäre im übrigen kaum vorstellbar, dass sie irgendein Interesse erwecken könnten, nicht einmal im negativen Sinn. Da sie sich grösstenteils harmonisch in ihre Umgebung einfügen, kommt niemand auf die Idee, sie beiseite zu schaffen. Sie bleiben einfach da, wo sie scheinbar schon immer gewesen sind. Zum Beispiel dieses stark verrostete, länglich gebogene Eisengebilde, vermutlich von einem Bauer am Wegrand deponiert. Es bleibt hier deponiert, weil es kaum wahrgenommen wird. Es stört niemanden. Es scheint uralt zu sein. Geschützt durch den Umstand, dass es an einem ruhigen und abgeschiedenen Ort deponiert wurde, bewahrt es sich eine gewisse Unauffälligkeit. Seltsam, wie so ein Ding mit seiner Umgebung verschmilzt, in ihr aufgeht. Es ist von hier nicht wegzudenken, obwohl oder gerade weil niemand die Aufmerksamkeit mit herbringt, es für sein Vorhandensein zur Rechenschaft zu ziehen. Wer weiss, wieviele Leute schon an ihm vorübergegangen sind, ohne es auch nur eines einzigen Gedankens zu würdigen. Die Verwitterung, aber auch die augenfällige Funktionslosigkeit (wozu könnte es gedient haben?) lassen es bis einem bestimmten Grad zu einem Stück Natur werden. Ein Rest von Künstlichkeit bleibt. Ein Kontrastfaktor, der sich als etwas Sinnloses zu erkennen gibt. Jede Maschine wird ja früher oder später sinnlos, weil sie von neuen Maschinen überholt und verdrängt wird. Jedes Gerät verwandelt sich früher oder später in eine kaum noch handhabbare Kuriosität. Mit jedem Erzeugnis aus Menschenhand entsteht auch ein Stück Sinnlosigkeit. Unter Opferung des Sinns, den wir in die Dinge hineinlesen und aus ihnen herausholen, kommen wir vorwärts, streben wir dem Ziel einer totalen Perfektion entgegen. Die Sinnlosigkeit des zurückgelassenen Materials häuft sich indes immer mehr an, türmt sich zu einem Berg und wirft einen gewaltigen Schatten. Den haben wir nun die ganze Zeit im Rücken. Das dumpfige Dunkel, von dem Homer spricht, wenn er das Totenreich beschreibt, realisiert sich in den zurückgelassenen Dingen, den Abfallbergen, den Trödelkammern, den Brockenstuben. Dieses Dunkel lastet auf uns als das immer noch gegenwärtige Vergangene. Um davon eine Gänsehaut zu kriegen, braucht man kein Totenreich zu betreten. Ja, nicht einmal eine Brockenstube. Ein Spaziergang genügt. Es genügt, durch eine Siedlung, eine Landschaft, eine Randzone zu gehen. Dort ist dieser Schatten immer mit dabei. Man bewegt sich durch ihn hindurch, den verschlungenen Wegen und Asphaltsträsschen entlang, wo die Siedlungen zerfransen, auseinandergehen und an wasserspeienden Felswänden auflaufen. Dort fürchtet man sich noch vor Blitz und Donner, tritt auf Maienkäfer und sitzt in der Beiz an schwarzen, fettpolierten Eichentischen. Dort verliert sich auch das Menschliche, es wird ausgedünnt, es versickert in der Vergangenheit, im unzeitgemäss Gegenwärtigen. Auf dem Land ist der Schatten stärker als in der Stadt, denn das Land ist eine Trödelkammer, die selten gelüftet, noch seltener geräumt wird. In der Stadt gibt zwar viele gut restaurierte historische Bauten, aber wenig Vergangenheit. Sobald man ein Museum einrichtet, vertreibt man das Dunkel, rückt man der Vergangenheit zuleibe.
Auf engstem Raum falten sich hier die unterschiedlichsten Räume und Zeiten ineinander. Was auf der Karte so einfach und geordnet aussieht, ist in Wirklichkeit ein Weltraum, dessen Grösse jede Vorstellungskraft sprengt.
Das immergleiche Dorf, grosszügig in die Landschaft hineingebaut: Fertighäuschen, umgeben von Strassenbelag. Jedes Nebensträsschen so breit wie eine Autobahn. An den Trottoirs knallrote Hydranten. Die neuen Häuser sind schick und irgendwie enorm platzsparend, Solardächer. Zwei Kinder mit einem Fussball, aber es sind nur Laubsägefiguren, am Strassenrand postiert, um die Autofahrer zur Vorsicht zu mahnen. Die Kinder fehlen, die kindersichere Strasse muss ohne Kinder auskommen. Zwei, drei Ziergärten. Alle anderen Gärten machen den Eindruck, als wären sie nur schwer zu bändigen. Aus dem gemähten Gras spriessen Gänseblümchen, auf einem Garagentor wächst Moos, in den halboffenen Schlitz eines mit Zeitungen vollgestopften Briefkastens zwängt sich eine Hummel. Sie surrt wie ein Rasierapparat. Wo sind die Menschen? Die Menschen sind unsichtbar, vielleicht existieren sie gar nicht: schauerlich und berauschend berührt mich die Vorstellung, alle Menschen wären auf einen Schlag verschwunden. Doch im Dorfkern höre ich durch ein offenes Fenster ein Radio. Und wo ein Radio läuft, da sind auch Menschen.
2004/05
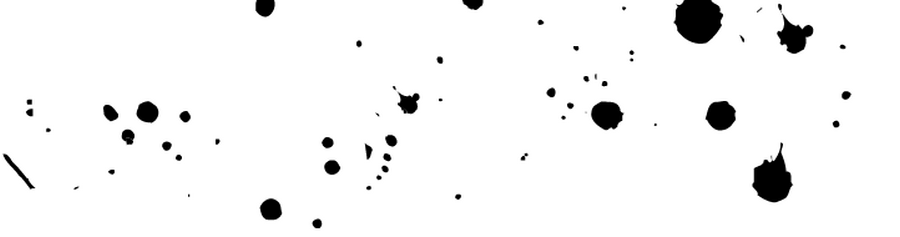 wörter
worte
wörter
worte