Ein Problem
Ich befand mich in meinen besten Jahren, war voll im Schuss, die Arbeit und alles ging mir leicht von der Hand. Zu klagen hatte ich nicht. Doch gab es ein Problem, das mich plagte. Es war so lächerlich, dieses Problem, und zugleich so aussichtslos, dass ich häufig lachen musste. Ein enervierend patziges Lachen war das. Wenn ich lachend ein öffentliches Gebäude betrat, komplimentierte man mich lachend hinaus. Lachen ist ansteckend, das weiss man ja; es springt von Zwerchfell zu Zwerchfell, und im Nu schüttelt es einen durch. Jeder, der mich lachen sah, lachte automatisch mit, wurde dann aber doch stutzig: mein Lachen war anders. Ich lachte an meinem Mund vorbei, es war eigentlich kein Lachen, es war eher ein läppisches und unkontrolliertes Auspressen von Luft. Und vor allem war es nicht lustig. Es war ein Problem. Ein Problem, so aussichtslos, dass ich häufig lachen musste.
Jagdvorstellung
Die Jäger tanzten um den erlegten Bären herum wie Schulbuben. Sie stiessen ein Freudengeheul aus. Als den Zuschauern klar wurde, dass der Bär nicht wirklich tot war und nicht tierischer als eine Wolldecke, man staune, eine blosse Pelzimitation hatte die Tierleiche abgegeben, in der ungedämpften Schlussbeleuchtung war die Künstlichkeit kaum zu übersehen, da schloss sich der Bühnenvorhang und das Freudengeheul verstummte. Die Tierschützer applaudierten. "Grosse Kunst!" riefen sie. "Grosse Kunst!"
Kopfstand
Dann und wann, nicht sehr oft, aber immer öfter, fühle ich mich in der richtigen Stimmung für einen Kopfstand. Ich stütze mich auf die beidseits des Kopfes flach an den Boden angepressten Hände, stosse mich ab und drücke die Bauchmuskeln durch. Es geht ohne Wand, bei mir geht’s immer ohne Wand, auf meine Kräfte ist Verlass. Ich bringe die Füsse ohne weiteres in die Luft und kann mich dann halten, freistehend, es gelingt vorzüglich. Wie lange ich oben bleibe? Oh, da fragen Sie mich was. Zwei Stunden, fünf Tage, je nachdem. Wenn es in meine Nasenlöcher regnet, muss ich aufhören.
Der Einbrecher
Wollen Sie im Ernst, dass ich schreie? fragte sie, als der unbekannte Mann mitten in der Nacht vor ihrem Bett auftauchte. Sie war hellwach. Es war kein Traum. Sie presste sich an die Wand, die Finger in die Bettdecke gekrallt. Die Frau zitterte am ganzen Körper. Aber wie denn das? Es war doch gar nicht kalt. Der Mann zog sich seinen Schal fester um den Hals. Ein bisschen kalt war’s schon. Das Fenster, durch das er hereingestiegen war, stand sperrangelweit offen. Aber die Frau übertrieb, fand er. Sie erschien ihm überhaupt etwas seltsam. Mit ihren schreckgeweiteten Augen versuchte sie ihn auf Abstand zu halten. Der Mann zuckte die Schultern. Naja Frauen, dachte er. Zuerst wollte er sich einen Stuhl nehmen, dann aber überlegte er es sich anders. Er setzte sich auf die Bettkante. Dort war es schön weich. Er verlangte einen Magenbitter. Die Frau reagierte nicht. Er fand das unnatürlich. Irgendetwas mit ihr stimmte nicht. Einen Augenblick lang fürchtete er, sie würde ihre halbherzige Drohung doch noch wahrmachen und die Nachbarschaft alarmieren. Doch die Frau blieb still. Sie blickte ihn nicht einmal mehr an. Sie hatte sich die Bettdecke über den Kopf gezogen. Sie atmete ruhiger. Die Bäume vor dem Fenster raschelten auf einmal etwas lauter, und ein Windhauch bewegte die Vorhänge. Weiss und voll stand der Mond über dem Nachbarshaus.
Früh am Morgen
Früh am Morgen mache ich mich auf den Weg. Ich zwinge mich dazu. Das fällt mir leicht. Es ist ein freiwilliger Zwang, dem ich mich da unterwerfe, ein Freudenzwang. Weiter als bis zum Vorgarten schaffe ich es freilich nie. Doch was sage ich da überhaupt? Eigentlich ist die Wohnungstür schon die äusserste Grenze meines täglichen Vordringens, und ich weiss, es ist sinnlos, ein Kraftaufwand für nichts, wohin sollte man so früh am Tag auch gehen? Um fünf oder sechs sind die Strassen noch künstlich beleuchtet und fast völlig verlassen, selbst die Zeitungsausträger liegen zu dieser Unzeit noch im Bett. Rasch ausschreitend, mit schwingenden Armen, eile ich durch den Hausflur, strecke die Hand nach dem Türgriff aus, mein Hemdkragen ist gestärkt, meine frisch rasierten Wangen duften nach Lavendel. Erreiche ich die Tür, ist das schon sehr viel. Ich bin dann so stolz, dass ich es gar nicht mehr über mich bringe, auch nur einen Schritt über die Schwelle zu tun. An der Schwelle zum Vorgarten bleibe ich stehen. Ein Zuviel oder Zuweit könnte alles kaputtmachen.
Die Krankheit
Über die Menschen war der Ausnahmezustand verhängt. Sie erkrankten während der Arbeit oder beim Angeln, im Stadtpark oder im Auto, am Zeitungsstand oder im Kino, häufig auch mitten in der Nacht. Sie erkrankten an allen möglichen Orten und in allen möglichen Situationen und immer ganz plötzlich: von einem Atemzug zum andern war die Krankheit da und setzte sich im Körper fest. Wie die Ansteckung zustande kam, war ein Rätsel, daran wurde fieberhaft geforscht, ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Krankheit verbreitete sich mit der Geschwindigkeit eines Gedankens. Bald war sie überall, wo auch Menschen waren, sie lief den Menschen nach und lief ihnen voraus. Die Symptome waren immer ganz gleichartig. Gutartig waren sie nicht. Unter wiederholtem Frösteln stellten sich Kopfschmerzen ein, die sich rasch steigerten, Stiche in der Schläfengegend, dazu Übelkeit, Gerumpel im Bauch. Die Temperatur stieg innert Stunden bis über 40 Grad Celsius, ein heftiger Frost und Hitzeanfall trieb die Kranken ins Bett zurück, kaum hatten sie dieses verlassen, um Hilfe zu holen. An Hilfe war natürlich kaum zu denken, man musste ohnmächtig zusehen, wie die Krankheit ihren Lauf nahm. Mit steigendem Fieber befiel die Kranken ein grosses Müdigkeitsgefühl, vorwiegend in den Händen. Dazu traten Schmerzen in den Muskeln und in den Beckengelenken auf. Die Kranken hatten das Gefühl, schwer krank zu sein, und tatsächlich waren sie es auch, gewissermassen, es ging ihnen schlecht, man sah das, eine Gesundheitsstörung lag vor. Die Lage war bedauerlicherweise so, dass niemand genau wusste, womit man es da zu tun hatte. Die Krankheit hatte noch nicht einmal einen Namen. Man nannte sie deshalb einfach Krankheit. Die Krankheit, sagte man, und alle wussten, dass damit nicht Heuschnupfen gemeint war. Ich bin krank, sagte dieser oder jener bleichgesichtige Patient, und die Leute, die sein Bett umstanden, erschraken. Die Ärzte waren ratlos, schüttelten die Köpfe, putzten ihre Monokel, packten etliche Medikamente aus und wieder ein und gerieten, als dann die ersten Opfer zu beklagen waren, in die allgemeine Kritik. Wir haben die Krankheit weder erfunden noch in Umlauf gebraucht, rechtfertigten sich die Ärzte, wir bekämpfen sie nur. Sie rieten davon ab, in überheizten Stuben zu hocken, und auch die Kälte war ihnen suspekt. Nach verschiedenen Richtungen hin beleuchteten und beschrieben sie die Symptome, und es kam immer das Gleiche dabei heraus. Die Symptome waren immer ganz gleichartig. Nicht aber die Kranken. Die starben oder auch nicht. Manche wurden von alleine wieder gesund, und die Ärzte waren besorgt, weil es ihren Prognosen widersprach. Was die Ursachen der Gesundung betrifft, so hat man darüber noch nichts Konkretes erfahren können, obwohl entsprechende Erkenntnisse vorliegen, die Berichterstattung wird sich zu gegebener Zeit damit befassen müssen.
Eduards Hut
Eduard hat seinen Hut verloren. Der Wind hat den Hut vom Kopf geblasen. Also, da hört sich doch alles auf! Eduard ballt die Fäuste, seine Fäuste sind Kinderfäuste, aber schütteln kann er sie trotzdem. Das mit dem Hut, das lässt er sich nicht gefallen. Er muss den Hut wiederhaben. Eduard grübelt darüber nach, versucht sich an alles zu erinnern, was in irgendeinem Zusammenhang mit dem Verschwinden seines Hutes stehen könnte, und er wird ganz traurig darüber, dass er das nicht mehr zusammenbekommt. Wann und wohin ist sein Hut eigentlich verschwunden? Mit dem Wind ist es halt so eine Sache. Eduard grübelt. Wenn er doch nur wüsste, wo suchen. Ja, wo suchen? Die Landschaft ist gross, alle Wege im weitesten Umkreis müsste er absuchen, alle Wälder, alle Flurstücke, alle Gärten, alle Vorplätze, alle Hinterhöfe, alle Wiesen und alle Felder. Für einen einzelnen Mann eine gewaltige Arbeit. Viel Vergnügen, Eduard, viel Vergnügen.
Steiners Gorilla
Er lebt nicht eingepfercht, nicht hinter Gitterstäben. Die Voraussetzungen für ein glückliches Gorillaleben sind hier zweifellos erfüllt. In den schönen, teppichbelegten Räumen des Hauses, das Steiner gehört, einem Mann, der sehr tierlieb ist und vermögend, Anlageberater und Gorillafreund, geniesst der Gorilla eine Freiheit, die seinem natürlichen Betätigungsdrang voll und ganz entspricht. Er kann tun, wozu er Lust hat, durch die Zimmer jagen, auf Lichtschalter drücken, Yoghurt essen, Kleider ein- und ausräumen, auf den Treppen und Polstermöbeln herumturmen... Steiners Gorilla hat es gut. Er hat viel Freilauf und immer genügend zu essen. Steiner, der als Anlageberater oft auf Reisen ist, überlässt seinem Gorilla das Haus ohne Bedenken. Noch nie hat der Gorilla etwas kaputt gemacht, noch nie hat er Anlass zu Beschwerden oder Klagen gegeben. Er ist ein Ausbund an Gemütlichkeit. Wenn er still und nachdenklich in einer Ecke hockt und mit seinen kleinen, schwarzen Augen die Polstermöbel betrachtet, die er ohne weiteres hochstemmen und herumschleudern könnte, ist er ganz mit sich im reinen. Aus eigenem und freiem Entschluss lieb zu sein, ist für ihn das Grösste. Er fühlt sich überlegen und in sich gefestigt. Über rohe Muskelkraft ist dieser Riese erhaben. Er könnte alles kaputtschlagen. Ja, das könnte er. Aber er tut es nicht. Stattdessen nimmt er von Zeit zu Zeit seine Barbie-Puppen hervor, um mit ihnen zu spielen. Ja, er spielt mit ihnen, und nicht etwa grob, sondern mit der allergrössten Behutsamkeit. Weder die Puppen noch das dazugehörige Spielzeug-Set stehen im richtigen Verhältnis zu den Händen des Gorillas, die riesig sind und schlechterdings nicht dazu gemacht, der Afternoon-Barbie das millimeterkleine Teetässchen an die Lippen zu drücken oder der Cinderella-Barbie die millimeterkleinen goldenen Schühchen überzustreifen. Aber gerade dieses Missverhältnis scheint den Gorilla zu amüsieren. Während andere Haustiere alles herunterreissen und ramponieren, was ihnen zwischen die Klauen, Tatzen oder Fänge gerät, spielt Steiners Gorilla friedlich mit seinen Puppen. Er geniesst es, seine Wildheit zu unterdrücken. Das nennt man Sublimierung.
2010
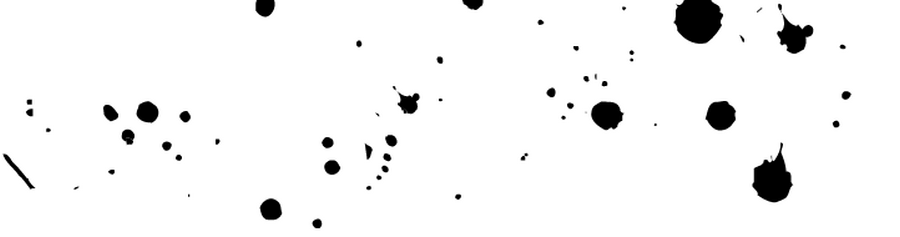 wörter
worte
wörter
worte