Santichlausenrallye
Der Ablauf steht fest, da gibt es nichts zu rütteln. Jeder
von uns fährt in seinem dunkelrot lackierten Fiat Bravo
in das Dorf, das wir ausgeknobelt haben. Dann geht es in
die Dorfbeiz, die in fast jedem Dorf gleich aussieht, die
gleichen rotweiss karierten Tischtücher, die gleichen
Bleigewichtsaschenbecher, die gleichen geriffelten
Streuzuckergläser, die gleichen Bierdeckelihalter aus
Plastik, die gleichen Ehrenpokale im gleichen Schaukas-
ten. Nach zwei oder drei Bierchen in geselliger Runde,
in der Regel trinken wir auch noch Glühwein und ver-
zehren eine Portion Hausgeschnetzeltes, machen wir uns
auf den Weg mit unsern schwingenden Bärten, unsern
Säcken, Glocken, Knotenstöcken, Ruten und Kapuzen-
mänteln. Zu Fuss. Alle sehen wir gleich aus. So geht es
jedes Jahr. Es ist immer das Gleiche. Das ist Brauch.
Acht Uhr abends. Ich bin schon am zweiten Bier. Zum
Glück habe ich keinen Glühwein bestellt. Bier hat den
Vorteil, dass es nicht kalt wird. In dieser Beiz, vor dieser
verblichenen Tapete, sollte die diesjährige Santichlau-
sentour ihren Anfang nehmen. Von hier aus sollten wir
durchs Dorf gehen, die Dienstroute abschreiten mit Sack
und Pack. Ich spähe durch die Gardinen. Draussen ist es
stockdunkel. Wo sind die andern? Meine Kollegen ha-
ben sich verfahren. Ich kann es mir denken. Ich spüre es.
Ohne die geringste geografische Ahnung sind sie ins
Kraut gefahren, wie man so sagt, mit nichts im Gepäck
als ihren zur Ausstaffierung der Santichlausenfigur not-
wendigen Säcken, Glocken, Knotenstöcken, Ruten und
Kapuzenmänteln. Sie klappern die Dörfer ab. Es sind
Millionen von Dörfern, keine Landkarte kann dieses
Gewimmel je vollständig erfassen, und das Verfluchte
ist, dass hier alles so schrecklich gleich aussieht: ein
Dorf wie das andere, besonders wenn man mit dem Auto
unterwegs ist. Hügel auf Hügel schiebt sich heran mit
Wäldern und komischen Dörfern mit komischen Namen.
Eine Gegend, in der alles austauschbar ist, jedes Detail
bis ins Endlose wiederholt wird. Keine Wüste könnte
monotoner sein. Ich habe es selber erlebt. Ich erlebe es
Jahr für Jahr. Ich kann mir denken, wie meinen Kollegen
zumut ist. Die Nacht umhüllt sie, ein dumpfes Dunkel,
das vor den Scheinwerfern zurückweicht und sich hinter
den Autos wieder zusammenschliesst zu einer schwarzen
Wand. Hinter uns, sagen wir Santichläuse, liegt der
Schwarzwald.
Santichläuse auf dem Weg zur Arbeit. Noch sind sie
eigentlich keine Santichläuse. Sie tragen weder Kutten
noch Bärte noch sind sie zu Fuss unterwegs. Sie stehen
noch mitten im motorisierten Zivilleben. Jeder von
ihnen, mich eingeschlossen, ist aufs Auto angewiesen.
Die Anfahrt ist lang. Es ist ein langer, ein langweiliger
Weg. Reflektoren huschen vorüber wie Luchsaugen. Die
gewundenen Strassen, die sich endlos von Hügel zu Hü-
gel schwingen, können überall oder nirgends hinführen.
Die Santichläuse, meine Kollegen, summen vor sich hin.
Manchmal verpassen sie eine Abzweigung oder schwen-
ken am falschen Ort jäh ab. Das geschieht schnell, blitz-
schnell, eine kleine Konzentrationsschwäche, ein nicht
abgeblendetes Gegenlicht, das die Buchstaben einer
Hinweistafel auslöscht, und schon ist es geschehen.
Ja, meine Kollegen, die Santichläuse. Angegurtet, reg-
los, die Hände am Lenkrad, schweigend: so fahren sie
durch die menschenleere Landschaft. Astronauten im
Weltall. Sie verlassen sich aufs Gefühl. Oder auf die
Technik, die ihnen vorgaukelt, sie seien leichter als Luft
und schneller als der Wind. Ja, Autofahren ist ein Kin-
derspiel, nichts im Vergleich zu dem, womit man sich
früher fortbewegt hat, den Pferden und Droschken, den
Eseln. Inzwischen hat sich einiges getan. Die Fortbewe-
gungsmethoden haben sich umgewälzt, die Geschwin-
digkeiten vervielfacht. Santichläuse sind motorisiert.
Den physikalischen Widerstand brechen sie mit einem
leichten Druck aufs Gaspedal. Vom Fahrtwind, der ge-
gen die Frontscheibe prallt, ist im Innern des Wagens
wenig oder gar nichts zu spüren. Im Innern des Wagens
ist man geschützt, man fährt so nebenher, ist sich des
Fahrens gar nicht richtig bewusst. Ohne mit der Wimper
zu zucken, setzt man sich durch gegen Luft und Schwer-
kraft, wälzt ein Schildkrötengehäuse voran, ein Tonnen-
gewicht. Distanzen schrumpfen, sie scheinen beherrsch-
bar. Fahren ist keine Kunst. Man kann es lernen. So wie
man eigentlich alles nur Denkbare lernen kann, voraus-
gesetzt, man hat den Willen dazu.
Ich sage das nur so dahin. Eine unüberlegte Randbemer-
kung zwischen zwei Bierschlucken. Selbstverständlich
kann man nicht alles lernen. Nicht alles ist beherrschbar.
Ich stelle mir folgendes vor: während die Autos fast alles
automatisch machen, (deshalb heissen sie ja Autos),
machen sich meine Kollegen in diesen Autos, einge-
schlossen wie Austern in ihren Schalen, innerlich frei,
sie trällern vor sich hin, lassen die Gedanken schweifen.
Am Anfang ihrer Fahrt, denke ich, sind sie noch ziem-
lich optimistisch. In ihren Autos ist es warm, gemütlich
wie in einer geheizten Bauernstube, in die Abgeschlos-
senheit des Fahrens dringt kein einziger Windhauch.
Meine Kollegen, die Santichläuse, brummen vor sich
hin. Sie üben die Santichlausenstimme, den unverwech-
selbaren Bass. Auf den geraden und ereignislosen Stre-
ckenabschnitten zwischen hier und der Stadt erlauben sie
sich, ihre Sitzhaltung ein bisschen zu lockern. Eine ent-
spannte Haltung lockert auch die Stimme. Das tiefe B
muss dröhnen. Sie lehnen sich zurück. Die Sitze sind
verstellbar, weich, plüschig, Kinosessel, in denen man
versinken möchte. Und das Armaturenbrett, wie das
blinkt und leuchtet! Elektronische Impulse jagen hin und
her, Ziffern und Lämpchen sprenkeln mit ihrem Wider-
schein die Frontscheibe. Ein kleines Raumschiff. Die
Kilometer spulen sich ab, es geht voran. Doch weit ge-
fehlt. Die Richtung ist falsch, die Ankunft verzögert
sich, und nach und nach kommen sie dahinter, dass sie
einem flüchtigen, aber fatalen Irrtum erlegen sind. Sie
haben sich verfahren. Die Route wird zum Problem, das
Fahren zum Alptraum. Ja, ich spüre da so eine Art Kom-
plikation, eine nächtliche Orientierungslosigkeit.
Da sitze ich nun. Alle Augenblicke sehe ich nach der
Uhr. Eigentlich müssten sie schon hier sein. Gewiss sind
sie noch unterwegs. Die Frage ist nur wohin. Sie folgen
dem unübersichtlichen Verlauf einer Strasse, die wo-
möglich die falsche ist, sie fahren und fahren, an den
immergleichen Häuschen und Masten vorbei, geradeaus
oder über Kurven, an gähnenden Schluchten oder hu-
schenden Wiesen entlang. Ich weiss, wie das ist, wenn
man durch diese Landschaft fährt. Das Fahren dehnt sich
wie ein Traum, aus dem es kein Erwachen gibt. Und
wieder ein Dorf, und wieder ein Hügel. Und...
Lausige Autofahrer sind sie, Blindfahrer. Nach dem
zweiten Bier darf ich das ja wohl sagen. Den Führer-
schein haben sie an der Tombola gewonnen. Ehrlich, ich
weiss nicht, wie man es anstellt, so schlecht zu fahren.
Nach einer Weile gemächlichen Dahinfahrens, das nur
dazu dient, die Spannung zu steigern, geben sie Gas. Sie
fahren wie die Säue, jeder möchte den andern beweisen,
dass er recht eigentlich zum Vergnügen Auto fährt,
zwanglos, und das motorisierte Unterwegssein als eine
Selbstverständlichkeit ansieht, die Genuss bereitet, und
da keiner hinter den andern zurückstehen will, die Rang-
ordnung ist umstritten, bildet sich innerhalb dieser ver-
schworenen Fahrgemeinschaft eine explosive Mischung
aus Kameradie und Konkurrenz. In dem blödsinnigen
Ehrgeiz, das Rennen zu machen, nehmen sie sich etwas
vor, das eigentlich unmöglich ist. Jeder will schneller
sein als die andern. Jeder will die andern übertrumpfen.
Die einzige Spielregel: keiner darf verlieren. Irgendwo
geht das nicht auf. Sie versteigen sich zu einem Unfug,
den man nur mitmachen kann, wenn man einer von
ihnen ist, ein Santichlaus. Das hat seine Logik. Sie füh-
len sich als etwas Besonderes, weil sie Santichläuse sind.
Jeder von ihnen gibt Gas wie eine motorisierte Vollsau,
lachend, bei angeschaltetem Radio, und reisst am Lenk-
rad herum, als ob das irgendwie biegsam wäre. So rasen
sie durch die Nacht, gestandene Männer, Schweizer
Bürger, TCS-Mitglieder, Familienväter, die sich einmal
im Jahr den Spass erlauben, sich in ruppige Santichläuse
zu verwandeln. Es wäre ja ein Wunder, wenn das immer
gut ausginge. Meine Kollegen sind berüchtigt dafür, dass
sie Autos demolieren, eigene oder andere. Halb so
schlimm. Was kaputtgehen kann, ist ersetzbar. Material-
schäden lassen sich ausbügeln. Das hat seine Logik.
Dennoch gibt es zweifelnde Einwände, Bedenken wer-
den geäussert. Die aus Leichtsinn, Eigensinn oder
Übermut resultierende Manövrierunfähigkeit hat schon
viele Diskussionen ausgelöst. Vor allem aber Kopfschüt-
teln. Darf ein Santichlaus solche Dummheiten machen?
Auch ich schüttle den Kopf. Ich bin einer von ihnen, ein
Santichlaus, und ich schäme mich dafür.
Wie immer geben sie ihr Bestes. Sie brettern die vielen
Kurven herauf wie die Wilden. Vielleicht sind sie aber
schon ausgestiegen und geistern draussen irgendwo
durch die Dunkelheit und suchen das schlecht erleuchte-
te Gasthofschild. Ich höre draussen Schritte. Santichlau-
senschritte? Ich drehe mich zur Tür. Da ist niemand. Die
Schritte entfernen sich. Meine Kollegen, denke ich, sind
an einen toten Punkt gelangt. Ich kann es mir gar nicht
anders denken. Vielleicht sind sie mehrmals im Kreis
herumgefahren und immer wieder an dieselbe Stelle
gekommen, an den deprimierenden Punkt der verhinder-
ten Weiterfahrt. Weiter geht es hier schon, aber nicht
vorwärts. Hat man ein Interesse daran, weiterzukommen,
so muss man wenden und eine andere Strasse suchen. Es
soll ja Strassen geben, die nie fertig geworden sind, die
man im Eifer des hochkonjunkturellen Strassenbaus in
eine Gegend geführt hat, über die im TCS-Verzeichnis
so gut wie keine orientierenden Angaben existieren. Hier
ist man zur Gänze auf sich selber angewiesen. Die Stras-
se endet vielleicht an einem Schutthügel, verschwindet
im Unterholz, und so unbegreiflich das klingt: es kommt
vor. Hier werden Verbrechen begangen, alte Rechnun-
gen beglichen, Leichen verscharrt. Ich denke mir, so ein
Ort muss es sein, dort haben die Santichläuse ihre Autos
abgestellt. Sie geben es auf. Sie haben sich noch und
noch verfahren und sind jetzt, wie es scheint, endgültig
angekommen. Allerdings nicht am richtigen Ort. Sie
wälzen sich aus ihren Autos heraus, kaum zu glauben,
dass sie sich noch bewegen können, aber sie können es,
sie recken und strecken sich, pusten in die Hände. Über
eine noch warme Kühlerhaube gebeugt, konsultieren sie
eine Strassenkarte, die einer von ihnen aus dem Schub-
fach seines Wagens gekramt hat. Es ist ein nichtamtli-
ches Blatt, zudem völlig veraltet, die Strassen, auf die es
ankommt, sind darin gar nicht eingezeichnet. Was nun?
Die Santichläuse sind nicht dort, wo sie hinwollten, im
Kraut sind sie gelandet, soviel ist ihnen klar, die Situati-
on ist alles andere als rosig, ziemlich verfahren ist sie,
fast hoffnungslos. Sie weisen sich gegenseitig die Schuld
zu. Wer ist vorneweg gefahren? Wer hat nicht aufge-
passt? Aber bald merken sie, dass das nichts bringt. Än-
dert es etwas, wenn man den Schuldigen kennt? Wütend
und ohnmächtig starren sie in die Nacht. Abermals um-
kehren? Nein, kommt nicht in Frage. Bis zum Überdruss
sind sie durch diese stupide Landschaft gefahren und
haben die winzigkleine Ortschaft gesucht wie die Nadel
im Heuhaufen. Jetzt ist Schluss. Sie reagieren sich damit
ab, dass sie sich in Santichläuse verwandeln. Sie ziehen
die Kutten an, schultern die Säcke, nehmen die Knoten-
stöcke zur Hand, die Glocken und Ruten. Die Autos
überlassen sie der Dunkelheit. Wie die Schwarzwaldräu-
ber, einer hinter dem andern, stiefeln sie den nächstgele-
genen Berg hinauf.
Dieses blinde Drauflosstiefeln ist natürlich sinnlos. Wo-
hin soll es führen? Die Gegend liegt weit ab, kein an-
ständiger Weg, nur so eine Art Wildeselpfad, und nir-
gends ein Haus. Viel gibt es hier nicht zu machen für
einen Santichlaus. Eine schöne Geschichte! Santichläuse
ohne Kundschaft. Aber so unvernünftig handeln sie nun
auch wieder nicht. Dass sie durch die Dunkelheit stap-
fen, und zwar so, wie man es von einheimischen Santi-
chläusen gewohnt ist, mit schwarzer Kutte, Holzfäller-
bart, genagelten Schuhen, Glocke, Knotenstock, Rute
und Leinensack, das hat hier ausnahmsweise auch einen
praktischen Grund. Als Santichläuse sind sie für die
naturnahen Fussgängerzonen gut ausgerüstet. Mit dem
Stock können sie den Weg ertasten, mit der Glocke Sig-
nale geben. In den Säcken befindet sich Reiseproviant
für eine längere Expedition. Und das solide Schuhwerk
hält auch den widrigsten Bodenverhältnissen stand.
Überhaupt ist man zu Fuss wesentlich flexibler als mit
dem Auto. Man verpflanzt sich mit einem einzigen
Schritt, während der festgegurtete Autofahrer strampeln
kann, soviel er will: wenn das Auto den Geist aufgibt
oder die Strasse aufhört, kommt er keinen Milimeter
weiter. Befreit man sich hingegen von eingefahrenen
Verhaltensmustern, unpraktikablen Gewohnheiten, so
kommt man automatisch schneller vorwärts, kommt
leichter zum Ziel. Eine alte Binsenweisheit. Die Mög-
lichkeit, vorwärts zu kommen, hängt direkt proportional
vom verfügbaren Handlungsspielraum ab.
Sorglich und leise haben sie sich auf den Weg gemacht,
einer hinter dem andern. Die Nacht ist riesig. Immer
wieder bleiben sie stehen und spähen nach einem Licht
aus, einer menschlichen Behausung. Ich versetze mich in
ihre Lage. Es ist gar nicht so schwierig. Stundenlang
sind sie Auto gefahren, und jetzt, wo sie drauf verzichten
müssen, realisieren sie, freilich etwas missvergnügt,
denn diese Ironie ist nur für mich geniessbar, dass sie
das schwierigste Wegstück noch vor sich haben. Der
Berg steht da wie ein Klotz. Die nächtliche Kühle er-
nüchtert sie. Sie bekommen die Gesichter von Men-
schen, die auf Zehenspitzen eine papierdünne Eisfläche
betreten. Ihre Lippen sind ganz schmal. Der Weg abseits
der Fahrroute birgt Risiken. Die Santichläuse wissen
das. Sie haben Erfahrung. Indem sie die Richtung ihrer
Schritte vorsichtig bestimmen, hin und wieder auch kor-
rigieren, versuchen sie auf dem Weg zu bleiben, der
ihnen zuweilen entschwindet: der Boden ist überwu-
chert, der Wildeselpfad kaum noch zu erkennen. Aber
das macht weiter nichts. Sie drängen sich durch, stamp-
fend, keuchend, flüsternd, ein kleines verlorenes Grüpp-
chen irgendwo da draussen zwischen den Bäumen.
Könnte es sein, dass sie doch noch ein Haus finden?
Könnte es sein, dass sie die Beiz finden, in der ich auf
sie warte?
Es reicht mir. Die Zeit tickt uns davon. Die Santichlau-
sentour hat sich erledigt. Ausserdem darf ich nicht zuviel
trinken. Für jemanden, der sein eigener Chauffeur ist,
sind zwei Bierchen schon mehr als genug. Die Rück-
fahrt, so leid es mir tut, muss auch noch irgendwie be-
standen werden. Fräulein, zahlen bitte. Sagt man hier
noch Fräulein? Ich glaube schon. Ah, da kommen Sie ja.
Danke, dass Sie so prompt sind, Fräulein. Und so
freundlich. Wissen Sie, ich bin ein Santichlaus, aber von
mir haben Sie nichts zu fürchten, ich bin harmlos. Mit
den Rüpeleien meiner Kollegen habe ich nichts zu tun.
Schauen Sie mich nicht so an, Fräulein. Ich gebe Ihnen
ein fettes Trinkgeld. Und mein Ehrenwort als Santich-
laus: ich stecke Sie nicht in meinen Sack. Eine Frau ge-
nügt mir. Also, auf Wiedersehen, hat mich gefreut, eini-
germassen wenigstens. War ein trostloser Santichlausen-
abend, wirklich trostlos, über das Warten bin ich nicht
hinausgekommen. Was soll’s. Ich fahre zurück in die
Stadt. Keine Sorge, die Hauptstrasse werde ich bestimmt
nicht verfehlen. In meinem Auto habe ich fünf GPS-
Geräte, alle voll funktionstüchtig, eine navigatorische
Ausrüstung, mit der ich mühelos die Sahara durchqueren
könnte. Eines der Geräte gehört mir, die andern habe ich
mir sozusagen unter den Nagel gerissen. Dumm für mei-
ne Kollegen, dass sie ihre Autoschlüssel immer offen
herumliegen lassen. Eine schlechte Angewohnheit, fin-
den Sie nicht auch? Sie runzeln die Stirn? Ich weiss, es
ist unfair. Ich habe das Santichlausenrallye mit unlaute-
ren Mitteln gewonnen. Aber einer muss ja gewinnen,
einer muss das Rennen machen. Das ist Brauch.
2007
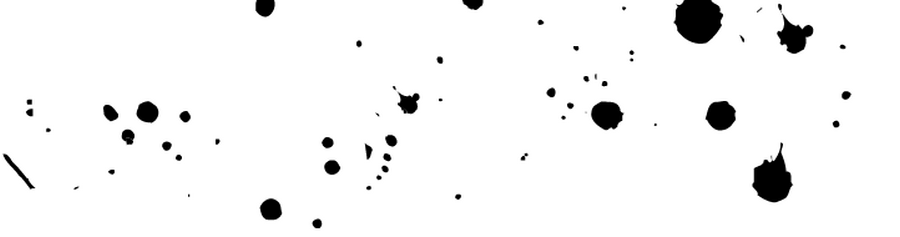 wörter
worte
wörter
worte